| Kolumnen zum Thema THEATER |
 Die unsterbliche Courage
Die unsterbliche Courage
|
Glück gehabt. Mutter Courage und ihre Kinder ist eins der seltenen Theaterstücke, deren Haupt- und Titelfigur weiblich ist und Schauspielerinnen eine saftige Rolle anbietet. Das sichert ihm die Duldung auch durch jene Frauen, die mit Kapitalismuskritik wenig im Sinn haben und den Pazifismus eher mit Bertha von Suttner als mit Erich Mühsam assoziieren. Keine Bedenken bedrohen Aufführungen dieser lange in Schulen vorgeschriebenen Pflichtlektüre, obwohl ihr Autor gegenüber Frauen – na ja, man weiß ja.
Was wäre die Dreigroschenoper ohne Kurt Weill? Was wäre Die Mutter ohne Hanns Eisler? Und was wäre Mutter Courage und ihre Kinder ohne Paul Dessau? Darüber dürfte sich ein großer Teil der Brechtbewunderer und der Brechtverächter einig sein: Die Theaterstücke des meistgespielten deutschen Dramatikers seit 1945 profitieren wie kaum ein anderes Schauspiel von der Kollaboration mit kongenialen Komponisten, und ihre Bühnenmusiken gehören mit Abstand zum Besten, was für das Sprechtheater komponiert wurde. Und so kommt es, dass jede Inszenierung dieser Stücke mit der Tauglichkeit des Gesangs und des Orchesters steht und fällt. Die lässt sich freilich nicht an den Kriterien der Oper bemessen. Die Art und Weise, mit der Brecht-Songs vorgetragen werden, ist für sein Theater nicht weniger vorbestimmt als die Verfremdung oder der Gestus. Und nein: diese wie jene unterliegen nicht einem Dogma. Sie können im dreifachen Hegelschen Sinn „aufgehoben“ werden. Nur muss, was an ihre Stelle gepflanzt wird, mehr und Besseres leisten als das Original. Ansonsten ist es vergebliche Liebesmüh’ und dient nur der marktkonformen Selbstdarstellung.
Der Kern des Brechtschen Konstrukts hat gegenüber der Zeit seiner Entstehung im Jahr 1941 an Transparenz und Plausibilität gewonnen. Dass mit dem Krieg gewissenlos Geschäfte betrieben wären, und sei es auf Kosten von Menschen, die einem nahestehen, ist so offensichtlich und alltäglich, dass es kaum noch als Erkenntnis durchgehen kann. Das Prinzip, das ihm zugrunde liegt, das bedenkenlose kapitalistische Profitdenken, hat sich durchgesetzt und wird, weniger als noch vor 80 Jahren, durch Alternativen infrage gestellt. Jedem Zeitungsleser fallen sofort die heutigen Mütter Courage ein und auf. Die habituellen Optimisten, die an die Belehrbarkeit der Menschen glauben, haben schlechte Karten. Das verleiht Brechts Stück aus dem Dreißigjährigen Krieg, in den Brecht seine Story verlegt hat, also eine Aktualität, auf die man gerne verzichten würde.
|
Thomas Rothschild - 8. Februar 2025
2806
|
 Ungeteilter Beifall
Ungeteilter Beifall
|
"Two's company, three's a crowd": Die englische Redewendung gilt nicht für’s Theater. Da wird es oft erst spannend, wenn mehr als zwei zusammenkommen. Auf der Bühne aber scheint man neuerdings die umgekehrte Richtung zu gehen. Lina Beckmann wird unisono für ihr Solo in Roland Schimmelpfennigs Anthropolis bejubelt. Isabelle Huppert überbietet, als Bérénice allein auf der Bühne stehend, in den Kritiken jeden Superlativ. Diese Extremform der Dramatik, das Einpersonenstück, diente in der Vergangenheit vornehmlich als Material zum Vorsprechen bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. Es eignet sich aber, zumal mit Schauspielstars, für Gastspiele ohne großen Aufwand. Wobei zumindest Bérénice vom Autor Racine nicht als Einpersonenstück konzipiert war wie beispielsweise Thomas Bernhards Einfach kompliziert.
"Two's company", "zwei sind Gesellschaft" kann in den szenischen Künsten zu Höchstleistungen verführen. Unvergessen Thomas Holtzmann und Peter Lühr, Gert Voss und Ignaz Kirchner, im Film Jack Lemmon und Walter Matthau. Sie trieben die dramatische (!) Kunst des Dialogs auf die Spitze. Aber Schauspielerinnen, Schauspieler ohne Gegenüber gleichen den Solostücken von Bachs Suiten für Violoncello solo. Man hört sie gerne als Zugabe, bewundert die Virtuosität der Solisten, aber auf die Dauer möchte man nicht auf ein Orchester, mindestens eine Kammermusikbesetzung verzichten.
|
Thomas Rothschild - 27. August 2024
2802
|
 Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
|
Schlag auf Schlag haben die Fachzeitschriften Die Deutsche Bühne, tanz und Theater heute die von ihren Mitarbeiter*innen per Votum erstellten „Bestenlisten“ für die vergangene Saison veröffentlicht. Die Stiftung Warentest kann sich ihres prägenden Einflusses erfreuen. Und die Leser*innen wähnen sich informiert, in bewährter Reihenfolge und mit vorgetäuschter Objektivität, die sich trügerischen Mehrheiten verdankt.
Die Ergebnisse der Umfragen sind das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt sind und von wo sie landauf landab abgeguckt werden, wenn die Autor*innen, die sie zu verantworten haben, nicht allesamt unter die Lupe genommen werden. Wenn, wie fast stets in der Vergangenheit, jene Häuser favorisiert werden, aus deren Städten eine größere Zahl von Abstimmenden stammt, so besagt das allenfalls, dass diese immer weniger Aufführungen außerhalb ihrer Heimatstadt besuchen, es sei denn, sie wurden fürs Berliner Theatertreffen ausgewählt, das so die Funktion der self-fulfilling prophecy erfüllt. Kein Wunder: wer, außer Spiegel, Die Zeit und Deutschlandfunk, zahlt noch Reisespesen? Selbst Christine Dössel von einer der größten und einflussreichsten deutschen Tageszeitungen hat mit einer wehmütigen Erinnerung an ihren Vorgänger, der bei auswärtigen Theaterbesuchen im teuersten Hotel am Ort übernachten durfte, darüber geklagt. Wie fiele das Ergebnis aus, wenn alle Voten der Mitarbeiter*innen für die Häuser am Ort gestrichen würden, wie beim ESC nicht für die Konkurrenten aus dem eigenen Land gestimmt werden darf? Die Umfragen der „Fachzeitschriften“ gleichen einem Plebiszit, bei dem Hamburger den HSV und Stuttgarter den VfB für den besten Verein Deutschlands, wenn nicht der Welt halten.
Muss man immer gleich vom „Besten“ reden? Geht’s nicht eine Nummer kleiner? Listen präsentieren die Titel der angeblich besten oder wichtigsten Theater- oder Tanzstücke, wie die Illustrierten regelmäßig die reichsten, die populärsten oder die schönsten Persönlichkeiten des sogenannten öffentlichen Lebens präsentieren. Und so ist auch mit der Nennung einer Inszenierung über Theater ebenso wenig ausgesagt wie mit der Auflistung eines Bill Gates oder einer Julie Andrews in irgendeiner Prominentenrangfolge.
Die Auswahl durch eine Jury, ob sie nun leibhaftig oder nur per Internet zusammenkommt, erweist sich zudem als zwiespältig. Zwar werden die Entscheidungen damit der Subjektivität eines Einzelnen entzogen. Aber Juryentscheidungen haben immer die Tendenz, das Gefällige, auf das sich alle einigen können, gegenüber dem Radikalen, dem Sperrigen, dem Avantgardistischen zu bevorzugen. Da stets jene Kandidaten die höchste Punktezahl erreichen, die von den meisten Juroren gekannt und akzeptiert werden, ist das Ergebnis notwendig der kleinste gemeinsame Nenner. Dem gegenüber wäre eine Folge von wechselnden Subjektivitäten anregender, spannender und letzten Endes auch fairer gegenüber den "Außenseitern".
Man mache doch endlich Schluss mit dem pseudodemokratischen Unfug der Mitarbeiterabstimmungen, in denen Heilbronn, Regensburg oder Rudolstadt gegen Hamburg keine Chance haben.
Damit wir uns nicht missverstehen: die eine oder andere Spitzenposition kann durchaus ihre Berechtigung haben. Sie verdankt sich aber nicht der Weisheit oder dem Sachverstand der Mitarbeiter*innen, sondern den statistischen Regeln, denen sie und die Methode der Umfragen ausgeliefert sind, im Verein mit dem Zufall. Die Umfragen sind nicht mehr als ein Brimborium zur Befriedigung der Kritiker-Eitelkeit.
|
Thomas Rothschild - 22. August 2024 (2)
2800
|
 Eine subjektive Liste
Eine subjektive Liste
|
In den Medien werden regelmäßig einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler porträtiert, die den Autoren in erstaunlicher Übereinstimmung als überragend erscheinen. Meist sind es solche, die zumindest auch in Film und Fernsehen reüssieren. Das Theater ist längst nicht mehr konkurrenzfähig, jedenfalls was die Bekanntheit betrifft.
Als Ausgleich veröffentliche ich hier eine Liste meiner Lieblingsschauspieler*innen an deutschsprachigen Bühnen. Sie ist selbstverständlich subjektiv, kann es anders gar nicht sein. Denn erstens kenne ich viele Theater und ihre Ensembles nicht, und zweitens habe auch ich einen Geschmack, über den man mit Fug und Recht streiten kann. So gesehen ist diese Liste ungerecht, nicht wegen der genannten, sondern wegen mancher ausgelassener Namen. Eins aber kann diese Liste leisten: Sie erinnert an Repräsentanten der flüchtigen Theaterkunst, die es nicht verdienen, vergessen zu werden.
Voilà!
Kathrin Angerer
Constanze Becker
Lina Beckmann
Bibiana Beglau
Michaela Bilgeri
Sibylle Canonica
Andrea Clausen
Edith Clever
Kirsten Dene
Tina Engel
Regina Fritsch
Cornelia Froboess
Therese Giehse
Maria Happel
Corinna Harfouch
Nicole Heesters
Hannelore Hoger
Nina Hoss
Gertraud Jesserer
Andrea Jonasson
Corinna Kirchhoff
Jutta Lampe
Ursina Lardi
Susanne Lothar
Dörte Lyssewski
Birgit Minichmayr
Barbara Nüsse
Caroline Peters
Christiane von Poelnitz
Ilse Ritter
Sylvie Rohrer
Sophie Rois
Doris Schade
Hildegard Schmahl
Elisabeth Schwarz
Katharina Thalbach
Anne Tismer
Angelika Winkler
Johanna Wokalek
Rosel Zech
Gert Baltus
Heinz Bennent
Josef Bierbichler
Joachim Bißmeier
Rolf Boysen
Traugott Buhre
Ernst Deutsch
Lars Eidinger
Samuel Finzi
Bruno Ganz
Boy Gobert
Christian Grashof
Jörg Gudzuhn
Norman Hacker
Jens Harzer
Wolfgang Heinz
Thomas Holtzmann
Wolfgang Hübsch
Robert Hunger-Bühler
André Jung
Norbert Kappen
Ignaz Kirchner
Roland Koch
Peter Kurth
Helmuth Lohner
Peter Lühr
Michael Maertens
Markus Meyer
Joachim Meyerhoff
Tobias Moretti
Ulrich Mühe
Johann Adam Oest
Nicholas Ofczarek
Karl Paryla
Romuald Pekny
Friedrich-Karl Praetorius
Hans-Michael Rehberg
Peter Roggisch
Leopold Rudolf
Branko Samarovski
Udo Samel
Ekkehard Schall
Otto Schenk
Walter Schmidinger
Martin Schwab
Edgar Selge
Peter Simonischek
Ernst Stötzner
Hilmar Thate
Thomas Thieme
Ulrich Tukur
Gert Voss
Oskar Werner
Ulrich Wildgruber
Werner Wölbern
Martin Wuttke
Manfred Zapatka
|
Thomas Rothschild – 24. Juni 2024
2797
|
 Das Elend mit der Psychologie
Das Elend mit der Psychologie
|
Das Theater der Renaissance war weder realistisch noch psychologisch. Zwar strotzen Shakespeares Stücke nur so von Menschenkenntnis, zwar liefern sie atemberaubende Einsichten in die individuelle und die gesellschaftliche Wirklichkeit, aber im Theater der Shakespearezeit hatte die Stilisierung stets Vorrang vor der abbildlichen Darstellung der Erfahrungswelt. Nun ist es durchaus legitim, wenn sich heutige Zuschauer über die Kunstfertigkeit freuen, mit der große Schauspielerinnen und Schauspieler nachahmen, was ihnen aus dem Alltag bekannt ist. Aber dass sie sich mehr und mehr schwertun mit einem Theater, das genau dies gar nicht anstrebt, das vielmehr seine eigene Sprache entwickelt, ist ein Verlust, den wir – sprechen wir es unverblümt aus – dem Fernsehen verdanken. Es soll hier nicht verteufelt werden, es hat ja seine Funktion. Aber wenn es zum Modell für die szenischen Künste wird, wenn sich Schauspielkunst darüber definiert, ob jemand die Augen aufschlägt und die Stirn runzelt wie ein echter Arzt, wie eine echte Unternehmerin, dann ist es schädlich. Das Wort ist so gemeint, wie es hier steht: schädlich.
Joachim Meyerhoff, einer der besten und klügsten Schauspieler seiner Generation, spielte einst am Burgtheater den Malvolio in Was ihr wollt, und er hat über die Rolle nachgedacht:
"Erst einmal hat Malvolio gar nichts verbrochen. Aber er ist boshaft. Das ist bei Shakespeare oft so: Für die Bosheit gewisser Figuren bekommt man keine autobiografischen Hinweise geliefert. Man denke an Jago in Othello: Was veranlasst ihn, andere zu vernichten? Woher kommt seine Beschädigung? Wie Schauspieler so sind, sagen sie dann: Der muss etwas Schlimmes erlebt haben! Damit kommt man bei Shakespeare leider nicht weit. Das ist eine Setzung. Malvolio ist übrigens auch gar nicht 'böse': Er trägt das Prädikat des Puritaners und drückt damit eine Geisteshaltung aus."
Mal abgesehen davon, dass "biografisch" genauer wäre als "autobiografisch", denn nur in seltenen Fällen wird das Leben von der Figur selbst erzählt, ist der Befund insofern richtig, als es bei Shakespeare "oft so" ist. Gerade auf Malvolio allerdings trifft er nicht zu. Für die Ursache seiner Boshaftigkeit gibt es sehr präzise Hinweise. Er ist ein Aufsteiger und will, noch ehe ihm der gefälschte Brief zugespielt und in ihm eine irreführende Hoffnung auf die Liebe Olivias erweckt wird, die ihn zum Gespött macht, um jeden Preis seiner Herrin gefallen. Deshalb muss er sich durch übersteigerte Arroganz und Bösartigkeit gegenüber den "unter" ihm Stehenden auszeichnen, gegenüber dem Dienstpersonal und dem bei Olivia schmarotzenden ewig besoffenen Onkel Toby. Gerade Malvolios Bosheit ist soziologisch wie psychologisch außerordentlich modern motiviert. Meyerhoff bemerkt absolut zutreffend:
"Das Bürgerliche wird mit Malvolio überhaupt erst konstituiert. Bürger gibt es nicht häufig bei Shakespeare. Wir kennen Dienerfiguren, den Falstaff. Aber diese komischen Figuren aus der Zwischenebene, die zur Macht drängen, die Bürgerlichen, denen eigentlich die Zukunft gehört, die findet man selten. (...) Malvolio drückt die Ideologie einer neuen Klasse aus."
Malvolio repräsentiert ein Bürgertum, das die Stellung der Aristokratie einnehmen will und sich, statt sie zu bekämpfen, an diese anschleimt. Es ist das Bürgertum, das im 19. Jahrhundert dann seine Börsen, Bahnhöfe und Museen nach dem Vorbild der Adelsschlösser erbaut und die Manieren der Aristokratie, meist hilflos und daher lächerlich, zu imitieren versucht. Es verbündet sich mit jenen, von denen es getreten wurde, gegen die nachrückende Klasse und zeichnet sich dabei durch besonderen Eifer aus. In der deutschen Dramatik war es Carl Sternheim, der dieses Phänomen wie kein Zweiter auf die Bühne gebracht hat.
Auch Beate Seidel, damals Dramaturgin der Stuttgarter Inszenierung von Romeo und Julia, wollte es genau wissen. Auf dem Programmzettel fragte sie: "Und was hasst Tybalt an diesen jungen Montagues so gnadenlos?" Diese Frage kann man historisch und philologisch für das 16. Jahrhundert zu beantworten versuchen oder erfinderisch und mehr oder weniger beliebig für unsere Zeit. Aber sie ist ungefähr so sinnvoll und gegenüber einer literarischen Logik so adäquat wie die Frage, warum der Fischer, der das goldene Fischlein ins Wasser zurückwirft, drei und nicht zwei oder sechs Wünsche freihat. Tybalt hasst die Montagues, weil er die Montagues hasst. Psychologisierung führt hier in die Irre. Tybalt hasst die Montagues, weil die Story das erfordert. Tybalt muss die Montagues hassen, weil in Verona "zwei Häuser waren, durch alten Groll zu neuem Kampf bereit". Das ist die Ausgangssituation, was Joachim Meyerhoff völlig korrekt eine "Setzung" nennt, weiter braucht Tybalt keine Gründe. Im Übrigen brauchen Menschen auch diesseits von Freud keine Gründe, um andere zu hassen. "Ich kann den Novotny nicht leiden!" heißt es in einem Chanson von Hugo Wiener.
Bedenkenswerter als Tybalts Hass wäre die Frage, warum uns der Vers von der Nachtigall, nicht der Lerche nach mehr als 400 Jahren immer noch berührt. Wer das beantworten könnte, käme dem Geheimnis Shakespeare näher. Denn wer sagt: "Es war die Nachtigall und nicht die Lerche", wenn er meint, "es ist noch sehr früh", an dem interessiert uns mehr als ein totes Liebespaar oder der Hass eines Capulet-Sprosses.
Es ist ja schon bei Shakespeare nicht wahr, dass Romeo und Julia, wie die Regisseurin sagt, bereit seien, für die Liebe bis in den Tod zu gehen, oder, wie Beate Seidel behauptet, "in Schönheit gegen die unerbittliche Welt, die eine so ausschließliche Liebe nicht zulassen will", zu sterben. Julia will zunächst nicht sterben, sondern eine List anwenden, um danach fröhlich mit Romeo weiterzuleben. Romeo will nicht im Widerstand gegen eine "unerbittliche Welt" sterben, sondern weil er Julia tot wähnt, Julia will sterben, weil Romeo dann tatsächlich tot ist. Ein Missverständnis, das auch den Stoff für Komödien abgeben könnte. Hier wird es zur Tragödie: tragisch ist der Tod, der vermieden hätte werden können wie die Vergiftung Luises durch Ferdinand in Kabale und Liebe.
Dieser vermeidbare Doppeltod unterscheidet sich grundsätzlich vom – sei es durch gesellschaftliche, sei es durch "private" Umstände motivierten – freiwilligen Doppelselbstmord, den die Romantik und die Trivialliteratur – Stichwort Mayerling – (sowie, kulturgeschichtlich bedingt, die japanische Literatur) verklären. Romeo und Julia haben gar keine Gelegenheit, den gemeinsamen Tod zu vereinbaren. Sie reden immer nur zu Toten und Scheintoten. Eigentlich ein bisschen deppert. Wie schön ist verglichen damit Ernst Lubitschs auf dem Schweizer Heimatroman Der König der Bernina basierender Stummfilm Eternal Love. Da gehen Marcus und Ciglia alias John Barrymore und Camilla Horn Hand in Hand in eine Lawine hinein, um einer ausweglosen Situation und, jawohl, Beate Seidel, einer "unerbittlichen Welt" zu entfliehen, die den unschuldigen Marcus als Mörder brandmarkt und Ciglia zur Ehe mit dem ungeliebten Lorenz verdammt hat. Mal ehrlich: kommen Romeo und Julia dagegen an?
|
Thomas Rothschild - 21. Mai 2024
2790
|
 Kein Gefallen für Kurt Schwitters
Kein Gefallen für Kurt Schwitters
|
Im Neuen Deutschland schreibt Michael Wolf über Kurt Schwitters’ Ursonate am Deutschen Theater, mit der Claudia Bauer ganz offenkundig den Erfolg von humanistää! nach Ernst Jandl am Wiener Volkstheater zu wiederholen versucht: „Die ganze Anstrengung dieses Theaterabends, und es ist eine gewaltige, beruht darin, Bedeutung zu stiften, wo zuvor keine zu erkennen war. Claudia Bauer und ihr Ensemble zähmen Schwitters, sie machen ihn konsumierbar. Das schallende Lachen des Publikums zeugt auch ein wenig von der Dankbarkeit, nicht mit Bedeutungslosigkeit konfrontiert zu werden. Anders gesagt: Mit Dada oder mit ‚Merz‘ hat das, was auf der großen Bühne des Deutschen Theaters stattfindet, nicht mehr viel zu tun.“
Der Einwand von Michael Wolf ist nicht eine Meinung unter anderen, sondern entscheidend. Wer dem Bedürfnis nach Bedeutung, nach „Sinnstiftung“ nachgibt, wo diese mit Absicht torpediert wurde, zerstört eine – nicht die einzige, aber eine für die Moderne wesentliche – literarische Entwicklung. Man geht den einfachen Weg und vermeidet die Herausforderung der Differenzwahrnehmung. Es ist, als würde man Schönbergs Kompositionen ins Tonale „übersetzen“. Fazit: die revolutionären Ansätze von Schwitters, Chlebnikov, Krutschonych bedürfen nach 100 Jahren immer noch kämpferischer Advokaten. Noch einmal: nicht als einzige, aber als eine Möglichkeit der Literatur. Wer sie missachtet, betreibt, populistisch, das Geschäft der (ästhetischen) Reaktion. Da bekommt das „Regietheater“ eine neue Dimension. Es wird zur Anbiederung an die Denkfaulheit. Herbert Fritsch ist einen anderen Weg gegangen. Er hat mit seinen Adaptionen von Dieter Rot oder Konrad Bayer gezeigt, dass auch auf der Bühne der Geist des „selbstwertigen Worts“, der „transmentalen Sprache“ vermittelt werden kann. Man muss sich bloß ernsthaft darauf einlassen.
Zweitausendeins hat schon vor Jahren eine vierstündige MP3-CD herausgebracht, die das Vergnügen gewährt, verschiedene Interpretationen der Ursonate und anderer Lautdichtungen von Kurt Schwitters zu vergleichen. Zu den Interpreten gehören Gerhard Rühm, dessen eigene Dichtung ohne Schwitters schwer vorstellbar ist, Max Ernst, der die Ursonate in einer Rede zitiert hat, der Sohn von Kurt Schwitters Ernst, dessen eigene, 1993 bei wergo erschienene Stimme lange als die seines Vaters galt, die Dichterkollegen Raoul Hausmann und Otto Nebel. Die musikalischste Version liefert das Trio Exvoco, das sich kontinuierlich und virtuos um Schwitters bemüht hat. Beim Anhören stellt man fest, wie schwierig es ist, nicht nach Bedeutungsanklängen zu fahnden, Silben nur als phonetische Gebilde wahrzunehmen. Auch bei der zwanghaften Suche nach Ordnungsprinzipien fallen einem sogleich die vertrautesten, etwa das Alphabet auf. Wir sind geprägt, Sprache und Literatur als „sinnvoll“ zu verstehen. Der Traum von Schwitters, Chlebnikov und anderen ist nur bruchstückhaft in Erfüllung gegangen. Claudia Bauers Unternehmen scheint da, wenn man Michael Wolf folgt, eher kontraproduktiv zu sein.
|
Thomas Rothschild - 19. Dezember 2023
2785
|
 Premierenhumbug
Premierenhumbug
|
Eigentlich gibt es wenig Gründe, die dafür sprechen, Premieren zu besuchen. Man begegnet dort den stadtbekannten Snobs und den Damen der Gesellschaft, die ihr neues Kleid ausführen wollen. Die Inszenierung ist noch nicht eingespielt, die Reaktion des Publikums atypisch. Wenn man aber als Kritiker berichten soll, bleibt einem oft nichts anderes übrig, als zur Premiere zu gehen. Nichts zwingt einen, anschließend bei der Premierenfeier zu bleiben und jenen Schauspielern zuzuprosten, über die man vorurteilslos und ehrlich schreiben soll.
Am meisten aber nerven bei Premieren die Kolleg*innen der Mitwirkenden, die für diesen Abend keine Rolle bekommen haben und sich wenigstens durch lautstarke Reaktionen aus dem Zuschauerraum in Szene setzen wollten. Sie lachen affektiert, klatschen, pfeifen und grunzen hysterisch und fürchten nichts so sehr, wie dies: dass man sie nicht bemerken könnte.
Premieren verhalten sich zu Repertoirevorstellungen wie neue Schuhe zu eingelaufenen Schuhen. Sie zwicken und zwacken, wo sich diese bequem tragen lassen. Die professionelle Kritik aber schreibt über die Schuhe, bei der noch nicht einmal erprobt ist, ob die Größe stimmt. Noch ungerechter ist sie bei Opern- und Ballettinszenierungen, seltener im Sprechtheater, mit Doppel- oder Mehrfachbesetzungen. Die Zweitbesetzung bleibt fast immer von den Medien unbeachtet. Fair ist das nicht.
Neben den Kritikern sind es zu einem großen Teil die Adabeis und die Damen und Herren der örtlichen Gesellschaft, denen am Vorweis ihrer jüngst erworbenen Kleidung und Schmuckgehänge und am Aperol Spritz in der verlängerten Pause mehr gelegen ist als am Bühnengeschehen, die die Premieren füllen.
Nirgends haben sich Theater und Oper nachhaltiger als Institution bürgerlicher Snobs erhalten als bei den Premieren. Sie hat die Konkurrenz von Kampnagel und Freier Szene unbeschadet überlebt. Aber was soll man dagegen unternehmen, solange die Medien in ihrem unerbittlichen Konkurrenzkampf zu den ersten gehören wollen, die berichten. Der Standard in Wien weiß sogar schon vor der Premiere und erst recht der weiteren Stücke, dass Nathan der Weise der Höhepunkt des Schauspielprogramms der heurigen Salzburger Festspiele ist. Wozu braucht man bei so viel Hellsicht noch eine Premierenkritik?
|
Thomas Rothschild - 28. Juli 2023
2776
|
 Corinna Harfouchs Geständnis
Corinna Harfouchs Geständnis
|
Corinna Harfouch hat kürzlich geäußert, sie würde prinzipiell in jede Rolle schlüpfen, aber sie müsse eine gewisse Qualität als Grundbedingung mitbringen. Nun mag man einwenden, dass sie, die große Corinna Harfouch, sich das leisten könne, zumal sie nicht präzisiert, was als „gewisse Qualität“, gar objektivierbar, gelten dürfe. Immerhin aber gesteht sie damit ein, dass es Rollen gibt, die (ihren) Qualitätsforderungen nicht genügen.
Das hatten wir geahnt. Andere Schauspielerinnen und Schauspieler aber schlüpfen bedenkenlos in diese Rollen, sei es, weil sie für eine Minute im Rampenlicht, wie man früher zu sagen pflegte, ihre Großmutter verkaufen würden, sei es, weniger ehrrührig, weil sie sich als festangestellte Mitglieder eines Ensembles dem Drängen des Intendanten, der Intendantin kaum verweigern können. Aber sie müssen die Folgen dann auch aushalten.
Selten, nur sehr selten gelingt es einem Schauspieler, einer Schauspielerin, aus einer Rolle ohne Qualität doch noch Funken zu schlagen. Wer solch eine Rolle übernimmt, macht sich zum Komplizen des (toten oder lebenden) Autors. Das gehört ja gerade, bei Rollen mit Qualität, zu seinen Verdiensten. Er darf sich aber nicht beklagen, wenn Rezensenten, die eine Aufführung, nicht einen Text zu besprechen und zu bewerten haben, mit Lob für seine Arbeit sparen oder sie gar ignorieren, wo die Rolle die von Corinna Harfouch eingeforderte Qualität vermissen lässt. Mitgegangen, mitgehangen. Das mag schmerzlich sein. Aber schließlich sind Künstler mündige Menschen. Und ein wenig werden sie für solche Unbill dadurch entschädigt, dass sie beim nächsten Mal von der Qualität einer Rolle profitieren. Sie bekommen dann, spätestens beim Schlussapplaus, etwas von dem Kuchen ab, der eigentlich für die Autorin, den Autor gebacken wurde. Warum spielen Schauspieler über Jahrhunderte hinweg so gerne den Hamlet oder den Lear? Deshalb.
|
Thomas Rothschild - 13. Mai 2023 (2)
2768
|
 Söders Irrtum
Söders Irrtum
|
Markus Söder hat zwar recht, wenn er anlässlich der Erhebung des Regensburger Theaters in den Status eines Staatstheaters verkündete, „Warum sollte hochwertigste Kunst nur in München möglich sein? Woanders kann künstlerische Qualität auf dem gleichen Level stattfinden“, aber unrecht mit der Suggestion, diese künstlerische Qualität sei an den Status, eben eines Staatstheaters, und an die damit verknüpften Fördermittel gebunden. Seinen Qualitätsnachweis hat Regensburg erbracht, ehe ihm Söder mit wohlfeiler Rhetorik das Geschenk überreichte, und die Landes- und Stadttheater zwischen Bruchsal und Dessau tun desgleichen, ungeadelt, unbedankt und unterfinanziert. Zur Erinnerung: auch die nicht ganz unbedeutenden Städtischen Bühnen Frankfurt, die Bühnen der Stadt Köln, die Wuppertaler Bühnen mitsamt dem von Pina Bausch gegründeten Tanztheater sind keine Staatstheater. Der Befund wird noch deutlicher, wenn der Blick über die deutschen Landesgrenzen hinaus reicht. Hochwertigste Kunst ist ohne staatlichen Segen in Paris, London oder in Mailand möglich. Giorgio Strehler, Ariane Mnouchkine, Peter Brook und viele andere kamen ohne ihn aus. Was freilich der Politik nicht als Vorwand dienen darf, sich der ökonomischen Verantwortung für die Künste zu entziehen.
Die Geschichte der Theater liefert zahlreiche Belege dafür, dass nicht vom Staat unterhaltene Theater, dass freie Gruppen interessantere Ergebnisse vorweisen als die Repräsentationshäuser. So waren beispielsweise in Prag, schon vor der kulturellen Blüte während des Prager Frühlings, die kleineren, nicht staatlichen Theater aufregender als die keineswegs zu verachtenden Nationaltheater. Eins trifft allerdings zu: größere finanzielle Zuwendungen, die fast nur der Staat aufbringen kann, wirken sich partiell auch auf die Qualität aus. Auf überteuerte Ausstattungen kann man vielleicht verzichten. Jedenfalls tragen sie keineswegs immer zur künstlerischen Qualität bei. Aber die Größe des Ensembles, des Teams hinter der Bühne, ermöglicht Produktionen, die mit geringerem Personal nicht realisierbar sind. Und die höheren Gagen an den Staatstheatern haben zur Folge, dass besonders begabte Schauspieler und Regisseure abgeworben werden können, wenn sie sich an „ärmeren“ Häusern bewährt haben. Der Vorgang ist alltäglich, und die Direktoren sind nicht zimperlich mit ihren Lockungen. Das mag man bedauern, aber die Augen sollte man vor der Tatsache nicht verschließen. Ein fairer Wettbewerb ist eine Illusion. Auf welchem Level hochwertige Kunst stattfindet, wird nicht nur, aber auch in den Buchhaltungsabteilungen entschieden. Und mit dem Geld, das – vergessen wir es nicht – nicht der Staat, sondern die Gemeinschaft der Steuerzahler erwirtschaftet hat. Ein Söder, der das Regensburger Theater zu einem Staatstheater macht, steht in der Tradition fürstlicher Privilegierungen. Die mögen im einen oder anderen Fall erfreulich sein. Mit Demokratie freilich hat das nichts zu tun.
|
Thomas Rothschild - 30. April 2023
2766
|
 Antisemitismus oder Antifeminismus
Antisemitismus oder Antifeminismus
|
Das Dilemma jeder zeitgenössischen Inszenierung von Shakespeares Kaufmann von Venedig: Bekanntlich trickst die schöne Portia und künftige Frau Bassianos in der Verkleidung eines Richters den Juden Shylock aus mit einer Entscheidung, die ihn seiner materiellen und ideellen Grundlagen beraubt und den Interessen der Richterin unmittelbar dient. Bei Shakespeare ist sie die Heldin. Heute stellt dieser Schluss jeden Regisseur vor eine knifflige Aufgabe. Wer mit Portia sympathisiert und das Publikum dazu verleitet, mit ihr zu sympathisieren, sympathisiert mit ihrem Antisemitismus und ihrer Missachtung von Gerechtigkeit. Wer sie aber kritisch betrachtet, verstößt gegen das vielerorts eingemahnte Dogma, wonach Frauen im Disput mit Männern recht behalten müssen. Denn es ist ja keine Nebensache, dass im Kaufmann von Venedig nicht ein Mann, sondern eine als Mann verkleidete Frau Recht (oder eben Unrecht) spricht. Wer das Dogma nicht befolgt, macht sich in der veröffentlichten Meinung des Antifeminismus verdächtig. Man hat also die Wahl: Antisemitismus oder Antifeminismus. Ein Drittes gibt es nicht. Jedenfalls nicht beim Kaufmann von Venedig.
Apropos: Mit Befriedigung darf das Publikum beim Kaufmann von Venedig registrieren, dass dem Juden die geliebte Tochter gestohlen wird. Schließlich erlangt sie dadurch den richtigen Glauben und die Rettung ihrer Seele. Wo in der Literatur findet man den christlichen Vater, bei dem man sich über die Entführung der Tochter durch einen Juden freuen darf?
|
Thomas Rothschild - 16. März 2023
2762
|
 Ihr eigen Sach´ betreibt
Ihr eigen Sach´ betreibt
|
Auch in diesem Jahr lädt das Münchner Volkstheater ausgewählte Inszenierungen zu seinem seit 2005 bestehenden Nachwuchsregie-Festival "radikal jung" ein. Die vier Kuratoren, die über die Auswahl befunden haben, sind im Schnitt 57 Jahre alt, also nicht gerade radikal jung. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Warum sollen Theaterleute jenseits der Hälfte des Lebens nicht Bescheid wissen über Jüngere und Jüngeres und sie beurteilen können? Allerdings darf man von ihnen erwarten, dass sie Stellung beziehen gegen die allseits mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit verlautete Behauptung, dass nur Farbige das Werk von Farbigen, nur Frauen das Werk von Frauen, nur Transgender das Werk von Transgender beurteilen können, wenn sie sich nicht dem Verdacht aussetzen wollen, dass sie lediglich dort auf Quoten und Ausschlüsse pochen, wo sie sich für sich selbst und das Kollektiv, dem sie angehören, einen Vorteil versprechen. Es macht zwar nicht populär, wenn man, ganz im Sinn von Kants Kategorischem Imperativ, auf die konsequente Einhaltung eines Prinzips, auf dessen Allgemeingültigkeit – für oder gegen "positive Diskriminierung", für oder gegen Quoten – pocht, aber es ist die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit, es ist ein moralisches Gebot.
Es bleibt eine schöne Utopie, dass die Welt gerechter werden möge. Zu mehr als einer Utopie hat es bislang nicht gereicht. Wer Gerechtigkeit nur dort einfordert, wo er – zu Recht oder zu Unrecht – der Meinung ist, dass sie ihm vorenthalten wird, trägt in Wirklichkeit zur universellen Ungerechtigkeit bei. Und huldigt einer Doppelmoral, die Vorteilsannahme mit – ja, Gerechtigkeit eben verwechselt. Man kann durchaus Sympathie empfinden für die Angestellten im öffentlichen Dienst, die für höhere Löhne streiken. Es mag zwar ärgerlich sein, wenn die Straßenbahnen nicht fahren oder die Post nicht zugestellt wird, aber das Streikrecht ist ein verteidigenswertes Gut der Demokratie. Die Mitwirkung in einer Jury ist es nicht. Man kann der Überzeugung sein, dass Entscheidungsträger wesentliche Eigenschaften – Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Minderheit – mit den Menschen, über die sie entscheiden, teilen müssen oder nicht. Mal so, mal so, geht nicht. Es ist ungerecht, verlogen – und leider alltäglich.
|
Thomas Rothschild - 4. März 2023
2761
|
 Sieg nach Punkten
Sieg nach Punkten
|
Wenn Auszählungen über die Qualität von Kunst befinden, dann gibt es in diesem Theaterjahr einen unanfechtbaren Favoriten. Keine andere Inszenierung hat bei den zahlreichen Preisen und Umfragen innerhalb des deutschsprachigen Raums so viele Nennungen auf sich vereinigt wie humanistää! nach Texten von Ernst Jandl in der Regie von Claudia Bauer am Wiener Volkstheater. Die Superlative häuften sich, als gälte es, ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Die simple statistische Gegebenheit ließ den noch ziemlich neuen Intendanten Kay Voges leere Vorstellungen und eine insgesamt eher laue Rezeption zugunsten eines übermütigen Eigenlobs vergessen, das, wenn überhaupt, der schon seit 15 Jahren zu Recht erfolgreichen Regisseurin gebührte.
Worauf aber beruht die Einhelligkeit der Zustimmung zu diesem – zugegeben: ungewöhnlichen – Bühnenereignis? Es hat den Anschein, dass sie sich dem Überdruss am realistischen, psychologistischen Theater verdankt. Freie Gruppen leisten schon seit längerem dagegen Widerstand, aber sie kommen zu einem guten Teil über laienhafte Ansätze nicht hinaus. humanistää! verabschiedet sich radikal vom Realismus und ist zugleich schauspielerisch hochprofessionell. Zwar müssen die Darsteller*innen verdrängen, was sie an der Schauspielschule gelernt haben, aber sie haben ganz offensichtlich ihr Vergnügen daran.
So originell, wie manche Kritiker glauben lassen, ist humanistää! allerdings auch wieder nicht. Claudia Bauer hat Anregungen aus den Dieter Roth- und Konrad Bayer-Revuen von Herbert Fritsch, aus den Theaterabenden von Christoph Marthaler, auch von Loriot und möglicherweise von der Familie Flöz zu einer zweistündigen Collage verarbeitet und mit Musik verkleistert. Ton und Bild werden getrennt. Während im Zentrum der Bühne meist stumm agiert wird, lesen Sprecher*innen den Text im Halbdunkel am Rande der Bühne in Mikrophone. Dabei kann sich eine der Damen nicht enthalten, mit Verrenkungen und großen Gesten dennoch zu „spielen“.
Manche Texte, die Jandl für die Bühne geschrieben hat, funktionieren gut. Andere fordern ein Lesen oder Sprechen (am besten von Jandl selbst). Die Versuche, sie szenisch umzusetzen, schaden dem Sprachwerk eher als es zu unterstützen. Dem entspricht die Fehlentscheidung, Samouil Stoyanov, der jeden Preis als Sprecher des Jahres verdient hätte, just für ein längeres Solo aus dem Stand mit dem „Nestroy“ für den Besten Schauspieler des Jahres auszuzeichnen. Auch der Vortrag von Jandls Gedichten in „heruntergekommener Sprache“ im Stil von Clownsszenen führt in die falsche Richtung. Die gestischen und aufdringlich mimischen Zutaten bekommen dem Wort ebenso wenig wie Sauce einem Wiener Schnitzel oder einem Apfelstrudel. Und wenn zu unzähligen Wiederholungen von Jandls frühem Gedicht „ich was not yet/ in brasilien/ nach brasilien/ wulld ich laik du go“ lateinamerikanischer Tanz persifliert wird, ist das weder „eine abschaffung der sparten“ (so der Untertitel des Programms), noch komisch, sondern – sorry – bloß läppisch und übrigens eine Desavouierung von Jandls Poetik. Es mangelt humanistää! zudem an Marthalers Timing wie an Fritschs Virtuosität.
Wie wenig für großes Theater nötig ist, wie viel der Dialog zugleich zu leisten vermag, beweist just der Technikfetischist Kay Voges mit seinem zehn Jahre alten Endspiel, das er aus Dortmund nach Wien mitgebracht hat. Frank Genser und Uwe Schmieder (die beiden Mülltonnen mit Nagg und Nell sind, wie so oft, gestrichen) reihen sich würdig ein in die Riege der legendären Darsteller von Samuel Becketts Clownspaar Hamm und Clov, die bei Voges Purl und Lum heißen, und beschwören in Loops das Immergleiche. Dass das Endspiel endlos wiederholt werden kann, ohne zu altern, kann als Bestätigung von Becketts Fortschrittsskepsis gelten. Es ändert sich nichts. Nicht einmal das Ende.
|
Thomas Rothschild - 24. Januar 2023
2759
|
 Eine Frage der Perspektive
Eine Frage der Perspektive
|
Am Badischen Staatstheater Karlsruhe hat die Schauspieldirektorin und Regisseurin Anna Bergmann Tschechow verbessert. Sein erstes Stück heißt bei ihr nicht Iwanow, sondern Anna Iwanowa. Iwanows schwerkranke Frau, die er wegen ihres erhofften Erbes geheiratet hat und die seinetwegen vom jüdischen Glauben konvertiert ist, spricht bei Bergmann den Text Iwanows, handelt wie er und erschießt sich schließlich wie er in Tschechows zweiter Fassung. Iwanow hingegen spricht, lebt und stirbt in Karlsruhe wie anderswo seine Frau.
Laut Homepage des Karlsruher Theaters wirft Anna Bergmann „einen neuen Blick auf Tschechows erstes Theaterstück Iwanow und erzählt aus der Perspektive der in dieser Inszenierung weiblichen Titelfigur“.
Hier spielt also nicht, wie wir es mittlerweile gewohnt sind, eine Frau einen Mann und andersrum, sondern die Figuren ändern ihre Identität. Nicht die Darsteller*innen wechseln das Geschlecht, sondern die Rollen. Somit wird auch aus dem antisemitischen Mann eine antisemitische Frau und aus dessen weiblichem Opfer ein leidender Mann. Ist das die Perspektive der weiblichen Titelfigur? Irgendwie stellt sich das Gefühl ein, dass die Regisseurin Tschechow nicht verstanden hat. Und so ergeben sich aus der mechanischen Umkehrung der Geschlechterzuschreibungen allerlei Ungereimtheiten, jedenfalls wenn das Stück noch irgendetwas mit der sozialen Realität von Russland im 19. Jahrhundert oder auch nur der patriarchalischen Gesellschaft zu tun haben soll. Dabei legt Bergmann offenbar Wert auf die Lokalisierung in Russland. Ehe das eigentliche Stück beginnt, lässt sie die Schauspieler*innen in einer ausführlichen Ouvertüre zu Strawinskis Sacre du printemps, zum Schlager Moskauer Nächte und zu nervigem Sounddesign russisch sprechen.
Und was hat es eigentlich mit der Perspektive auf sich? Von wo aus schaut Anna Iwanowa auf das Geschehen? Schaut sie auch auf sich selbst? Mehr noch: ist „Perspektive“ für die dramatische Literatur, in der es, anders als in der Epik, normalerweise keinen Erzähler und keine Erzählerin gibt, eine geeignete Kategorie?
Anna Bergmann deklariert im Programmheft: „Frauen haben viel mehr Gründe als Männer, lebensmüde zu werden, an der Gemeinschaft und am Sinn des Lebens zu zweifeln. Frauen sind oft reflektierter, erkennen die Ursache für ihr Unglück und können vielleicht trotzdem nichts daran ändern.“ Manche würden sich darüber wundern, wie eilfertig Bergmann hier Sex und Gender, natürliches und soziales Geschlecht durcheinander wirbelt. Aber wenn man sie beim Wort nimmt, muss man doch zurückfragen: Wenn Frauen sich auf diese Weise von Männern unterscheiden, wenn sie reflektierter sind als Männer – reden und handeln sie dann nicht auch anders als Männer? Und wenn das der Fall ist – ist es dann nicht Unsinn, ihnen die Worte von Männern in den Mund zu legen, ihnen deren Handlungsweisen zuzuschreiben? Kurz: ist nicht Anna Bergmanns Konzept für Anna Iwanowa eine Fehlkonstruktion?
Offenbar nicht aus der Perspektive einer feministischen Regisseurin. Sie sieht von ihrem Standpunkt aus nur, was sie sehen will. Der Rest ist Blindheit.
|
Thomas Rothschild - 30. Oktober 2022
2754
|
 Libretti der Dummheit
Libretti der Dummheit
|
In Mannheim hat der gefeierte belgische Regisseur Luk Perceval unter Zuhilfenahme von Texten der türkischen Schriftstellerin Aslı Erdoğan, die eigentlich damit nichts zu tun haben, Mozarts Entführung aus dem Serail ein neues Libretto verpasst. Das Gebräu aus Reinigungsfuror gegenüber vermeintlich schmutzigen Inhalten und Formulierungen, Aufmerksamkeit herausfordernder Originalitätssucht und Misstrauen gegenüber bewährten Überlieferungen schlägt zurzeit auf Deutschlands Bühnen Purzelbäume, die das kritische Publikum zwischen Verwunderung, Ärger und Verzweiflung hin und her reißen. Wer aufbegehrt, wird mit dem Vorwurf des Konservatismus zum Schweigen gebracht. Nun soll gar nicht geleugnet werden, dass es Zuschauer*innen gibt, die unempfänglich sind für alles Neue und stur darauf beharren, dass alles so bleibe, wie sie es gewohnt sind. Das freilich erhebt noch nicht jede Innovation in den Status der Genialität. Texteingriffe, Überschreibungen, Einfügungen von mehr oder weniger langen Zitaten sind für sich genommen weder unstatthaft, noch fortschrittlich. Aber ihre Schöpfe*innen – sprechen wir es aus – sind, wie alle Menschen, auch jenseits des Theaters, mal klüger und mal dümmer, manchmal sogar sehr dumm. Ist es also intelligent oder, na, sagen wir: oberflächlich, wenn man aus der Entführung mit dem Bassa Selim auch gleich den Orient, wie man ihn zu Mozarts Zeiten abgebildet hat, entfernt? Werden wir damit dazu erzogen, unsere türkischen Nachbarn mit dem ihnen gebührenden Respekt zu behandeln und nicht nur als Importeure von Döner?
Wir haben, auch ohne Perceval und Erdoğan, begriffen, dass Mozarts Türkei einem Klischee seiner Zeit, nicht der Wirklichkeit entsprach, wie die Götter in den antiken Dramen einen Glauben ihrer Zeit, nicht mehr und nicht weniger, widerspiegeln. Es ist so falsch und so richtig wie das Klischee von der männerverzehrenden „Zigeunerin“ Carmen oder vom heldenmütigen Germanen, der in Gestalt von Siegfried unbeanstandet über die Opernbühnen geistert. Fragt sich, ob wir darüber bei jeder heutigen Inszenierung belehrt werden müssen, oder ob uns nicht zugemutet werden kann, was jedes Kleinkind versteht: dass die Hexe nicht wirklich in einem Lebkuchenhaus wohnt und der Wolf die Großmutter nicht unverdaut im Bauch aufbewahrt, kurz: dass Literatur, Libretti inklusive, ihre eigenen Regeln hat und kein direkter Weg von der Fiktion zum alltäglichen Bewerten und Handeln führt. Man sollte Naivität nicht mit Moral verwechseln.
|
Thomas Rothschild - 29. Juli 2022
2749
|
 Ingolstadt ist überall
Ingolstadt ist überall
|
Die dpa meldet unter der Überschrift Ingolstädter stimmen gegen neues Theater:
"Bei einem Bürgerentscheid haben sich die Ingolstädter am Sonntag gegen den Bau eines neuen Theaters entschieden. Wie die Stadt mitteilte, stimmten bei dem Bürgerentscheid 39,8 Prozent für das Projekt und 60,2 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 25,6 Prozent, es waren rund 100.000 Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen.
Die Stadt wollte neben dem bisherigen Stadttheater ein 'Kleines Haus' bauen, um dann bei der anstehenden Sanierung der Hauptbühne einen Ausweich-Spielort zu haben. Bislang waren 45 Millionen Euro dafür vorgesehen.
In einem zweiten Bürgerentscheid ging es um den Bau einer neuen Mittelschule für rund 580 Schüler. Bei der Frage 'Sind Sie dafür, dass die neue Mittelschule Nord-Ost südlich des Augrabens gebaut wird?' stimmten 49,6 Prozent mit Ja und 50,4 Prozent mit Nein.
(...)
Gegner beider Projekte kritisieren insbesondere, dass Grünflächen bebaut werden sollen. Bei dem geplanten Kammertheater wird zudem bemängelt, dass durch das Bauwerk die Luftzirkulation im Bereich der nahen Donau gestört und dadurch das Klima der Innenstadt verschlechtert werde."
Die Ökologisten bekennen Farbe. Keine Theater, keine Schulen. Grünflächen haben Priorität. Die Grünen auf der linken Seite des politischen Spektrums? Das Gerücht ist ebenso hartnäckig wie falsch und dient einzig und allein der propagandistischen Lüge, dass die Repräsentation in den Parlamenten ausgewogen sei. Wenn die Sorge um Kultur und Bildung unverzichtbarer Teil einer linken Politik ist, dann stehen AfD, CDU/CSU, FDP, große Teile der SPD und, wie man an dem aktuellen Fall einmal mehr sieht, die Grünen rechts von der Mitte.
Man gebe sich keinen Illusionen hin. Ingolstadt ist überall. |
Thomas Rothschild - 24. Juli 2022
2748
|
 Pirandello und die Experten der Wirklichkeit
Pirandello und die Experten der Wirklichkeit
|
Er ist noch nicht ganz von den deutschen Spielplänen verschwunden, aber Inszenierungen seiner Stücke sind rar geworden: einer der bühnenwirksamsten und geistreichsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, Luigi Pirandello. An seinem Flirt mit Mussolini kann das nicht liegen. Anderen, auf und hinter der Bühne, hat man ihre mehr oder weniger ausgeprägte Neigung zu den Faschismen unterschiedlicher nationaler Färbung längst verziehen, wenn man sie überhaupt je als Makel empfand. Die Ursache für das Abhandenkommen Pirandellos dürfte anderswo liegen, im Bereich der Theatergeschichte eher als dem der politischen Geschichte: Er steht im diametralen Gegensatz zu den meist freien Gruppen, die heute den Ton angeben. Sie beschwören das Tatsächliche, die Expertise der Wirklichkeit, und misstrauen der Fiktion, dem Artifiziellen, all dem, was Kunst von der Tagesschau unterscheidet.
Weil diese Gegenwartsapologeten so nah wie nur möglich am Alltag sein wollen, geben sie vor, genau zu wissen, was der Fall ist. Ihre Sprache ist beherrscht vom Indikativ, von der apodiktischen Behauptung, von der Klugscheißerei. Zweifel sind ihnen zuwider. Von Brechts Dialektik des Lobs sowohl des Lernens wie des Zweifels ist bei ihnen, den Engstirnigen, nur die eine Seite hängen geblieben, das „Fang an! Du mußt alles wissen!/ Du mußt die Führung übernehmen“. Pirandello aber ist, genau anders rum, ein Experte der Ungewissheit. Seine Domäne ist die Mehrdeutigkeit. Nichts ist sicher in seinen Dramen, nicht die Identität der Figuren, nicht die Wahrheit ihrer Aussagen, nicht die Zuverlässigkeit der Wahrnehmung, weder auf der Bühne noch davor. Nichts ist, was es scheint. Così è (se vi pare).
Pirandello steht zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht allein da mit seiner Skepsis. Man findet sie auch, wenngleich in anderer dramatischer Form und mit anderen ideologischen Implikationen, etwa bei Arthur Schnitzler. In welcher literarischer Gestalt aber auch immer: ist die Skepsis nicht die modernere, die den heutigen Gegebenheiten angemessenere Haltung im Vergleich zum selbstbewussten, irritationsfreien Dogma? Haben wir nicht mehr denn je Grund zu der Vermutung, dass die Dinge und die Menschen nicht sind, was sie zu sein vorgeben? „Fake“ ist das Wort der Stunde. Wer wäre sein Dramatiker, wenn nicht Pirandello?
|
Thomas Rothschild - 16. August 2021
2734
|
 Der schlechte Ton
Der schlechte Ton
|
Vor ein paar Wochen titelte der Wiener Standard: „Wie wichtig ist uns Theater?“ Sie erraten es: die Frage ist rhetorisch. Dem Verfasser der Antwort ist Theater sehr wichtig. Kein Wunder. Er ist dem Theater nicht nur als Zuschauer, sondern auch als gut honorierter Mitarbeiter verbunden. Er sagt „uns“ und meint „mir“. Er meint sich selbst, aber er versteckt sich hinter einem Plural.
Zufällig gehöre ich zu dem Kollektiv, für das zu sprechen er vorgibt. Mir ist Theater wichtig. Deshalb lese ich Publikationen und Websites, die sich mit Theater beschäftigen, und weder Sportzeitschriften noch Klatschblätter. Und so stoße ich naturgemäß auf unzählige Klagen darüber, wie sehr das dem Coronavirus zum Opfer gefallene Theater fehlt. Was mich allerdings von dem Autor unterscheidet, der verkündet, was „uns“ wichtig ist, ist das Bewusstsein, dass ich mit meinen Vorlieben zu einer unmaßgeblichen Minderheit gehöre. Mir ist klar, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, denen Fußball, Gummibärchen, Stundenhotels und vielleicht sogar Gottesdienste wichtig sind, und ich weiß, dass uns der Standard beredt von dieser Wichtigkeit überzeugen könnte, wenn ein Pfarrer oder ein Zuhälter anstelle eines Theaterliebhabers den Artikel geschrieben hätte.
Mehr noch: Es ist ein Vielfaches an Menschen, denen eine warme Mahlzeit am Tag, der Schutz vor Kriegen und Terror, genügend Medikamente gegen Seuchen und Krankheiten wichtiger sind als das Theater. Wir, die wir zu den Privilegierten gehören, die jammern dürfen, wenn die Bühnen ein paar Monate zusperren müssen, sollten uns in der realistischen Einschätzung der Dimensionen von Unglück und in Bescheidenheit üben. Wir werden Sympathie und Unterstützung von der Mehrheit der Bevölkerung, die sich unter anderem in den Kommentaren zum erwähnten Standard-Lamento Luft machte, nur gewinnen können, wenn wir uns selbst weniger wichtig nehmen und unsere partikulären Interessen nicht als allgemeine ausgeben.
Heute habe ich den Medien entnommen, was den Menschen über das Theaterpublikum hinaus tatsächlich wichtig ist und sie zu massenhaften Reaktionen provoziert: der Ton bei der Fernsehübertragung eines EM-Spiels. Es soll uns eine Lehre sein. Jedenfalls mir.
|
Thomas Rothschild - 12. Juni 2021 (2)
2730
|
 Wofür man Verständnis zeigt
Wofür man Verständnis zeigt
|
Der österreichische Schriftsteller Doron Rabinovici hat kürzlich erklärt: „Ohne Burgtheater wäre es finster um uns.“ Ob sich der Mitarbeiter der derart gepriesenen Institution nicht als befangen betrachten müsste, ist wohl Geschmackssache. In Österreich ist man da nicht zimperlich. In der Sache allerdings wäre eine Gedächtnisauffrischung hilfreich. Denn das Burgtheater hat eine längere Geschichte. In den Nachkriegsjahren vor Peymann und Benning war das Burgtheater ein Ort standesbewusster Dünkel, einer antiaufklärerischen Klassikerpflege und eines drögen Deklamationstheaters, das allenfalls von der Pariser Comédie-Française an Verstaubtheit übertroffen wurde. Es war über Jahrzehnte hinweg ein Ort der Sinnlichkeitsverweigerung und der Intellektfeindlichkeit, das sich zum Theater etwa eines Jan Grossman im benachbarten Prag verhielt wie Eugen Roth zu Allen Ginsberg. Wenn es irgendwo in Wien finster war, dann in dem nach den Beschädigungen durch den Krieg wiedereröffneten Kulturpalast am Ring. Es war in jenen Jahren vor allem Conny Hannes Meyer, der den durch maßgebliche Kritiker von den Bühnen ferngehaltenen Brecht studiert und mit seinen „Komödianten“ auf diese Hochburg des Bildungshochmuts reagiert hat.
Die Heroen der Stunde waren damals neben dem omnipräsenten Ewald Balser Werner Krauß, Rosa Albach-Retty, Paula Wessely, Paul und Attila Hörbiger, Fred Hennings, Viktor de Kowa. Für deren von Hitler und Goebbels gelobte und dekorierte Beiträge zur nationalsozialistischen Propaganda hat man nach 1945 auffallend mehr Nachsicht gezeigt hat als heute für die angeblichen oder tatsächlichen sexuellen Entgleisungen eines Klaus Dörr.
Es ist schon bemerkenswert, mit welchem Verständnis man Theaterleuten und anderen Künstlern begegnet, die sich dem Nationalsozialismus, nicht nur in Österreich, bereitwillig zur Verfügung gestellt haben, die ohne Widerspruch zusahen, als ihre jüdischen Kolleginnen und Kollegen entlassen, ins Exil gejagt oder ermordet wurden, und wie streng geurteilt wird, wenn jemand eines Vergehens verdächtigt wird, das mit Sexualität zu tun hat. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht etwa Gewalt, sondern „sexuelle Gewalt“ verteufelt wird. Wer sein Kind halb zu Tode prügelt, kann sich auf erzieherische Maßnahmen berufen. „Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten.“ Wer ihm aufs Geschlecht greift, muss mit der Hölle rechnen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: jede und jeder ist vor Gewalt, also auch vor sexueller Gewalt zu schützen. Kurios ist bloß, wie effizient die Gewalt verdrängt wurde, denen jene ausgesetzt waren, zu deren Ausgrenzung und Vernichtung Filme und Theaterstücke aufriefen, an denen Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligt waren, darunter auch viele aus dem Burgtheater, ohne das es angeblich drumherum finster wäre.
Ein Klaus Dörr aber ist über Nacht zur Unperson geworden. Kann jemand sagen, wo er abgeblieben ist? Es gibt ihn nicht, und es darf ihn nie gegeben haben. So gnädig wie mit Werner Krauß oder Paula Wessely, die auf Hitlers Gottbegnadeten-Liste standen, wird mit ihm nicht umgegangen. Damit die Maßstäbe gewahrt bleiben. Innerhalb des Burgtheaters und in der umgebenden Finsternis.
|
Thomas Rothschild - 19. Mai 2021
2726
|
 Mal andersrum
Mal andersrum
|
Die Häufung von alarmierenden Vorgängen haben das Thema der Willkür an den Theatern aufs Tapet gebracht. Schaupieler*innen, Regisseur*innen, Dramaturg*innen beklagen sich, spät aber doch, weil sich niemand für sie einsetzt, wenn ihre Verträge nicht verlängert werden und sie sich über Nacht ohne Engagements finden. Sie fühlen sich im Stich gelassen, mit gutem Grund, vom Publikum, von der Politik und insbesondere von jenen, die für die Herstellung von Öffentlichkeit zuständig sind: von den Medien.
Machtmissbrauch ist, wie der Fall Shermin Langhoff jüngst exemplarisch belegt hat, kein Privileg alter weißer Männer, und er ist nicht auf die Institution Theater beschränkt. Er ist überall dort anzutreffen, wo Abhängigkeiten bestehen: an den Schulen und Hochschulen, in den Redaktionen, an den Arbeitsplätzen. Wo Macht in den Händen Einzelner geballt ist, wird sie auch – nicht immer, aber gelegentlich – missbraucht. Und das beginnt nicht erst mit sexueller Belästigung.
Im Zuge der ökonomischen Probleme haben die Zeitungen und Rundfunkanstalten ihre so genannten „freien Mitarbeiter“ abgebaut. Da sie nie fest angestellt waren, braucht man ihnen nicht zu kündigen. Es gibt da nichts zu verlängern. Sie bekommen einfach keine Aufträge mehr. Und niemand fragt danach, wo sie abgeblieben sind, jene Kritiker und Berichterstatter, deren Beiträge man gestern noch regelmäßig lesen oder hören konnte, deren Namen man kannte. Alle gestorben? Oder von sich aus gegangen?
Nach und nach sind sie verschwunden, spurlos und unkommentiert. Ein Fall von vielen: Als die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, später auch noch die traditionsreiche Esslinger Zeitung de facto fusioniert wurden, um seither nur noch zum Schein als eigenständige Printmedien zu überdauern, wurden sukzessive die Mitarbeiter eingespart, die zuvor aus Theater, Oper und Pop berichtet hatten. Früher haben, beispielsweise, sechs bis acht Mitarbeiter der Tageszeitungen im Stuttgarter Raum über Tanz und Ballett geschrieben. Heute hat sich die Redakteurin das Monopol gesichert und muss nur noch mit ihren Redaktionskolleg*innen, von denen einige so ehrgeizig wie sie und andere zu ihrem Glück faul sind, um den knappen Platz wetteifern. Ermutigt wird sie von einer Chefredaktion, die die fest Angestellten auffordert, selbst mehr zu schreiben und keine (zu honorierenden) Aufträge zu erteilen. Schon zuvor war die Zeitschrift der Kulturgemeinschaft, der Stuttgarter Besucherorganisation in der Tradition der Volksbühnen, mit ihren ausführlichen Besprechungen und Essays zu einem Ankündigungsorgan reduziert worden.
Und die Theater? Sie schweigen vernehmlich. Ein Protest, auch nur eine Nachfrage nach den verschwundenen Kritikern bleibt aus. Nicht zuletzt, weil man es sich, Machtmissbrauch hin oder her, nicht mit jenen verderben will, die geblieben sind. Sie haben schließlich eine, wenn auch begrenzte, Macht über jene, die sie kritisieren oder auch ignorieren. Die Mächtigen machen es unter sich aus.
Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn die Theaterleute hinnehmen, dass die freien Mitarbeiter in die Wüste geschickt werden, wenn sie gegenüber dem Machtmissbrauch in den Medien keinen unüberhörbaren Widerstand leisten, werden ihnen jene abhanden kommen, die sich für ihre Agenda stark machen und nicht nur für populistische Bestätigung des ohnehin Gängigen und gedankenlose Homestorys. Wir sitzen im gleichen Boot.
|
Thomas Rothschild - 9. Mai 2021
2725
|
 Richards Erben
Richards Erben
|
Der größte Schurke der Weltliteratur dürfte wohl Richard III. sein. Er scheut keine Verbrechen, um sein Ziel zu erreichen: König von England zu werden. Aber er ist auch ein Meister der Heuchelei. Um seinen innigsten Wunsch nicht aussprechen zu müssen, lässt er den Herzog von Buckingham den Bürgermeister von London und „das Volk“ dazu verführen, dass sie ihm den Königsthron aufdrängen. Mit der Bibel in der Hand – dem Inbegriff des Pharisäertums – erwidert er auf deren Bitten (in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel):
„Dankwert ist Eure Liebe; doch mein Wert,
Verdienstlos, scheut Eu'r allzuhoch Begehren.
Erst, wäre jede Hind'rung weggeräumt
Und wär' geebnet meine Bahn zum Thron,
Als heimgefallnem Rechte der Geburt:
Dennoch, so groß ist meine Geistesarmut,
So mächtig und so vielfach meine Mängel,
Dass ich mich eh' verbürge vor der Hoheit,
Als Kahn, der keine mächt'ge See verträgt,
Eh' ich von meiner Hoheit mich verbergen,
Von meines Ruhmes Dampf ersticken ließe.
Doch, Gott sei Dank! es tut nicht not um mich;
Und wär's, tät' vieles not mir, Euch zu helfen.
Der königliche Baum ließ Frucht uns nach,
Die, durch der Zeiten leisen Gang gereift,
Wohl zieren wird den Sitz der Majestät,
Und des Regierung uns gewiss beglückt.
Auf ihn leg' ich, was Ihr mir auferlegt,
Das Recht und Erbteil seiner guten Sterne,
Was Gott verhüte, dass ich's ihm entrisse.
(...)
Ach, warum diese Sorgen auf mich laden?
Ich tauge nicht für Rang und Majestät.
Ich bitt' euch, legt es mir nicht übel aus:
Ich kann und will euch nicht willfährig sein.“
Es gilt als abgemacht, dass Shakespeare von den Freiheiten der Literatur Gebrauch gemacht und sich Übertreibungen geleistet habe, die von der Wirklichkeit nicht eingeholt werden könnten. Ist das so?
Man sehe sich unsere Zeitgenossen an, die nach Herrschaft streben. Von Trump bis Putin, von Lukaschenka bis Orbán: sie machen sich gar nicht erst die Mühe, sich bitten zu lassen und so zu tun, als seien sie für das höchste Amt unfähig oder unwürdig. Sie nominieren sich ohne Wenn und Aber selbst und krönen sich mit den modernen Insignien der Macht. Sogar auf den Posten eines Wirtschaftsministers will ein Friedrich Merz nicht warten, bis ihn jemand dafür vorschlägt. Er bringt sich unverblümt selbst ins Gespräch. Und damit sie freie Hand haben, sorgen die potentiellen Autokraten mit Immunisierungen und maßgeschneiderte Gesetzen dafür, dass ihnen, sollte mit ihrer Herrschaft etwas schief gehen, für ihre Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Eben erst hat uns Nicolas Sarkozy vorgemacht, wie man im schlimmsten Fall Hausarrest bekommt, das Homeoffice, das von uns normal Sterblichen zurzeit erwartet wird, auch wenn wir uns nichts zuschulden haben kommen lassen.
Da kann man Richard III. fast ins Herz schließen dafür, dass er sich wenigstens die Mühe macht, sich zu verstellen. Gemessen an der selbstherrlichen Schamlosigkeit heutiger Aufsteiger kann man ihm fast Anstand attestieren. Na ja. Ein Schurke ist er trotzdem. Und wie soll man jene nennen, die aus ihren Ambitionen keine Mördergrube machen? Literatur und Leben: ein immer wieder lehrreiches Kapitel.
|
Thomas Rothschild – 4. März 2021
2717
|
 Das Wunder Digitalisierung
Das Wunder Digitalisierung
|
Das Zauberwort heißt „Digitalisierung“. Wer es beschwört, wähnt sich an der Speerspitze des Fortschritts. Jede technische Erfindung ruft die Gläubigen auf den Plan. Ob sie von Nutzen ist, ob sie den Segen der Menschheit befördert, oder ob sie lediglich den Umsatz steigern soll oder gar schädlich ist, wird nicht gefragt. Hauptsache: dabei sein bei der Verbreitung und Durchsetzung und sich möglichst einen öffentlichkeitswirksamen oder einkommensträchtigen Platz sichern. Um nicht missverstanden zu werden: dies ist kein technikfeindliches Plädoyer. Unzählige Erfindungen, von der Eisenbahn bis zur Computertomographie, haben das Leben der Menschen verbessert und erleichtert. Aber das lässt sich nicht verallgemeinern. Es lassen sich jede Menge technischer Neuerungen nennen, die zumindest ambivalent sind oder, im schlimmsten Fall, die Menschen bedrohen. Eine differenzierte Sichtweise freilich verbietet sich jenen, die sich wichtig machen, indem sie als Propheten einer neuen Technik auftreten.
Die Digitalisierung leistet in erster Linie Beschleunigung. Sie setzt fort, was das analoge Fernsehen mit Direktübertragungen in seinen jungen Jahren begonnen hat. Sie beschleunigt und vereinfacht die Verbreitung von Informationen verschiedener Art, von Zahlen, Texten, Bildern. Aber es bedurfte nicht der Digitalisierung, um Börsenkurse an Spekulanten, Wettervorhersagen an Kapitäne oder Selfies (die bloß anders hießen) an die Freunde weiter zu geben. Sie hat den Vorgang bloß weniger aufwendig und für jeden (technischen) Idioten bewältigbar gemacht. Der Fortschritt, den sie gewährt, gleicht dem Fortschritt beim Übergang von der Feder zur Schreibmaschine, von der Filmkamera auf dem Stativ zur Handkamera oder vom Durchschlagpapier zum Fotokopierer.
Zu den Argumenten der Digitalisierungsbefürworter gehört die Behauptung, sie würde die zwei- oder mehrkanalige Kommunikation befördern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man früher eine schriftliche Anfrage an eine Behörde oder einen Dienstleister stellte, bekam man im schlimmsten Fall keine Antwort. Heute erhält man in der Regel eine Antwort. Aber sie ist mit einem Tastendruck auf den Computer generiert, vorgefertigt und außerstande, auf die eigentliche Frage einzugehen. Häufig entsteht der Eindruck, dass die Frage gar nicht erst gelesen wurde, sondern ein Stichwort beim Überfliegen zur Wahl der Taste geführt hat. Von Kommunikation keine Spur.
Und wie ist das im speziellen Fall des Theaters? Dort wird der Begriff der „Digitalisierung“ sekundiert durch ein zweites Zauberwort, durch „Streaming“. Es gibt Medien, die für die Leinwand oder den Bildschirm konzipiert sind, nämlich Film und Video. Wenn sich Theater von diesen Medien nicht unterschiede, wäre es überflüssig. Streaming verhält sich sowohl zum lebendigen Theater wie zum Film wie Telefonsex zu lebendigem Sex. Es ist bestenfalls Ersatz. Und wie wirkt sich das auf die angebliche Demokratisierung der Kommunikation aus? Auf einen Stream können Zuschauer, wenn das so eingerichtet wurde, mit Mails oder mit Chatbeiträgen reagieren. Die aber bekommen die eigentlichen Akteure, die Schauspieler, wenn überhaupt, erst im Nachhinein zu sehen. Was einen großen Teil des traditionellen Theatervergnügens ausmacht und es vom Kinobesuch unterscheidet, ist die Spontaneität, mit der die Menschen auf der Bühne auf die Reaktionen der Menschen im Zuschauerraum ihrerseits reagieren können. Von Theaterleuten hört man immer wieder, wie sehr sie, bewusst oder unbewusst, auf leise oder laute Äußerungen aus dem Publikum reagieren. Genau das ist der Grund, weshalb sich eine Inszenierung von Aufführung zu Aufführung unterscheidet.
Die Digitalisierung hat für das Theater die gleiche Bedeutung, die die Erfindung der Drehbühne oder des Mikroports hatte. Ob, was sie an Neuem hervorgebracht haben, die Qualität und die Langlebigkeit von Hamlet, Drei Schwestern oder Warten auf Godot hat, muss erst noch bewiesen werden.
Im Übrigen kann ein Rückblick den Skeptikern der Digitalisierung Mut machen. Just zu einem Zeitpunkt, da die CD dem Streaming das Feld räumt, erlebt die Vinylschallplatte eine Renaissance. Die Zwänge, die uns die gegenwärtige Krise auferlegt, haben den Digitalisierungs-Fans scheinbar Auftrieb gegeben, aber ihren Ansprechpartnern oder vielmehr Mailadressaten auch die Augen geöffnet. Es stellt sich die Frage: Wenn man das potentielle Publikum ans Streaming gewöhnt – was sollte es künftig noch ins Theater locken? Nicht erst das Virus gefährdet eine Kulturtechnik, die ihre Mängel, aber auch ihre Verdienste hat. Ich imaginiere eine Zukunft, in der die Menschen daheim vor ihren Bildschirmen sitzen und ein paar Verrückte klandestine Theateraufführungen von Geheimgesellschaften besuchen. Dort treffen sich dann Peter Stein und Rimini Protokoll wie die Opiumraucher mit den Transvestiten. Brave New World.
|
Thomas Rothschild - 10. Dezember 2020
2708
|
 Geduldete Kriminalität
Geduldete Kriminalität
|
Meldungen des Tages, als Ergänzung zu den Reflexionen über Rache und Gerechtigkeit im Besuch der alten Dame:
Die Milliardärin Claire Zachanassian will sich Gerechtigkeit kaufen und dringt auf Rache. Die Milliardäre in Politik und Wirtschaft kaufen sich nicht Gerechtigkeit, sondern, im Gegenteil, den Verzicht auf Gerechtigkeit.
Donald Trump verhindert die Überprüfung von Unterlagen, die den Verdacht der massiven Steuerhinterziehung bestätigen könnten, und bleibt trotzdem Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Lufthansa missachtet kontinuierlich Gesetze, wonach sie Kunden die Erstattung von Zahlungen für annullierte Flüge anzubieten habe, und darf dennoch nicht nur weiter fliegen, sondern erhält sogar monströse Summen vom Staat, also aus den Steuern auch der geprellten Fluggäste. Die Betrüger werden von den Betrogenen bezahlt.
Die Kriminalität wird geduldet, wenn sie nur in hinreichend großem Maßstab stattfindet. Was man keinem Schwarzfahrer und keinem Ladendieb durchgehen ließe, wird von den Mächtigen in Politik und Wirtschaft mit einer Selbstverständlichkeit in Anspruch genommen, die sprachlos macht. Wer wollte es angesichts solcher Dreistigkeit verübeln, wenn die so genannten „einfachen“ Menschen an dem herrschenden Rechtssystem, an der Gerechtigkeit des Staats und der zuständigen Behörden verzweifeln? Die Kaltschnäuzigkeit der Trumps, der Lufthansas und all der Personen, Konzerne, Institutionen, die deren Beispiel folgen, ist schwer zu ertragen. Die Deutsche Bahn darf im Zusammenhang mit Stuttgart 21 die Kostenvoranschläge zu Lasten des Steuerzahlers gravierend überziehen, ohne dass das jene Folgen hätte, die jeder Bürger für eine Vertragsverletzung zu tragen hat. Das sähe anders aus, wenn die Verantwortlichen für jeden Euro, den sie zusätzlich verlangen, persönlich haftbar gemacht, für Vertragsverletzungen gerichtlich belangt würden wie ein Mieter, der seine Miete nicht bezahlt. Dass die Kostensteigerungen bei Stuttgart 21 oder beim Berliner Flughafen lediglich eine Folge der Unmöglichkeit seien, die Kosten genau zu berechnen, wäre erst dann glaubwürdig, wenn sie im Schnitt ebenso oft und um ebenso große Beträge zu gering angesetzt würde, wenn also statistisch unter der Summe der Mehrkosten und der Einsparungen eine Null stünde. Wenn das nicht der Fall ist, muss von kriminellen Falschangaben bei Angeboten ausgegangen werden.
Auch Donald Trump steht in einer respektablen Riege. Gegen Frankreichs ehemaligen Präsidenten Sarkozy wurde ermittelt, der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi stand unter teilweisem Hausarrest und musste nach einem Gerichtsbeschluss Sozialarbeit leisten, zahlreiche deutsche Politiker standen unter Verdacht, gegen Gesetze verstoßen zu haben. Ihre Karriere hat es allenfalls um ein paar Monate verzögert.
Man sollte sich nicht wundern, wenn jene, die sich die Gesetzesmissachtung der Politiker und der Konzerne nicht risikolos leisten können, zu Mitteln der Selbstjustiz greifen. Anders ausgedrückt: es sind Trump und die Lufthansa, die, stellvertretend für andere Profiteure des Systems, Schuld tragen an Randalen in Innenstädten. Die spiegeln lediglich im kleinen Maßstab die Verhaltensweisen, die ihnen die Großkriminellen vorgemacht haben, die Missachtung der Gesetze, die Verhöhnung der Gemeinschaft, die begründete Spekulation, dass man ungeschoren davon kommt. Wobei die Schaufensterzertrümmerer weitaus geringere Chancen haben als Trump und die Lufthansa. Kriminalität wird verurteilt und verfolgt. Es sei denn, sie ist groß genug.
|
Thomas Rothschild - 28. September 2020
2699
|
 Demut
Demut
|
Hermann Beil schrieb vor ein paar Jahren die folgenden Sätze:
„Es ist schon kurios, wenn unmittelbar nach der Premiere auf der Perner-Insel eine Zuschauerin vor der Fernsehkamera ‚etwas weniger Werktreue‘ einfordert. Seien wir doch ehrlich: Wer hat ‚Ödipus auf Kolonos‘ schon gesehen oder gar mehr als einmal gesehen? Jener Dame (nicht nur jener Dame!) würde ich gerne mit Arthur Schnitzler zurufen: ‚Des Kritikers erste Frage müsste sein: Was hast du mir zu sagen, Werk – ? Aber seine erste Regung ist vielmehr: Nun, Werk, gib acht, was ich dir zu sagen habe!‘ Den Begriff ‚Werk‘ möchte ich hier mit dem Begriff Aufführung gleichsetzen.“
Hermann Beil? Richtig: der unvergessene dramaturgische Partner Claus Peymanns über Jahrzehnte hinweg. Ihm haben wir einige der großen Abende des so genannten Regietheaters mit zu verdanken. Und ausgerechnet er plädiert für Werktreue?
Wir wollen hier nicht die sich im Kreis drehende, längst redundante Diskussion über den angeblichen Gegensatz von Texttreue und Regietheater erneut aufgreifen. Ein Theater ohne Regie gibt es ebenso wenig wie unrelativierte Texttreue. Es genügt, an die Thomas-Bernhard-Inszenierungen Peymanns zu erinnern, die Beil dramaturgisch überwacht hat: Sie waren allesamt hervorragende Exemplare des Regietheaters wie der Werktreue zugleich. Aber es fällt schon auf, dass einige älter gewordene Theatermacher, allen voran Peter Stein, aber eben auch Peymann und Beil, die einst eigenwillig und oft auch kritisch mit Vorlagen umgingen, sich heute sehr skrupulös an Schnitzlers Mahnung halten, das Werk zu befragen, was es ihnen zu sagen habe. Wenn wir die Dame, die Hermann Beil belauscht hat, freundlich interpretieren, dann meinte sie ja wohl, sie hätte sich von Peter Stein mehr Einfälle beim Umgang mit Sophokles gewünscht. Dass er, anders als in seiner Jugend, solche Einfälle zugunsten einer genauen Lektüre des Textes zurückgesteckt hat, kann man, wie die Dame, bedauern, oder, wie Beil, begrüßen.
Woran aber liegt es, dass Regisseure, wenn sie alt werden, die beschriebene Richtung einschlagen? Ein bedeutender Regisseur, der den umgekehrten Weg gegangen wäre, wird einem nicht leicht in den Sinn kommen. Die simple Erklärung, dass man im Alter konservativ werde, ist zu kurz gegriffen. Erstens ist etwa Peymann in seinen politischen Ansichten wohl weniger konservativ als die meisten seiner jüngeren Kollegen. Und zweitens ist nicht ausgemacht, dass ein Theater der krampfhaften Originalität progressiver ist als ein Theater, das sich eng an den Text hält.
Vielleicht muss man zur Erklärung ein Wort bemühen, das selbst den Ruch des Konservativen, ja des Unzeitgemäßen hat: Demut. Was Peter Stein und Claus Peymann und Hermann Beil und ein paar andere ihrer Generation auszeichnet, ist eine Demut vor dem Autor und seinem Werk, die junge Menschen nicht kennen. Es ist ihr Privileg, aufmüpfig zu sein, wie es Stein und Peymann in ihrer Jugend waren, mitsamt der Ungerechtigkeit, die solche Aufmüpfigkeit gelegentlich einschließt. Und wahrscheinlich bedarf es einer größeren künstlerischen wie Lebenserfahrung, um vor den Dramen eines Sophokles (zum Beispiel) in einer Weise zu erschaudern, die einen dazu motiviert, ihnen dienen zu wollen. In Demut. Ohne Profilneurose. Und ohne Rechthaberei gegenüber den Jungen. Denn deren Aufmüpfigkeit ist ein notwendiges Korrektiv, wenn die Demut zur Kleinmütigkeit zu regredieren droht.
|
Thomas Rothschild - 13. August 2020
2694
|
 Selbstanpreisung und Ökonomie
Selbstanpreisung und Ökonomie
|
Die Erinnerung an sie ist nicht verblasst. Es gab sie – die Intendant*innen, die maßgeblich zum Ruhm des deutschsprachigen Theaters beigetragen haben. Ihr anhaltendes Renommee beruht auf den künstlerischen Errungenschaften, die sie – inszenierend und/oder verwaltend – zu verantworten hatten, auf ihrer Begabung, überragende Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Bühnenbildner*innen, Kostümbildner*innen, auch Autor*innen zu entdecken und zu fördern. Man denke an Namen wie Max Reinhardt, Wolfgang Langhoff, Manfred Wekwerth, Hans Schalla, Kurt Hübner, Oscar Fritz Schuh, Boy Gobert, Peter Palitzsch, Albert Hetterle, Hansgünther Heyme, Hans Lietzau, Frank Baumbauer, Dieter Dorn, Roberto Ciulli, Jürgen Flimm, Franz-Patrick Steckel, Wolfgang Engel, Frank Castorf, Karin Beier, Barbara Frey.
Das hat sich geändert. Die künstlerisch ambitionierten Intendant*innen wurden von einem neuen Typus abgelöst: dem marktschreierischen PR-Agenten, dem von keiner falschen Bescheidenheit gebremsten Selbstdarsteller, dem Buchhalter beiderlei Geschlechts. Ohne jede Hemmung preisen sich die Theaterleiter*innen selbst an oder lassen sich von ihren Pressereferent*innen, die von Kulturmanagement einiges, von Theater jedoch kaum etwas verstehen, anpreisen. Sie protzen mit Lobeshymnen von geringem Aussagewert und unterschlagen negative Kritiken. Folgt man ihren Verlautbarungen, könnte man zu dem Eindruck gelangen, sie würden von einem überwältigenden Erfolg zum nächsten eilen.
Den Erfolg aber bemessen sie nach den Gesetzen des Neoliberalismus nicht an ihrem Beitrag zur Geschichte des Theaters als Ort der Kunst, sondern an der Schlussabrechnung. Die Festspiele in Reichenau an der Rax verkündeten am 1. Juli dieses Jahres: „Die Rückzahlaktion der Kartenpreise 2020 ist abgeschlossen. Über € 2,2 Millionen wurden in Einzelbeträgen zwischen 4. Mai und 30. Juni überwiesen.“ Und das Theater Konstanz ließ die Presse und sein Publikum wissen: „Darüber hinaus gibt es gute Nachrichten aus dem Theater. Der Intendant des Theater Konstanz konnte stolz darauf hinweisen, dass trotz ausgefallener Vorstellungen und fehlender Einnahmen im Theater zum Abschluss der Intendanz Nix ein Überschuss von derzeit kalkulierten 153.000 Euro erzielt werden wird. ‚Wir finanzieren dieser Stadt ihre Millionenverluste beim Bodenseeforum und der Philharmonie und machen darüber hinaus fröhlich Kunst‘, stellte der Intendant des Theaters fest. Das Theater ist in Stadt und Land weiterhin beliebt und Nix freue sich seiner Nachfolgerin, ein so gutes wirtschaftliches Ergebnis kommunizieren zu können.“ (Die Zeichensetzung folgt dem Original.)
Als ich vor gut 50 Jahren nach Deutschland kam, amüsierte mich, wie die Landesschau des Süddeutschen Fernsehens Abend für Abend über irgendwelche Veranstaltungen und Unternehmungen berichtete, ohne jemals die Nennung der Kosten zu unterschlagen. Ich hielt das für „typisch schwäbisch“. Inzwischen ist die Denkungsart überregional bei den Theatermachern angekommen. Nichts euphorisiert so sehr wie eine glatte Bilanz. Die eigentliche Premierenfeier findet an der Kasse statt. Was drinnen auf der Bühne geschieht, ist im Vergleich dazu zweitrangig. Dort zetert Harpagon: „Was Teufel! Immer Geld! Es scheint, als hättet Ihr nie etwas anderes zu sagen als Geld, Geld, Geld! – Sie haben immer alle das eine Wort auf der Zunge: Geld! – sprechen nie von etwas anderem als von Geld! – Damit stehen sie auf und gehen damit zu Bett: immer und ewig nur Geld!“ Harpagon ist ein Heuchler. Er würde sich durchaus als Intendant an einem deutschen Theater eignen. Dort hätte er in diesen Tagen seinen großen Auftritt, hin und her gerissen zwischen dem Lamento über die coronabedingten Einbußen und dem habituellen Selbstlob. Fast scheint es, als wäre er dem Virus dankbar dafür, dass es ihm Gelegenheit gibt, den Satz zu belegen: „Wenn die Not am größten, dann ist Gottes Hilfe am nächsten.“ Wobei Gott, je nach Laune, der Finanzminister sein kann oder er, Harpagon als Intendant, selbst.
|
Thomas Rothschild - 23. Juli 2020
2691
|
 Karlsruhe, Marbach und überall
Karlsruhe, Marbach und überall
|
Auf dem Theaterportal nachtkritik.de tobt zurzeit eine heftige Diskussion über deplorable Zustände am Badischen Staatstheater Karlsruhe, die wiederum von den Badischen Neuesten Nachrichten in mehreren Artikeln bekannt gemacht wurden.
Was an einem Einzelfall die Gemüter erregt, ist nicht so einmalig, wie es scheinen mag. Einmalig ist daran lediglich, dass an die Öffentlichkeit gelangt ist, was in der Regel durch ein Wechselspiel von Erpressung durch Vorgesetzte und Feigheit der Abhängigen geheim gehalten wird. Die zu Recht beklagten Missstände herrschen nicht nur in Karlsruhe und nicht nur am Theater. Sie sind vielmehr ein Problem der Hierarchien, die das Rollback nach 1968 gestärkt hat und verschlimmert durch den Typus des mediengewandten Selbstdarstellers (s. Legale Segregation). Das belegt unter anderem ein Artikel von Bettina Wieselmann, der dieser Tage unter dem Titel Literaturarchiv – Brandbrief von der Schillerhöhe in der Heidenheimer Zeitung erschienen ist.
"In der Belegschaft des Deutschen Literaturarchivs (DLA) rumort es immer stärker. In einem Brandbrief, der der Südwest Presse vorliegt, wurde jetzt das aufsichtsführende 20-köpfige Kuratorium aufgefordert, sich mit der 'desolaten Lage' zu befassen. Marbach mit seinen rund 260 Mitarbeitern müsse wieder zu einem Ort werden, 'mit dem man sich identifizieren kann, an dem man wohlwollend miteinander umgeht und gerne arbeitet', schreibt die Betriebsratsvorsitzende Ulrike Weiß. Das Unverständnis über die Amtsführung von Direktorin Sandra Richter, die seit 2019 an der Spitze der national und international hoch angesehenen Institution steht, macht sich vor allem fest an dem Ende April erfolgten Rausschmiss der weithin geschätzten Verwaltungsleiterin Dagmar Janson (...).
Das geht auch aus dem zehnseitigen Anhang an den Brandbrief hervor, der eine Fülle anonymisierter E-Mails aus der Belegschaft auflistet. (...) 'Fassungslos' und 'geschockt' wird beklagt, dass sich Richter in 'einer ihrer ersten Amtshandlungen' von einer 'kompetenten, hilfsbereiten, für Kritik stets offenen Vorgesetzten' getrennt habe. Der Eindruck, der sich seit Beginn 2019 verfestige, finde mit der Freistellung von Janson seinen Höhepunkt: 'Weiß die Direktion, was sie tut?' Die 'Demontierung' der Führungskraft lasse auf eine 'gezielte Racheaktion, auf Willkür und Duodezverhalten schließen, das einem Deutschen Literaturarchiv wahrlich nicht würdig ist'.
(...) Weiß hält Richter vor, sich auf die Außendarstellung des DLA zu konzentrieren: 'Interne Abläufe werden dadurch teils immer noch nicht gekannt.' Das führe 'zu großer Verunsicherung und negativer Grundstimmung im Haus'. Die Folge: eine 'ungewöhnlich hohe personelle Fluktuation'. 'Wir wenden uns an das Kuratorium als mögliches Korrektiv und bitten Sie, sich mit der Geschäftsleitung in Verbindung zu setzen', appelliert Weiß." (Quelle: hz.de)
Karlsruhe, Marbach, in zahllosen Städte und Institutionen zwischen Kiel und Konstanz, zwischen Saarbrücken und Rostock herrschen feudale Zustände, von denen man um 1968 dachte, dass sie überwunden seien. Sie haben eher zugenommen. Geblieben sind die Strukturen, die verhindern, dass sie ans Tageslicht kommen. Die sie melden könnten, haben zu viel zu verlieren. Darauf können sich die Herren und die Damen als Herren verlassen. In der Regel. Bemerkenswert ist auch die Zurückhaltung der regionalen Medien in Sachen Literaturarchiv Marbach. Dank gebührt den Whistleblowern, die diese Mechanismen der Einschüchterung und der Komplizenschaft unterlaufen. Allzu viele sind es nicht. Und allzu hoffnungsvoll stimmt es nicht, wenn man den jüngsten Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten vom 8. Juli 2020 zur Kenntnis nimmt. Demnach scheint der baden-württembergischen Kunstministerin Theresia Bauer und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup, die dem Verwaltungsrat des Theaters vorsitzen, der Umstand, dass aus dem Thema „gleich eine öffentliche Debatte“ gemacht worden sei, mehr Sorgen zu bereiten als das Thema selbst. Alles wie gehabt? In Karlsruhe, Marbach und sonstwo?
|
Thomas Rothschild - 8. Juli 2020
2689
|
 Technologie, Fortschritt und die Lehren des Coronavirus
Technologie, Fortschritt und die Lehren des Coronavirus
|
Als die ersten Schreckensmeldungen über AIDS verbreitet wurden und man noch wenig über die Verbreitung der Krankheit wusste, mögen viele dem Geschlechtsverkehr den Telefonsex vorgezogen haben. Schließlich gab es die technischen Voraussetzungen, die den direkten körperlichen Kontakt überflüssig machten. Die Folgen dieser Erkenntnis waren gering. Der Geschlechtsverkehr hat den Telefonsex überdauert. Nachhaltig.
Die Ideologen des Streaming, die technische Neuerungen mit Fortschritt verwechseln, wollen uns einreden, dass das Theater, „wie wir es gekannt haben“, wegen Corona zum Verschwinden verdammt sei. Die Evidenz widerspricht dieser scheinbaren Gewissheit. Jetzt öffnen die Theater wieder nach und nach ihre Pforten – und siehe da: das Publikum strömt herbei, als sei nichts passiert. Die apokalyptische These ist ebenso plausibel wie die Behauptung, dass der Bau von Wolkenkratzern nach der Zerstörung der Twin Towers durch zwei Flugzeuge oder der Kapitalismus nach der Lehmann-Pleite undenkbar sei. Das Kino hat, entgegen düsteren Prognosen, die Erfindung des Fernsehens und das Konzert die Schallplatte überlebt. Der Synthesizer hat sich bei der Filmmusik (aus Kostengründen) weitgehend durchgesetzt, aber bedeutet er für die Gattung einen künstlerischen Fortschritt? Öffentliche Hinrichtungen sind in unseren Breitengraden nicht wegen einer Katastrophe verschwunden und noch nicht einmal wegen einer Zunahme an Humanismus, sondern weil es dafür keinen Bedarf mehr gab. Nichts weist darauf hin, dass das für das Theater gelten dürfte. Und wenn Franz-Xaver Kroetz der Süddeutschen Zeitung mitteilt, er kenne niemanden, den Theater interessiert, außer seine Zahnärzte, dann verwechselt er das Interesse an seinen Stücken mit dem Interesse an Theater. So viele Zahnärzte, wie jetzt wieder die Theater füllen, gibt es gar nicht. Anders als dem gealterten Dramatiker schließen für sie House of Cards und Hamlet einander nicht aus.
Das könnte tröstlich sein, und man könnte gelassen darauf warten, bis der Aufmerksamkeitswert der gegenwärtigen Möchtegernpropheten, die sich im übrigen nicht selten zum Instrument massiver ökonomischer Interessen machen lassen, wieder verblasst ist wie der von Verkündern des Segens elektrischer Brotschneidemaschinen oder von Tischgeräten für die Zubereitung von Raclette. Leider aber wirken sich die Mechanismen der Vergänglichkeit, der begrenzten Halbwertzeit nicht nur bei technischem Krimskrams aus. Auch geistige Errungenschaften unterliegen diesen Regeln. Bis etwa zum Tod von Thomas Bernhard vor mehr als dreißig Jahren gab es kaum eine Umfrage über die bedeutendsten österreichischen Schriftsteller der Nachkriegszeit, auf der nicht H.C. Artmann an einem der ersten Plätze gestanden hätte. Diesseits der Anhängerschaft von Johannes Mario Simmel und Christine Busta war man sich weitgehend über den Rang Artmanns einig. Seine Wertschätzung implizierte ein Bekenntnis zur sprachorientierten Literatur, die die Verunglimpfung der Moderne in der Nazi-Zeit rückgängig machen sollte. Eine ganze jüngere Generation von österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern berief sich auf H.C. Artmann.
Wenn man junge Leser heute nach Artmann fragt, dürfte das Ergebnis ernüchternd sein. Zwanzig Jahre nach seinem Tod ist Artmann so gut wie vergessen. Er ist kein Einzelfall. Ein großer Teil der Autoren des 20. Jahrhunderts, deren Lektüre bei halbwegs gebildeten Menschen noch vor kurzem vorausgesetzt werden durfte, ist heute wohl, wenn überhaupt, nur noch dem Namen nach bekannt. Vermutlich wissen Gymnasiasten noch, was mit „kafkaesk“ gemeint ist, aber haben sie, über die Schullektüre der Verwandlung hinaus, Kafka gelesen? Von Proust, Joyce und Musil sprechen wir gar nicht erst. Was eben über Literatur geäußert wurde, gilt zumindest ebenso für die Meisterwerke der Filmkunst. Sie sind nicht am Fernsehen verendet – im Gegenteil: arte und 3sat füllen mit dankenswertem Engagement die entstandene Angebotslücke –, sondern am Wandel oder am Verlust der kommunalen und Programmkinos. Kein Virus, sondern eine ahnungslose Kulturpolitik hat sie abgemurkst. Und wer greift schon zur DVD eines Ophüls, eines Antonioni, einer Varda, wenn ihm die Namen nichts sagen.
Bertolt Brecht lässt seinen Galilei auf den Satz seines Schülers Andrea „Unglücklich das Land, das keine Helden hat“ erwidern: „Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ Der Satz ließe sich so variieren: „Unglücklich das Land, das den Sieger des letzten Eurovision Song Contests und die Vornamen der Nachkommen aus den Königshäusern kennt, nicht aber seine bedeutendsten Schriftsteller, Filmemacher, Komponisten, Maler.“ Unglücklich eine Welt, die sich der Vergänglichkeit des kulturellen Gedächtnisses widerstandslos hingibt und auf Streaming vertraut.
Corona wird zähmbar sein. Die Theater werden wieder spielen. Aber ein Artmann oder ein Ophüls könnten zu Bewohnern der Archive werden. Für ein paar spinnerte Spezialisten.
|
Thomas Rothschild - 1. Jui 2020 (2)
2687
|
 Die Sehnsucht nach dem Selbstbetrug
Die Sehnsucht nach dem Selbstbetrug
|
Der Kabarettist Mathias Richling hat in der Talkshow von Sandra Maischberger seinem Ärger über die Maßnahmen gegen das Coronavirus in einer Weise Luft gemacht, die bei Zuschauern und in den Medien Empörung ausgelöst hat. Nun hat er in einem Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten einiges relativiert und Erläuterungen nachgeschoben, die seine Position verständlich machen sollen und in der Tat zum größten Teil nachempfunden werden können. In diesem Gespräch wirft er den Virologen allerdings auch vor, dass sie gesagt hätten, die Krise würde zwei Jahre dauern. „Mit der Aussicht auf Drama kann der Mensch nicht leben“, fügte er hinzu.
Was schlägt er vor? Sollten die Virologen, die auch irren können, eine Erkenntnis für sich behalten, die sie für richtig halten? Sollen sie mit Rücksicht darauf, womit der Mensch angeblich nicht leben kann – und das ist, im Gegensatz zu dem möglichen Tod durch das Virus, in diesem Zusammenhang lediglich bildlich gemeint –, lügen? Sollen sie Trost spenden, statt dem wissenschaftlichen Ethos zu folgen?
In Zeiten der Gefährdung wird ein Thema virulent, das nie an Aktualität verloren hat, das Thema der Lebenslüge, des Selbstbetrugs. Es ist ein Thema, das bei den Dramatikern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zentrale Stellung eingenommen hat. Wenn Dramaturgen und Schauspieldirektoren behaupten, deren Stücke hätten uns heute nichts mehr zu sagen, sei ihnen empfohlen, im Schatten von Richlings Vorhaltung diese Dramen zu lesen (und, wenn sie ihre Aktualität begriffen haben, auf die wieder eröffneten Bühnen zu bringen): Die Wildente von Henrik Ibsen, Drei Schwestern von Anton Tschechow, Maxim Gorkis Nachtasyl, Ferenc Molnars Liliom, Eugene O'Neills Der Eismann kommt und Fast ein Poet, Die Glasmenagerie von Tennesse Williams oder Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden. Sie alle handeln von Menschen, die Wunschträumen und Lebenslügen nachhängen. Es muss nicht die zur Gewissheit umgedeutete Hoffnung sein, dass die gegenwärtige Krise schon irgendwie in absehbarer Zeit zu ende gehen werde. Die Herstellung der Analogie kann man den Zuschauern schon zumuten. Vielleicht werden sie dann erkennen, dass nicht die Virologen und auch nicht der Staat mit seinen Vorsichtsmaßnahmen ihre Gegner sind, sondern Lügen, die eine angemessene Reaktion verhindern.
Der Anarchist Michail Alexandrowitsch Bakunin, einer der schärfsten Kritiker staatlicher Herrschaftsausübung, hat geschrieben: „Wenn ich mich vor der Autorität von Spezialisten beuge und bereit bin, ihren Angaben und selbst ihrer Leitung in gewissem Grade und, solange es mir notwendig erscheint, zu folgen, tue ich das, weil diese Autorität mir von niemand aufgezwungen ist, nicht von den Menschen und nicht von Gott. Sonst würde ich sie mit Abscheu zurückweisen und ihre Ratschläge, ihre Leitung und ihre Wissenschaft zum Teufel jagen, in der Gewissheit, dass sie mich die Brocken menschlicher Wahrheit, die sie mir geben könnten, in viele Lügen eingehüllt, durch den Verlust meiner Freiheit und Würde bezahlen ließen.“ Er war klüger als die Demonstranten, die tagein tagaus alle möglichen Formen von staatlicher Willkür hinnehmen, aber auf die Straße gehen, wenn die Warnungen von Virologen ernst genommen werden.
|
Thomas Rothschild - 16. Mai 2020
2679
|
 License to Kill
License to Kill
|
1968 war Robert Spaemann neben Max Bense Ordinarius für Philosophie an der Universität Stuttgart. Bei einer der öffentlichen Protestveranstaltungen gegen die zum Beschluss anstehenden und im Mai schließlich verabschiedeten Notstandsgesetze war Spaemann der Hauptredner. Als ich ihm viele Jahre später in der Landesbibliothek begegnete, bekannte er, auf diese Vergangenheit angesprochen, en passant, es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, dass er sich damals von den Studenten unter Druck habe setzen lassen.
Jetzt, 52 Jahre später, doziert Frank Castorf: „Als die BRD-Regierung Ende der Sechzigerjahre versuchte, eine Notstandsgesetzgebung durchzupeitschen, gab es einen wahnsinnigen Bürgeraufstand gegen diese Gesetze. Wo bleibt der heute?“ Entweder hat Frank Castorf, der damals in der DDR lebte, die Ereignisse aus der Ferne verzerrt wahrgenommen, oder er erinnert sich falsch. Von einem wahnsinnigen Bürgeraufstand konnte – leider – keine Rede sein. Unter den Parteien war die FDP, in der Walter Scheel eben erst Erich Mende als Vorsitzenden abgelöst und Ralf Dahrendorf an Einfluss gewonnen hatte, die einzige, die im Bundestag fast geschlossen gegen den Gesetzentwurf stimmte. Und der Protest ging in erster Linie von den Gewerkschaften, insbesondere von der IG Metall, und von der Studentenbewegung aus. Von den „Bürgern“ und von der überwiegenden Mehrheit der Medien wurde dieser Protest eher feindselig begleitet.
Was Frank Castorf bei seiner flotten Analogie übersieht, ist dies: Die Notstandsgesetze von 1968 richteten sich gegen die Menschen, gegen die Ausübung demokratischer Grundrechte in politischen Auseinandersetzungen. Sie sollten die Voraussetzungen schaffen für eine mögliche Entwicklung, wie wir sie zurzeit in Ungarn beobachten können. Die gegenwärtigen Gesetze und Verordnungen in Deutschland, die die Bewegungsfreiheit einschränken und – was Castorf besonders erregt – Empfehlungen wie jene zum Händewaschen ausgeben, richten sich gegen ein Virus.
Was Castorf und seine Gesinnungsgenossen fordern, ist die Lizenz zur fahrlässigen Tötung. Man kann noch großzügig darüber hinwegsehen, was die Allgemeinheit an Kosten mitzutragen hat, wenn Einzelne ihre eigene Gesundheit und ihr Leben gefährden. Aber die Maßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 sollen nicht so sehr den einzelnen Menschen wie die gesamte Bevölkerung schützen. Wer ihr diesen Schutz versagt, gibt sie zum Abschuss frei. Ein hoher Preis für das Recht, sich in größeren Gruppen zu treffen oder auf Wasser und Seife zu verzichten. Der anarchische Gestus gegen die Bevormundung, den man sich an anderer Stelle tatsächlich häufiger wünschen würde, verschleiert hier nur ein Plädoyer für Rücksichtslosigkeit, wenn nicht für Sozialdarwinismus.
Originalton Castorf: „Aber angesichts der jetzigen Sterblichkeitsrate und der Zahl von bisher weniger als 6000 Corona-Toten sage ich: Es ist immer traurig, wenn ein Mensch stirbt, auch ein alter Mensch. Aber es ist der Lauf der Dinge, den wir akzeptieren müssen.“ Ob der Theatermacher den Lauf der Dinge auch so gelassen akzeptierte, wenn unter jenen, deren Tod vermieden oder zumindest verschoben hätte werden können, seine engsten Freunde wären?
|
Thomas Rothschild - 4. Mai 2020
2677
|
 Wenn das Virus kommt
Wenn das Virus kommt
|
Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion belehrt:
„Eine Empfehlung von Bundesminister Spahn zur Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern schafft zwar faktisch einen enormen Druck. Sie hat aber nur dann Wirkung, wenn die Länder sie auch wirklich umsetzen.
Dazu muss man wissen: Diese Aufgabenverteilung ist in der Bundesrepublik überhaupt nicht ungewöhnlich. Sie ist sogar die Regel und hat eine lange Tradition. Etwa bei der Zuständigkeit für Themen wie Gefahrenabwehr durch die Polizei oder bei der Bildungspolitik. Das alles ist Ländersache. ‚Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt‘, heißt es zudem in Artikel 83 des Grundgesetzes.
Der Gedanke dahinter: Vor Ort in den Regionen weiß man oft am besten, was angemessen ist. Die Situation in Nordrhein-Westfalen kann anders sein als in Sachsen. Auch beim Thema Corona. In einigen Regionen kann das Thema Kinderbetreuung nach einer Schulschließung noch brisanter sein als in anderen. Dann kann man dort auch spezifisch reagieren.“
Wieder einmal suggeriert ein Verlautbarer Vernunft, wo eher der historische Zufall herrscht. Der zitierte Artikel des Grundgesetzes schuldet sich nicht einem „Gedanken“, sondern der Geschichte. Die Delegierung zahlreicher Kompetenzen, die anderswo zentralisiert sind, an die Bundesländer ist, wie der Föderalismus in Deutschland überhaupt, eine Folge dessen, was Helmuth Plessner die „Verspätete Nation“ genannt hat. Sie ist ein Überrest der Segmentierung des späteren Deutschen Bundes und des Deutschen Reichs in rund drei Dutzend eigenständige Fürstentümer und Freie Städte. Eine Zentralregierung ist für Deutschland im Vergleich zu anderen Nationalstaaten eine historisch junge Erfahrung.
Das Nachwirken der Fürstentümer und Freien Städte bis in unsere Zeit auf zahlreichen Gebieten, keineswegs nur bei der Ausführung von Bundesgesetzen, hat Vor- und Nachteile. Wir verdanken ihm unter anderem eine Theaterlandschaft, um die uns andere Staaten beneiden. Dass sich das kulturelle Angebot nicht weitgehend auf die Hauptstadt beschränkt wie beispielsweise in England, Frankreich oder Japan, verdankt sich der Tatsache, dass noch vor 150 Jahren auch München und Stuttgart, Dresden und Weimar, Darmstadt und Wiesbaden Hauptstädte und Freie Städte wie Hamburg, Bremen, Frankfurt am Main mächtige Wirtschafts- und Kulturzentren waren.
Der Lächerlichkeit aber gibt sich preis, wer anlässlich eines Virus zu erkennen vorgibt, dass man „vor Ort in den Regionen oft am besten (weiß), was angemessen ist“, ansonsten aber Tag für Tag die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen nicht nur der Orte und Regionen, sondern sogar der Nationalregierungen an die EU ohne Wenn und Aber verteidigt. Dass es eine kalkulierte EU-Gegnerschaft von rechts gibt, deren Motive es zu analysieren und zu enttarnen gilt, kann nicht von der Verpflichtung befreien, den Widerspruch aufzuklären: warum Brüssel der Hort der politischen Weisheit sein soll, die Regionen aber am besten wissen, was angemessen ist, wenn das Virus an die Tür klopft.
|
Thomas Rothschild - 13. März 2020
2663
|
 Gute Idee
Gute Idee
|
Vor ein paar Jahren verrieten uns die Salzburger Festspiele ein bemerkenswertes historisches Detail: „Für das Zustandekommen des Jedermann bat die Salzburger Festspielhaus-Gemeinde Anfang Juli 1920 die Landesregierung um die kostenlose Bereitstellung von Bauholz für die Festspielbühne in der Felsenreitschule. Um das Projekt zu ermöglichen, verzichtete sie zugunsten von Invaliden, Kriegswaisen und Kriegsgefangenen auf den erwarteten Reingewinn, ebenso wie Max Reinhardt, der Ausstatter Alfred Roller und die Schauspieler auf ihre Gagen sowie Hugo von Hofmannsthal und die Komponisten Einar Nilson und Bernhard Paumgartner auf ihre Tantiemen.“
Wie wäre es, wenn man diesem Beispiel zum hundertjährigen Jubiläum folgte? Invaliden, Kriegswaisen und Kriegsgefangene gab es ja nicht nur im Ersten Weltkrieg und gibt es nicht nur in Mitteleuropa. Wenn der Regisseur, der Ausstatter und die Schauspieler auf ihre Gagen verzichteten (die Erben Hofmannsthals bekommen ohnedies keine Tantiemen, weil der mehr als 70 Jahre tot ist), vor allem aber den Kartenbüros der Aufschlag von 30 bis 40 Prozent und mehr untersagt würden, die sie auf jede verkaufte Karte erheben – und die meisten Karten zum beliebten Jedermann teilen sie, erpresserisch, überhaupt nur Käufern von Karten zu weiteren Aufführungen zu –, käme schon ein ganz schöner Batzen zusammen. Das wäre einmal eine echte pazifistische Anstrengung anstelle von lautstarkem Selbstlob.
|
Thomas Rothschild - 17. Dezember 2019
2651
|
 Schauspielerweisheiten
Schauspielerweisheiten
|
Die Ehrfurcht vor den vorgeblichen Weisheiten von Prominenten – und das sind in unserer Zeit in erster Linie Menschen, die im Fernsehen auftreten – ist nur selten begründet. Was sie „meinen“, hat in den wenigsten Fällen mehr Belang als die Äußerungen am Stammtisch. Das gilt grundsätzlich auch für Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie sind für die Erklärung der Welt nicht besser qualifiziert als der Milchmann und die Bäckerin an der Ecke. Man könnte sogar vermuten, dass sie das ständige Schlüpfen in Rollen von ihrem eigenen Ich und dem damit verbundenen eigenen Denken entfernt. Aber es gibt Ausnahmen, hochintelligente Theaterleute, die uns Dinge zu sagen haben, auf die wir hören sollten. Zwei solcher Aussprüche seien hier in Erinnerung gerufen, ehe sie in Vergessenheit geraten.
In einem Interview sagte Ulrich Matthes einmal über das Vorlesen von Kleist: „Dieses Kataraktische, Vorwärtsdrängende, Hochmusikalische will aufbewahrt sein. Die Musik kann man aber nicht so in den Vordergrund stellen, dass die Prosa zwar schön fließt, man aber ihren Sinn nicht mehr versteht. Der Text will sowohl intellektuell als auch musikalisch durchdrungen sein. In einem zweiten Schritt geht es darum, in der hohen Emotion eine Art Verhaltenheit zu bewahren: Im Lesen muss man das Emotionale zurückhalten, um wiederum den Text nicht auszuliefern.“
In seinem Buch Nachdenken über Theater schrieb der große, vor fünf Jahren verstorbene Schauspieler Rolf Boysen: „Wir Heutigen müssen aufpassen, dass die krebsartig wuchernden optischen und akustischen Frohsinnsreize nicht alle anderen Bedürfnisse auffressen, dass dieser travestierte Optimismus, diese geschändete Lebensfreude und die nivellierte Erwartungshaltung nicht zur Null-Linie unseres gesellschaftlichen Koordinatensystems erklärt wird.“
Was ließe sich dem hinzufügen?
|
Thomas Rothschild – 27. November 2019
2648
|
 Salzburg vs. Stuttgart
Salzburg vs. Stuttgart
|
Bei den Salzburger Festspielen war im vergangenen Sommer eine Koproduktion mit dem Schauspiel Stuttgart zu sehen: Die Empörten von Theresia Walser. Im Januar 2020 sollte die Stuttgarter Premiere stattfinden. Daraus wird jetzt nichts. Der Intendant und Regisseur der Inszenierung Burkhard C. Kosminski hat sie „aus dispositorischen und künstlerischen Gründen“ abgesagt. Eine vertraute Phrase.
Die Stuttgarter Zeitung wollte es genauer wissen. Auf Nachfrage von dessen Theaterkritiker erklärte Kosminski: „Ich wollte mit dem Team weiter an der Inszenierung arbeiten, aber eine längere Probenphase ließ sich wegen den eng getakteten Dispositionen sowohl hier im Haus als auch bei den auswärtigen Gastspielern nicht realisieren.“ Die „auswärtigen Gastspieler“ sind Prominente der gegenwärtigen Theater- und Fernsehszene: Caroline Peters und André Jung. Sie wären für Stuttgart eine Attraktion, um nicht zu sagen: eine Sensation, gewesen.
Wenn Kosminski die Wahrheit sagt, bedeutet das im Klartext: bei den hochdotierten Salzburger Festspielen werden Inszenierungen gezeigt, die nicht fertig sind, die „eine längere Probenphase“ benötigen, um ins Repertoire eines (mitfinanzierenden) Staatstheaters übernommen werden zu können. Wenn es sich um eine Ausrede handelt – mit taktischen Winkelzügen dieser Art muss man bei Presseverlautbarungen rechnen –, fällt zunächst deren Termin auf: ein Vierteljahr nach der Salzburger Uraufführung (war die Notwendigkeit zusätzlicher Proben und deren Nicht-Realisierbarkeit nicht früher erkennbar?) und exakt vier Tage, nachdem Caroline Peters als die neue Buhlschaft im unverzichtbaren Jedermann vorgestellt wurde. Es drängt sich der Verdacht auf, dass in diesem Fall die Termine dem vielbeschäftigten Star über den Kopf gewachsen sind, dass es Caroline Peters war, die ihre Arbeit in Salzburg nicht mir einer „längeren Probephase“ in Stuttgart vereinbaren konnte oder wollte. Ihre Entscheidung hieße dann: Buhlschaft statt Anti-AfD-Stück. Das wäre zwar menschlich verständlich, aber wie man früher gesagt hätte: es gehört sich nicht. Pacta sunt servanda – auch wenn attraktive Angebote ihnen in die Quere kommen. Hoffen wir, dass unser Verdacht ungerecht ist.
Als Fazit jedenfalls bleibt: entweder wurden die Besucher der Salzburger Festspiele um eine hinreichend geprobte oder die Stuttgarter um die ganze Inszenierung betrogen. Tertium non datur.
Für die Stuttgarter ist das umso trauriger, als ihnen mit Caroline Peters und Theresia Walsers Auftragsarbeit auch der unvergleichliche André Jung vorenthalten wird, der am Ort bei jedem Gastspiel zu Recht umjubelt wurde.
|
Thomas Rothschild - 13. November 2019
2646
|
 Das Theater und die Telefonzelle
Das Theater und die Telefonzelle
|
Neulich war ich auf der Postbank. (Ein Postamt gibt es in der Stadt, in der ich wohne, nicht mehr.) Ich bat um sieben Briefmarken mit verschiedenen Werten. Die Dame am Schalter rechnete den fälligen Betrag im Kopf zusammen – ganz ohne Computer, sogar ohne Taschenrechner.
Kürzlich war ich auf Kreta. Mit dem Autobus gelangt man in die nahe Kleinstadt. Zugegeben, der fährt zwar nicht immer pünktlich nach Fahrplan, aber das gilt auch, mehr noch, für die Stuttgarter S-Bahn. Es gibt keine Automaten, die kaputt sind oder Geld nicht wechseln können. Das Ticket bekommt man beim Schaffner, der zudem Auskunft erteilen kann über die Haltestelle, bei der man aussteigen muss.
Vor einiger Zeit sah ich eine für jede und jeden zugängliche Kabine mitten auf einem Platz. Wenn man Münzen einwarf und eine Nummer wählte, konnte man unbehindert mit der Großmutter telefonieren. Man benötigt kein Smartphone und muss es, wenn man doch eins hat, nicht mit sich herumtragen – ein Segen für jeden, der taschenlose T-Shirts favorisiert.
Es soll sogar Menschen geben, die, ausgestattet mit einer Landkarte oder einem Stadtplan, ganz ohne Navi an ihr Ziel finden.
Ungefähr so lesen sich Theaterkritiken in diesen Tagen. Da heißt es, eine Inszenierung „bleibe ganz nah am Original“, es gebe „von aktueller politischer Haltung keine Spur“, eine Regisseurin wird gelobt, obwohl oder weil: „Eine Kommentierung oder gar Überschreibung des Stoffs auf heutige Diskurslagen hin versagt sie sich“, aber sie habe den Kern der Geschichte doch verfehlt, „obwohl [sie] den Stoff weder aktualisiert noch umdeutet“, eine Inszenierung verpuffe, „weil aktuelle Bezüge fehlen“.
Ist es Ironie oder vorauseilende Absicherung, wenn das Hessische Staatstheater Wiesbaden mit den folgenden Worten zu einer Premiere einlädt: „Mit seiner Inszenierung des Zerbrochnen Krugs unternimmt Uwe Eric Laufenberg den ungewöhnlichen und radikalen Versuch, hundertprozentig auf den Dichter Heinrich von Kleist zu vertrauen: Ohne Striche, ohne Fremdtexte, ohne Videos und ohne Musik wird Kleists Lustspiel so pur wie selten auf die Bühne gestellt.“
Was gestern noch als selbstverständlich wahrgenommen wurde, wird heute als exotisch und veraltet empfunden oder jedenfalls präsentiert. Merken die Kritiker eigentlich, dass sie, indem sie das gerade Gängige, das morgen schon als „altmodisch“ gelten wird, zur Norm erheben, genau daran mitwirken: an der Erschöpfung und dem Verschleiß künstlerischer Mittel, die ihre Wirkung einbüßen, wenn sie keine Differenzqualität mehr besitzen? Sie opfern das Theater mit seiner Vielfalt, mit Kopfrechnerinnen, Busschaffnern und Telefonzellen, dem Konformismus, dem sie längst erlegen sind. Schade.
|
Thomas Rothschild - 2. Oktober 2019
2641
|
 Nein zum freien Zugang
Nein zum freien Zugang
|
Der MDR hat 32 Intendantinnen und Intendanten von Theatern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Situation des Theaters befragt. Eine der 16 Fragen lautete: „Sollte der Eintritt zu öffentlich-subventionierten Theatern künftig frei sein?“ Mit der einzigen Ausnahme des Intendanten der Oper Halle („Von mir aus gerne!“) antworteten alle mit einem mehr oder weniger resoluten, nur minimal modifizierten „Nein“.
Man sieht: die Zuständigen für eine Demokratisierung der Kultur sind in den Ländern zunehmender Rechtsentwicklung im Kapitalismus angekommen. Was spricht gegen den freien Eintritt zu Theatern? Das "Nein" der Intendantinnen und Intendanten bedeutet im Klartext: Kultur gehört nicht zu den Grundrechten der Menschen. Die Autostraßen dürfen kostenfrei benutzt werden, obwohl jene, die nicht Auto fahren, sie mit ihren Steuern mitfinanzieren. Sie finanzieren auch die Stadien, selbst wenn sie sie noch nie betreten haben. Warum soll für die Theater nicht das Gleiche gelten? Nur, weil es bisher nicht gegolten hat? Früher einmal waren die Theater den Aristokraten vorbehalten. Die Schloss- und Burgtheater zeugen davon. Dann hat sich die Bourgeoise die Theater zusammen mit anderen Kultureinrichtungen erobert. Die Gebäude demonstrierten neben Börsen und Banken das neue Selbstbewusstsein der herrschenden Klasse. Warum wollen Intendantinnen und Intendanten einem über das Bildungs- und Geldbürgertum hinausgehenden Publikum nicht zugestehen, was beim Verbrauch von Luft (noch) als selbstverständlich gilt? Die Entwicklung geht nicht zu mehr Demokratie, sondern, wie die Einführung von Gebühren für den Zugang zu Hochschulen bewiesen hat, zu mehr Klassengesellschaft. Im Zweifel entpuppen sich die Theaterleute halt doch als Reaktionäre.
|
Thomas Rothschild - 27. August 2019
2636
|
 Festspiele als Testgelände
Festspiele als Testgelände
|
Previews oder Tryouts sind in den USA und auch in Großbritannien, insbesondere im Bereich des kostspieligen Musicals, gängige Praxis. Ehe eine Produktion in New York oder London zum Einsatz kommt, um von einflussreichen Kritikern beäugt zu werden, wird sie in der Provinz „ausprobiert“, manchmal auch noch verändert oder modifiziert. Diese Voraufführungen haben ein geringes Prestige. Sie gelten nicht als vollwertige Inszenierungen.
Die Bregenzer Festspiele lockten heuer rund 1.500 Zuschauer mit gerade drei Vorstellungen einer kleinen Produktion mit zwei Bühnenstars, die ab 12. Oktober am Deutschen Theater in Berlin zu sehen sein wird. Drei von den vier Sprechtheaterangeboten der Salzburger Festspiele jenseits des unsäglichen Jedermann sind Koproduktionen mit großen deutschen Bühnen und werden bald – ab 7. September, ab 21. September und ab 19. Januar – in den Metropolen Berlin, Hamburg und Stuttgart zu sehen sein, nachdem sich die Sonne hinter die Alpen und die Schickeria von der Salzach zurückgezogen hat. Dass auch die Wiener Festwochen in diesem Jahr kaum eigene Produktionen anzubieten hatten, wurde damit entschuldigt, dass der kurzfristig ernannte neue Intendant Christophe Slagmuylder dafür zu wenig Zeit gehabt hätte. Mal sehen, was ihm 2020 einfällt. Mit Wehmut denkt man an Zeiten, als sich die Festwochen noch Eigenproduktionen der anderswo schwer zu realisierenden Letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus leisteten.
Die Theater haben an Koproduktionen, die am Ort der Koproduzenten in Wahrheit nichts anderes sind als Previews, ein einziges Interesse: Sie bessern ihr Budget auf. Die finanziell gut ausgestatteten Festivals zahlen ihren Tribut und erhalten dafür das Ius primae noctis. Das freilich hat eine geringe erotische Attraktivität. Es ist, genauer betrachtet, nicht mehr als eine jener Provinzproben, die – siehe oben – im englischsprachigen Raum mit gerümpfter Nase beschnüffelt werden. Von Alleinstellungsmerkmal kann keine Rede sein. Die Premieren der Festivals sind so exklusiv wie die Modelappen im Second Hand Shop oder wie die Leckerbissen, die Vorkoster in Konservenfabriken testen, ehe sie in die Supermärkte kommen.
Eigentlich ist das gar keine schlechte Nachricht. Es bestätigt, was wir längst wussten: dass Festspiele meist mehr mit Snobismus zu tun haben als mit Neugier auf echte Entdeckungen. Und ein bisschen Schadenfreude darf sich schon hineinmischen, wenn man feststellt, dass die Besucher zu überhöhten Preisen auf Previews hereingefallen sind, deren eigentliche Premieren im ganz normalen Theater daheim stattfinden.
|
Thomas Rothschild – 27. Juli 2019
2632
|
 Bruno Ganz und René Pollesch
Bruno Ganz und René Pollesch
|
Bruno Ganz, der große Schauspieler, einer der größten seiner Generation ohne Zweifel, kündigte schon einige Jahr vor seinem Tod an, er wolle nicht mehr Theater spielen. „Keiner von diesen Bundesliga-Erste-Sahne-Regisseuren im deutschen Theater lässt Identifikation zu. Die scheuen das wie der Teufel das Weihwasser. Also habe ich da nichts mehr zu suchen.“ So begründete er seinen Entschluss. Das Theater, wie es sich ihm damals darstellte, gefiel ihm nicht. Also kündigte er seinen Rückzug an.
Das ist konsequent und war sein gutes Recht. Aber stimmte seine Diagnose? Stimmte sie in dieser Verallgemeinerung? Und wenn sie stimmte – was hat das, jenseits von den individuellen Vorlieben eines Schauspielers, zu bedeuten?
Erinnern wir uns an erfolgreiche Inszenierungen der vergangenen Jahre. Der Ödipus des Klaus Maria Brandauer bei Peter Stein – keine Identifikation? Der Lear des Gert Voss bei Luc Bondy – keine Identifikation? Der Raskolnikov des Jens Harzer bei Andrea Breth – keine Identifikation? Der Weibsteufel der Birgit Minichmayr bei Martin Kušej – keine Identifikation? Der Othello des Joachim Meyerhoff bei Jan Bosse – keine Identifikation? Die vier Figuren aus dem Gott des Gemetzels bei Jürgen Gosch und vielen anderen Regisseuren der A-, B- und C-Liga – keine Identifikation?
Es stimmt einfach nicht, was Bruno Ganz behauptet hat. Jedenfalls nicht in dieser Pauschalität. Der richtige Kern seiner Aussage liegt in einer Veränderung der dramatischen Kunst, die Autoren zumindest ebenso zu verantworten haben wie Regisseure, manchmal in Personalunion – am auffallendsten vielleicht René Pollesch. Diese Veränderung betrifft ein Misstrauen gegenüber dem Einfühlungstheater, gegenüber der naiven Suggestion, Schauspieler und Rolle bildeten eine Einheit. Man kann das mögen oder, wie Bruno Ganz, ablehnen. Pollesch aber und anderen Theaterleuten mit einer ähnlichen Auffassung vorzuwerfen, dass es bei ihnen keine „Rollenidentität“ mehr gebe, bedeutet, sich nicht auf ihre Absichten einzulassen. Es ist so, als hielte man einem Rocksänger vor, dass er keine Koloraturen meistert. Die Rolle hat über Jahrtausende hinweg im Theater gute Dienste geleistet und sie tut es immer noch. Aber sie ist ebenso wenig unverzichtbar wie Kothurn oder Rampenlicht. So arrogant es wäre, zu postulieren, dass Identifikation veraltet, „nicht mehr möglich“ sei, so reaktionär ist ihre Infragestellung. Sie wiederholt den Fehler derer, die Musik ohne Tonalität oder Malerei ohne Gegenständlichkeit verteufelt haben.
Die Pollesch-Verächter werfen dem produktiven Autor-Regisseur vor, dass er stets nur das Gleiche variiere. Wohl wahr. Jedenfalls wenn man seine Inszenierungen aus einer gewissen Entfernung betrachtet. Das gilt aber auch für die Commedia dell'arte oder für das japanische Nō-Theater. Originalität ist eine Möglichkeit in den Künsten, das Experiment im Rahmen eines mehr oder weniger strengen Regelsystems eine andere. Pollesch hat seine Methode, seine Handschrift gefunden. Man kann sie mögen oder nicht mögen wie die stets gleichen Songs von Leonard Cohen oder die stets gleichen Skulpturen von Richard Serra. Es bleibt ja jedem unbenommen, seine Vorlieben zu haben, aber warum muss man sie gleich zur Norm für die Gattung machen wollen?
Angesichts der Ernennung von Pollesch zum Intendanten der Volksbühne sollte man nicht vergessen, dass er einer der interessantesten Regisseure unserer Gegenwart ist. Dass das zwei sehr verschiedene Professionen sind, hat unter anderem Peter Zadek bewiesen. Man hat Pollesch vorgeworfen, dass das schnelle Sprechen, das er seinen Schauspielern abverlangt, das Verständnis des Textes erschwert oder unmöglich macht. Die Bezichtigung übersieht, dass Sprache in der gesprochenen Literatur, anders als in der Alltagskommunikation, nicht bloß als Bedeutungsträger funktioniert, sondern auch als Klang, als Ablauf von Intonationen und Rhythmen. Ihr „Sinn“ muss sich nicht unbedingt unmittelbar erschließen, kann sich aus Fragmenten, Wiederholungen, assoziativen Angeboten und auch aus Leerstellen ergeben. Die Rätselhaftigkeit, das Hermetische, das das Bildungsbürgertum an der Lyrik der Romantik bis hin zu Paul Celan zu schätzen vorgibt, resultiert bei Pollesch aus der Weigerung, sich den Gesetzen einer allenfalls durch schlampige Artikulation torpedierten Deklamation unterzuordnen.
Das Theater der Renaissance war weder realistisch, noch psychologisch. Zwar strotzen Shakespeares Stücke nur so von Menschenkenntnis, zwar liefern sie atemberaubende Einsichten in die individuelle und die gesellschaftliche Wirklichkeit, aber im Theater der Shakespeare-Zeit hatte die Stilisierung stets Vorrang vor der abbildlichen Darstellung der Erfahrungswelt. Nun ist es durchaus legitim, wenn sich heutige Zuschauer zusammen mit Bruno Ganz über die Kunstfertigkeit freuen, mit der große Schauspielerinnen und Schauspieler nachahmen, was ihnen aus dem Alltag bekannt ist. Aber dass sie sich mehr und mehr schwer tun mit einem Theater, das genau dies gar nicht anstrebt, das vielmehr seine eigene Sprache entwickelt, ist ein Verlust, den wir – sprechen wir es unverblümt aus – dem Fernsehen verdanken. Es soll hier nicht verteufelt werden, es hat ja seine Funktion. Aber wenn es zum Modell für die szenischen Künste wird, wenn sich Schauspielkunst darüber definiert, ob jemand die Augen aufschlägt und die Stirn runzelt wie ein echter Arzt, wie eine echte Unternehmerin, mit anderen Worten: wenn die Rollenidentität zum alleinigen Kriterium der Anerkennung als Schauspielkunst wird, dann ist es ebenso schädlich wie deren grundsätzliche Ablehnung. Das Wort ist so gemeint, wie es hier steht: schädlich.
|
Thomas Rothschild - 23. Juli 2019
2631
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE
URAUFFÜHRUNGEN
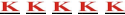
= nicht zu toppen

= schon gut
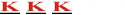
= geht so
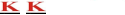
= na ja
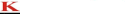
= katastrophal
|