Draußen vor der Tür
In Weimar inszeniert Marcel Kohler Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama coronabedingt als expressionistischen Tonfilm
|
Bewertung: 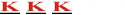
Während andere Theater in Deutschland schon wieder Testprojekte mit Präsenzveranstaltungen starten, konnte die letzte Premiere des Deutschen Nationaltheaters Weimar wieder nur online stattfinden. Zum 100. Geburtstag des Dramatikers Wolfgang Borchert hatte DT-Schauspieler und neuerdings auch Theaterregisseur Marcel Kohler für sein Debut am DNT eine Inszenierung des Theaterstücks Draußen vor der Tür geplant. „Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film.“ heißt es da im Prolog zu Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama, das er 1947 im Alter von 27 Jahren innerhalb von nur 8 Tagen todkrank im Basler St. Claraspital schrieb. Da schon während der Proben klar war, dass Kohlers Inszenierung wegen der Corona-Pandemie nicht zu einer Premiere vor Publikum kommen würde, entschied sich das Produktionsteam einen nur 77 Minuten langen Theaterfilm zu drehen, einen sogenannten Tonfilm nach Wolfgang Borchert.
*
Draußen vor der Tür traf nach dem Zweiten Weltkrieg in den damaligen Westzonen einen Nerv der Zeit. Viele ehemalige deutsche Kriegsteilnehmer erkannten im Heimkehrer Beckmann ihr eigenes Schicksal, nicht mehr richtig heimisch zu werden, „...weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür.“ Borcherts Stück stellt auch laut anklagend die Frage nach der Verantwortung, die der Unteroffizier einem ehemaligen Vorgesetzten im Russlandfeldzug dann auch zurückgeben will. Die Frage nach der eigenen Verantwortung des kleinen Landsers kommt dabei aber etwas zu kurz bzw. wird gar nicht erst gestellt. Vage Bezüge zum Holocaust, die anfänglich in ersten Publikationen des Stücks und in einem Hörspiel sogar gestrichen waren, lassen aber Borcherts innere Auseinandersetzung mit dem Thema erkennen. Als Antikriegsstück erlebte Draußen vor der Tür zumindest in der ehemaligen Bundesrepublik immer mal wieder eine Renaissance.
Nun ist Borcherts Stück sicher weit davon entfernt, der Entschuldung einer ganzen Nation das Wort zu reden, und obwohl es ein recht universelles Bild des traumatisierten Kriegsheimkehrers zeigt, ist es in seiner expressionistischen Sprache und seinem zuweilen stark larmoyanten Ton so heute kaum noch zeitgemäß. Dass muss auch dem Produktionsteam klar gewesen sein, obwohl, wie die Dramaturgin Eva Bormann in einem Einführungstext auf der Website des Theaters betont, man sich bewusst gegen Fremdexte entschieden hat. Regisseur Volker Lösch hatte z.B. in seiner Inszenierung 2013 für die Berliner Schaubühne einen Chor von mehreren Beckmann-Darstellern auch Texte aus dem Buch Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben von Sönke Neitzel und Harald Welzer sprechen lassen. Diese Protokolle dokumentieren abgehörte Gespräche zwischen deutschen Kriegsgefangenen in Lagern der Amerikaner und Briten und zeichnen ein ganz anderes Bild des deutschen Landsers. Das kam zuweilen aber auch recht plakativ auf schwarz-rot-goldenem Fahnengrund daher.
Kohler lässt seinem kurzen Prolog, in dem der alte ehemalige Wehrmachtssoldat Gerhard Gläser, mit 102 Jahre einer der wohl letzten noch lebenden aktiven deutschen Kriegsteilnehmer, von ihn immer wieder in seinen Träumen ereilenden Erinnerungen erzählt, dann nur noch originalen Borchert folgen, wenn auch in zum Teil stark gekürzter Form. Zischen der schwäbischen Alb mit den Träumen Gläsers und dem Albtraum Beckmanns in Borcherts Stück liegt nur ein kurzer Gang der Schauspielerin Isabel Tetzner vom mit Hakenkreuzfahnen überblendeten Weimarer Bahnhof, in die durch Corona entleerte Innenstadt zu ihrer Wohnung und weiter ins Weimarer Theaterhaus. Der Film zeigt sie beim Lesen des Stücks in einer Taschenbuchausgabe.
Tetzner spielt die Rolle der Anderen. In Borcherts Stück der Schatten Beckmanns, eine innere Gegenstimme, die den Verzweifelten immer wieder vom Selbstmord abringen will und von der Zukunft spricht. Ein Loslassen der Vergangenheit. Mag sein auch ein Verweis in die Gegenwart, in der es so manches gerade wieder aktuell zur deutschen Erinnerungskultur zu sagen gäbe. Gerhard Gläser spricht einmal von der Hoffnung auf Erlösung und einer Dankbarkeit, wissentlich niemanden getötet zu haben. Ein wenig lässt einen das in Bezug auf die nachfolgenden Generationen auch an den bekannten Kohl-Spruch von der Gnade der späten Geburt denken.
Auf der fast leeren Bühne angekommen, wechselt der Film in Schwarz-Weiß-Bilder und somit in die düstere expressionistische Ästhetik Borcherts. Fast surreal lässt Kohler den Tod und lieben Gott als Mantelgestalten ohne Kopf auftreten, die anderen Figuren aus Borcherts Stationendrama wie das Mädchen, die Elbe (beide Anna Windmüller), der Einbeinige und der Oberst (beide Bernd Lange) tragen tief dunkle Schminke auf weißem Gesicht. Expressionistisch anmutende Totenmasken gegenüber denen Janus Torp als Beckmann immer wieder seine Verzweiflung herausschreit. Musikalisch begleitet wird die Inszenierung vom Gitarristen Christoph Bernewitz.
Stummfilm meets Tonfilm, nur einmal unterbrochen durch einen Gang von Janus Torp und Isabel Tetzner aus dem Theater in Tetzners Wohnung, wo sich aber auch kein Dialog zwischen den beiden entwickelt. Torp spielt nachts einsam Ballergames und zieht am Morgen suchend von Tür zu Tür. Ein wenig ratlos lässt einen das vor den stilistisch recht ansprechend komponierten Filmbildern zurück. Regisseur Kohler benutzt die Kamera geschickt als gestaltendes Mittel im Wechsel von Nahaufnahmen und aus den Szenen herausgezoomten Tableaus. In mit Kapitelüberschriften getrennten kammerspielartigen Szenen stolpert Beckmann von einer Station zur nächsten. Seiner Traumbeschreibung von einem auf Menschenknochen Xylophon spielenden General mit Armprothesen folgen weitere surreale Albtraumszenen, in denen Janus Torp ziellos durch den Fundus des Theaters irrt, schließlich seine große Anklagerede vor dem „lieben Gott“ hält und vergeblich nach Antwort verlangt. Eine Inszenierung, die nicht wirklich zum Punkt kommt und mit einem verschneiten, symbolbeladenen Hundeblick auf das Tor der KZ-Gedenkstätte Buchenwald endet.
|
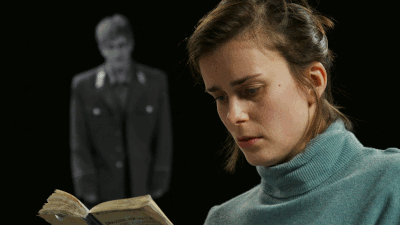
Draußen vor der Tür als Tonfilm (des DNT Weimar) | Videostill: Christoph Hertel
|
Stefan Bock - 29. März 2021
ID 12840
DRAUSSEN VOR DER TÜR
Ein Tonfilm nach Wolfgang Borchert
Regie & Bühne: Marcel Kohler
Künstlerische Mitarbeit Bühne: Martin Oppel
Kostüme: Natalie Soroko
Komposition und Musik: Christoph Bernewitz
Kamera/Schnitt: Christoph Hertel
Dramaturgie: Eva Bormann
Dokumentation: Dr. Oliver Kohler
Mit: Janus Torp (Beckmann), Bernd Lange (Gott / der Einbeinige / Oberst), Isabel Tetzner (Die Andere), Anna Windmüller (Tod / die Elbe / das Mädchen / Frau Kramer) und Gerhard Gläser (Mann im Prolog)
Online-Premiere: 25. März 2021
Der Film ist bis 22. April 2021 online kostenfrei abrufbar.
Weitere Infos siehe auch: https://www.nationaltheater-weimar.de
Post an Stefan Bock
Freie Szene
Live-Streams
Neue Stücke
Premieren
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:

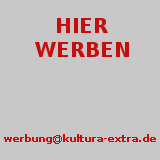
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE
URAUFFÜHRUNGEN

= nicht zu toppen

= schon gut
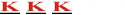
= geht so

= na ja

= katastrophal
|