Der Verrat
an Nono und
Churchill
|

La fabbrica illuminata von Luigi Nono - am Theater Freiburg | Foto (C) Britt Schilling
|
Bewertung: 
La fabbrica illuminata von Luigi Nono ist eine rund viertelstündige Komposition für Stimme und Tonband. Sie handelt kritisch von den menschenfeindlichen Zuständen in einer Fabrik. Die auf Tonband aufgenommenen Originalgeräusche aus der Fabrik bilden eine Einheit mit dem von einer Sopranstimme live gesungenen Kommentar.
In einem auch im Programmheft nachgedruckten Gespräch mit dem Musikkritiker Hartmut Lück, einem der großen Bewunderer Nonos neben dem zwei Jahre jüngeren Konrad Boehmer, sagte der Komponist 1972:
„Dies war mein zweites elektronisches Stück nach ‚Omaggio a Vedova‘, und ich habe hier die serielle Technik meiner früheren Instrumentalwerke mit anderen kompositorischen Prinzipien weiterentwickelt: ich habe Stück für Stück studiert, die harmonische Struktur, die melodischen Momente, die Beziehungen zwischen Text und Klang, die Beziehung zwischen sprachlichem und elektronischem Material; d. h. es gab keine vorbereitete Organisation, sondern die Komposition ist entstanden durch dieses Material und durch die kompositorischen Prinzipien, die dieses Material verlangt und nötig hat.“
La fabbrica illuminata, die der italienische Rundfunk für das Eröffnungskonzert des Prix d’Italie in Auftrag gegeben hatte, dann aber mit einem Aufführungsverbot im vorgesehenen Rahmen belegte, wurde am 8. November 1964 bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt uraufgeführt. Es handelt sich also nicht von vornherein um einen szenischen Entwurf. Für das Theater muss sich eine Regie dazu etwas einfallen lassen. Versuche gab es bereits in Venedig, Weimar oder Dessau. Allerdings bemerkte schon Carla Henius, für die Nono den Solopart geschrieben hatte, in ihren Arbeitsnotizen: „Es ist wie ein großer Schauspielmonolog, eine ‚Szene‘ eher als ein Konzertstück.“
In Freiburg demonstriert Joscha Zmarzlik, von Haus aus ein Bariton, wie man aus einer 17-Minuten-Vorlage eine 70-Minuten-Performance macht und jene dadurch marginalisiert. Er hat nicht nur eigenen Text hinzugefügt und Regie geführt, sondern tritt als rotgefärbtes Phantom mit den Attributen eines Stahlarbeiters inklusive Gasmaske und Infusionsstativ auch auf. Zmarzlik vermanscht den Prometheus-Mythos mit Aufsagetheater über eine Fabrik in Taranto. Das Hybrid heißt jetzt dreisprachig La Fabbrica Illuminata oder Prometheus Goes Taranto.
Volpi hin, Goecke her – alles wäre mir lieber als die stümperhaften Tanzeinlagen, mit denen Theaterstücke zurzeit, so auch hier, bereichert werden. Zmarzlik badet im Dreiklang und beleidigt damit Luigi Nono, nimmt dessen künstlerische Revolution auf tragische Weise zurück. Das ist kein Fortschritt, sondern Verrat an einer historisch gewordenen Avantgarde, Spielwiese statt Interpretation eines (musikalischen) Werks, das mit dem Stichwort „Fabrik“ nicht abgedeckt ist. Was Zmarzlik offenbar nicht begriffen hat, ist bei der Sängerin Inga Schäfer gut aufgehoben. Sie wird Nono gerecht.
*
Die zum Bühnenstück erweiterte Komposition von Luigi Nono wird in Freiburg im Breisgau, originell, lose verknüpft lediglich durch die Fabriks-Thematik, mit Caryl Churchills entgegen der Ankündigung vorangestelltem Stück Far Away aus dem Jahr 2000 kombiniert, dessen deutschsprachige Erstaufführung unter dem Titel In weiter Ferne knapp ein halbes Jahr nach der Londoner Uraufführung an der Schaubühne am Lehniner Platz von Falk Richter inszeniert wurde. Der Untertitel "Ein infernalischer Doppelabend", den das Theater Freiburg dem Projekt gab, ist eher läppisch als informativ. Infernalisch, also höllisch oder teuflisch, ist er ebenso wenig wie die kapitalistische Realität, die er zum Thema hat. Sie ist menschengemacht.
Caryl Churchill gehörte in den siebziger und achtziger Jahren zu den international viel gespielten Dramatikern. Cloud Nine und Top Girls wurden seinerzeit landauf landab gezeigt. Wenn nicht alles täuscht, ist es in Deutschland eher still geworden um die mittlerweile 86-jährige Autorin. Ob das an dem fragwürdigen Antisemitismus-Vorwurf liegt, dessentwegen ihr der bereits zugesprochene Europäische Dramatiker:innen Preis aberkannt wurde? Es gibt nicht viele Kandidatinnen, die ihn so zu Recht verdienten wie sie. Wer lesen kann, wird eingestehen müssen, dass sich ihre Äußerungen zum Konflikt im Nahen Osten und ihr Stück Seven Jewish Children heute mehr denn je als berechtigt erweisen. Wenn selbst der Bundeskanzler plötzlich bekennt, er verstehe „offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel“ Israel gegen den Gazastreifen vorgehe, dann könnte auch die Jury eines Literaturpreises ihre nachgereichte Entscheidung überdenken.
Far Away ist ein rätselhaftes Stück. Was hier gewiss poetisch ist, wirkt zugleich vage. Zwei Frauen, eine ältere, scheinbar Vernünftige und eine jüngere, Kindliche. Draußen, im Dunkel, hat sich eine Handlung abgespielt, deren Geheimnis sich nach und nach enthüllt: Ein Lastwagen war vorgefahren, auf dem Boden fand sich Blut. Wird da Verfolgten zur Flucht verholfen? Oder werden sie misshandelt? Die Szene bricht ab, ehe wir Genaueres wissen.
Jetzt sehen wir das Mädchen von vorhin mit einem jungen Mann. Die Beiden modellieren Hüte für eine Parade und flirten dabei ein wenig. Eine Parodie auf Modeschauen? Eine Anspielung auf den Hutmacher aus Alice im Wunderland? Statisten kommen ziemlich mechanisch von der Seite her in die Bühnenmitte, um einfache Handgriffe zu absolvieren. Bei Churchill tragen sie verschmutzte Unterwäsche und hoch aufragende Fantasiehüte. In Freiburg wird das allenfalls angedeutet.
Die dritte Szene spielt Jahre später. Der Mann aus dem Mittelakt, er heißt Todd, schleppt das halbtote Mädchen, Joan, zu der Frau, die wir aus dem ersten Teil kennen: Harper. Ihre Dialoge werden noch dunkler, noch unverständlicher. Far Away ist ein surrealer Alptraum von zunehmender Bedrohung und Verfolgung. Noch nicht im Nahen Osten nur, sondern auf der ganzen Welt.
Modernes Theater at it’s best. Nicht gut genug für den Europäischen Dramatiker:innen Preis? Der Kritiker Christian Gampert, der die Nicht-Vergabe verteidigt, aber nicht damit begründen will, dass er sich gerne nach Israel einladen lässt (die Palästinenser haben andere Sorgen, als einen Betriebsausflug deutscher Journalisten zu organisieren), weicht aus: Seit vielen Jahren habe Churchill nichts mehr vorgelegt, was wirklich Substanz habe. Letztlich sei ihr Theater nur „Vehikel, um politische Haltungen zu transportieren“. Das sei im Theater nicht genug. „Es reicht also auch rein künstlerisch nicht für diesen Preis.“ So? Gilt das auch für Elfriede Jelinek? Wohl nicht. Sie eignet sich nicht dafür, das schlechte Gewissen vieler Deutscher gegenüber den Juden zu entlasten, und sei es auf Kosten der Kinder von Gaza. Als seien sie, anders als die Israelis für Netanyahu, für die Hamas verantwortlich. Die Frage der Kollektivschuld stellt sich neu, nicht nur in Bezug auf jene, die Hitler folgten oder zumindest duldeten. Netanyahu ist es gelungen, aus einem Kollektiv von Opfern in den Augen vieler Menschen in der ganzen Welt ein Kollektiv von Tätern zu machen. Ob das den Juden nützt? Und das hat nicht mit dem 7. Oktober 2023 angefangen. Wer über Ursache und Wirkung schwadroniert und diese mit jener rechtfertigt, muss zumindest auch von Sabra und Schatila und sogar von der Balfour-Deklaration sprechen. Denn eins steht fest: Der Holocaust geht nicht auf das Konto der Palästinenser, auch nicht der Hamas. Würde man argumentieren, wie es viele heute tun, wenn nicht sie, sondern die Nachkommen der tatsächlich am Genozid an den Juden Schuldigen und Mitschuldigen getötet würden, mit Raketen und Bomben auf Bayern, Mecklenburg oder Oberösterreich? Um es unverblümt zu sagen: So wenig die Juden selbst schuld sind am ewigen Antisemitismus, so sehr hat die gegenwärtige Politik Israels ihren Anteil an dessen aktueller Zunahme, wie Putin dafür verantwortlich ist, dass beim Stichwort „Russen“ mehr und mehr eher an Krieg gedacht wird als an Tolstois Krieg und Frieden. Und das umso penetranter, je stärker Juden in der Diaspora meinen, für Israel, komme was da wolle, Partei ergreifen zu müssen wie verbohrte Amerikaner für Donald Trump. Nationalismus, der sich hinter Vaterlandsliebe oder Zuneigung für „die eigenen Leut’“ verbirgt, ist ekelhaft. Immer und überall. Und wo von Prävention die Rede ist, sollte man aufhorchen. Wer will und wie beweisen, dass sie berechtigt und notwendig und nicht bloß eine Ausrede für einen Angriff sei? Wenn Caryl Churchill so oder so ähnlich denkt, hat sie jeden Preis der Welt verdient.
Dass Far Away in Freiburg dennoch zäh ausfällt, liegt daran, dass der junge Regisseur Dario Fini für die Dialoge des handlungsfreien Stücks, zumal im Mittelakt, keinen Rhythmus findet. Eine verpasste Chance.
|

Far Away von Charyl Churchill - am Theater Freiburg | Foto (C) Britt Schilling
|
P.S.: Noch unverschämter als Joscha Zmarzlik mit Nono verfährt die Gastronomie des Theaters mit dem Publikum. Für ein kleines Glas Orangensaftschorle verlangt das Buffet 5 Euro!
|
Thomas Rothschild – 15. Juni 2025
ID 15305
LA FABBRICA ILLUMINATA ODER PROMETHEUS GOES TARANTO/ FAR AWAY (IN WEITER FERNE) | Kleines Haus, 14.06.2025
Regie La Fabbrica Illuminata: Joscha Zmarzlik
Regie Far Away: Dario Fini
Bühne: Isabell Pollmann
Kostüme: Lea Montalbetti
Licht: Wilfried Hoffmann
Dramaturgie: Charlotte Maskelony, Tamina Theiß und Laura Ellersdorfer
Mit: Joscha Zmarzlik, , Inga Schäfer, Marvin Müller, Johanna El-Ghussein, Kateryna Nemchenko, Ingrid Frey, Anuk Oltersdorf, Alina Windt, Johannes Rietmann, Sebastian Dufner, Raban Bieling, Clara Schulze-Wegener, Marieke Kregel, Paulin Fisch, Eva Noble, Swantje Mikara, Kateryna Ivanchenko, Fatima Röseler und Julius Pinsdorf
Premiere am Theater Freiburg: 14. Juni 2025.
Weitere Termine: 21., 29.06./ 12., 13.07.2025
Weitere Infos siehe auch: https://theater.freiburg.de
Post an Dr. Thomas Rothschild
Operm-Opernpremieren
Theaterpremieren
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:
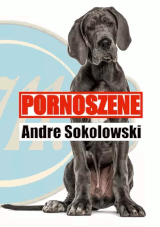
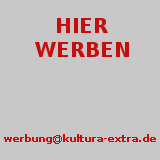
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE
URAUFFÜHRUNGEN

= nicht zu toppen

= schon gut
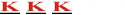
= geht so

= na ja

= katastrophal
|