Kunst ist, wenn „es um Leben und Tod geht“
Nikolaus Harnoncourt starb gestern im Alter von 86 Jahren
|

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) | Foto (C) Marco Borggreve / Bildquelle: warnerclassics.de
|
„Als ich zum zwanzigsten Mal die g-Moll-Symphonie von Mozart spielte, und die Leute begannen zu lächeln und im vermeintlich richtigen Takt den Kopf zu wiegen, da wurde mir grausam zu Mute. Ich bekam einen heiligen Zorn auf den Dirigenten, der das Werk so spielte, dass derlei möglich wurde, obwohl das die tragischste Musik überhaupt ist, wo es um Leben und Tod geht.“
Wenn es einen Musiker in unserer Zeit gab, der eine in der Tat anti-bürgerliche, anti-elitäre und existentielle Herangehensweise in die Musikwelt der Klassik einbrachte und diese mit seiner kritisch-historischen Methode revolutionierte, auf dass nichts mehr ist, wie es zuvor war, so der 1929 in Berlin geborene, aber in Graz aufgewachsene Nikolaus Harnoncourt. Nun ist dieser Gigant des Musizierens gestorben.
Dem Vorwurf, bei ihm klänge Mozart immer so, „als sei sonst was passiert“, konterte er: „Es ist ja auch sonst was passiert!“ – Oder: „Unfälle sind das einzig Interessante im Leben.“ – Und in der Tat, wer einen beruhigten Hochglanz-Mozart, süßliches Rokoko zu Dessert und Feierstunde erwartete, wurde von Harnoncourt garantiert ent-täuscht. Immer sind bei ihm die Impulse für Musizieren inhaltlicher Natur, er arbeitet kontrastreich und plastisch gerade die Widersprüche heraus, setzt Glanz, Energie und übergeht keinen komischen Moment, birst von Humor und Freude! Es geht wirklich um „Ereignisse“, um das, WAS sich da ereignet: um Erfahrung. Die großen Meisterwerke sind nicht bloße Belege handwerklichen Könnens und eines irgendwie „schlechthinnig“ Schön- oder Gutseins, sondern, wie alle Kunst, ein subjektiver Ausdruck von Auseinandersetzungen existentieller Art, Auseinandersetzungen mit dem Objektiven. Arnold Schoenberg meinte treffend: „Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen!“
Ein Musikkritiker schrieb entsprechender Weise: „Harnoncourts Mozart ballt die Faust und hält wenig Galantes bereit“; nun, das ist einseitig und wird dem Künstler keineswegs gerecht. Das dramatische Interesse gewinnt bei Mozart eine Art universale Dimension, indem er die Konflikte dialektisch beschreibt und durchspielt, ob in seinen Arien, Fugen, Sonatenhauptsätzen oder Satzfolgen. Insofern ist es schlüssig, Mozart, wie es auch ein Peter Hacks nachdrücklich und wiederholt tut, mit Shakespeare, Goethe oder Hegel immer wieder in Bezug zu setzen (die beiden Letzteren beziehen sich selbst auf Mozart). Und insofern ist es schlüssig, wenn Harnoncourt generell alle Werke Mozarts, auch die rein instrumentalen, unter dem dramatischen, d.h. dialogischen und dialektischen Aspekt angegangen ist. „Jede Kunst ist Sprache“, hat er gesagt und das mit jeder seiner Aufführungen voller Vitalität bewiesen.
So versteht und durchforscht Harnoncourt die Partituren als Aussagen und Erzählungen von menschlichem Da-Sein, immer von neuem auf der Suche, warum es so ist wie es ist. Musikrevolutionär wirkte und wirkt in diesem Sinn seine nun schon klassische Textsammlung Musik als Klangrede, Musik also als Text, Gesang als Kommunikationsform, als Sinnträger – aber eben musikalisch, das heißt: als ein Nicht-anders-Formulierbares, quasi als So-Gemusstes. Er hat das für die von ihm interpretierten Werke nachgewiesen. Auch das Abstrakte ist ein „Text“, auch das Namenlose hat einen erfahrbaren Sinn… Er ruft den Musikern zu: „Sie müssen da scheitern. Das geht gar nicht anders. Das hat der Beethoven mitkomponiert, das Scheitern.“ Und: „Das darf überhaupt nicht mehr nach Musik klingen.“
Entsprechend reagierte das eingefleischte Klassik-Publikum ablehnend bis höhnisch auf die ersten Darbietungen Alter Musik in historisierender Aufführungspraxis, mit der Harnoncourt und seine Mitstreiter dem glättend romantischen Einheitsschönklang entgegentraten, um den vitalen Reichtum der Farben und Ausdrucksskalen dieser quasi verschütteten Musik wieder neu aufzuspüren. Es war ein alternatives Musizieren mit originalen Instrumenten, und neben Knabenchören sangen in den Altpartien Counter-Tenöre, erschütterten im seriösen Konzertleben die Klischees von Geschlecht und Rolle und öffneten es neuen Sichten, wie Vieles in der Ära der Studentenrevolten und Kommunen nach neuem Sinn und dem eigentlichen WARUM? fragte. So überrascht nicht, wenn noch 1988 anlässlich eines Mozart-Konzerts am Abend vor der Eröffnung der Salzburger Festspiele (der Domäne Karajans und seiner Kulturschickeria) dem Auftritt von Harnoncourt mit Friedrich Gulda so bösartige Kampagnen vorausgingen, dass der berühmte Pianist alle Termine für die eigentlichen Festspiele in Solidarität mit dem Dirigenten absagte.
Harnoncourt bekannte gegenüber Jürgen Otten (Frankfurter Rundschau): „Mein Blick ist künstlerisch kein rückwärts gewandter. In meiner Musik bin ich nur Jetzt und Morgen.“ Eine Art von kreativer Archäologie, modern, jedoch Karriere- und Modetrends zuwider laufend, unhierarchisch, kollektiv, kollegial noch mit den einfachsten der Menschen. Im erwähnten Interview sagte Harnoncourt 2009: „Das ist ein Teil der Botschaft. In dem Moment, wo ich die Sprache kenne, bin ich einige Schalen tiefer eingedrungen, ich erfahre Dinge, die derjenige, der einfach nur die Oberfläche anschaut, nie erfahren wird – was ein trauriger Aspekt in der Kunst ist. Jemand, der die Grammatik nicht beherrscht, wird sich womöglich schwerlich erschüttern oder bis ins Innerste aufreißen lassen können. Aber es gibt gewiss ebenso eine direkte emotionale Erfahrung, die ohne Wissen auskommt.“
Umso bitterer ist, dass sich die linke Szene offenbar von der Bourgeoisie die Hochkultur als „elitär“ vorenthalten lässt und das Vorurteil, den Kulturraub, den die herrschende Klasse an den Massen vollzieht, erfüllt, indem sie die zugeteilte Rolle identifikatorisch übernimmt. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg war die Arbeiterklasse von Wissbegier und kulturellem Hunger erfüllt, gründete Arbeiterbildungsvereine, die Volksbühnenbewegung (der Berlin die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz verdankt) und Arbeiterchöre, die einst ein Hermann Scherchen, selbst Berliner Arbeiterkind, leitete, und wahrlich nicht nur um Beethovens „Neunte“ aufzuführen, sondern z.B. auch Händel-Oratorien. Gerade für die zunehmend und besonders kulturell und sozial Entrechteten ist Kultur wichtig, wäre besonders ein Harnoncourt relevant. Der merkte in einer österreichischen Tageszeitung an:
„Heutige Bildungspolitiker kennen nur ein Ziel: den funktionierenden Menschen. Es geht darum, Kinder zu besseren Ameisen heranzuziehen. In der ganzen Welt geht es nur noch um Produktionsprozesse, die Finanzwirtschaft hat die Herrschaft erobert, und die PISA-Studie ist ihr Instrument. Ich halte das für verbrecherisch. Dass die Kultur in diesem System keinen Platz mehr hat, überrascht mich nicht.“
Selbst einen wie ihn nicht!
Nein, ich mag hier nicht die biografische Würdigung liefern, die überall zu finden sein wird, Harnoncourt ist bedeutend genug; nein, ich möchte diesen Nachruf mit ein paar persönlichen Impressionen ausklingen lassen.
Ende der 70er antwortete der Chef der VEB Deutsche Schallplatten, Hansjürgen Schaefer, auf eine Anfrage meinerseits: man würde in der DDR die „Harnoncourt-Welle“ nicht mitmachen (anstatt etwa: die Lizenzbedingungen sind zu ungünstig o.ä.). Schon 1984 jedoch nahm Harnoncourt in der Dresdner Lukaskirche für eben dieses Label zwei Orchester-Serenaden Mozarts mit der Staatskapelle Dresden auf, und ein Hansjürgen Schaefer war just Autor der Einführungstexte auf dem Plattencover, wo er des Dirigenten Kunst hoch pries.
So kannte ich Harnoncourts Wirken zunächst aus dem Radio, wo ich allsonntäglich vormittags vor dem UKW-Empfänger stand und am Knopf drehte, bis ich die Wellen mit der Sonntags-Bach-Kantate zu empfangen vermochte… Dieser Bach klang seltsam fremd und aufgeweckt, geradezu rau, das fesselte mich. Und dass neben den Knaben da offenbar Männer mit hohen Stimmen die Alt-Partien sangen. (Natürlich ließ ich mir bald seine unglaubliche Matthäus-Passion in einer wunderbaren Schallplatten-Box schenken und kaufte mir später das komplette Kantatenwerk auf CDs). Paul Esswood war so mein erster „Counter-Tenor“, den ich hörte. Doch dann kam damals im Fernsehen ein Ausschnitt von den Wiener Festwochen mit dem „Ritorno d´Ulisse in Patria“ von Claudio Monteverdi – und später ein so prägendes Schlüsselerlebnis wie der Zürcher Monteverdi-Zyklus mit allen drei Opern des Meisters: Harnoncourt dirigierte die fulminante Spiel- und Bilderwelt des Jean-Pierre Ponelle, deren theatralische Energie noch heute funkt – natürlich nicht zuletzt dank eines sagenhaften Sängerensembles. Ich weiß noch, wie wir zuhause an jedem dieser drei Abende gebannt vor dem Fernseher saßen und alles aufmerksam in uns einsogen!
Ähnlich charakteristisch etwa war ein unvergesslicher Abend in Berlin (nachdem ich Harnoncourt schon einige Male erlebt hatte), wo er mit den Philharmonikern und dem RIAS-Kammerchor Händels letztes großes Oratorium Jephtha aufführte. Nicht nur, dass es plötzlich den Anschein hatte, als spielten die Musiker doch auf historischen Instrumenten: aber die Art, wie der Maestro mit seinen Gesten und Blicken aus der Musik ein erschütterndes Drama modellierte, wie in den Arien und Chören Konflikte aufbrachen und die menschliche Tragödie sich zu schier antiken Ausmaßen steigerte – das habe ich nie wieder so erlebt. Andererseits war ja jedes Konzert mit Harnoncourt auf solche Weise paradigmatisch – und auch seine letzten anlässlich des 85. Geburtstages, als er noch einmal in Berlin auftreten wollte. Er krönte sein Lebenswerk mit dem Zyklus der drei letzten Mozart-Sinfonien, die er zurecht als Einheit erkannte und darbot – und mit Werken Schuberts: Rosamunde – und die sog. Unvollendete: all das existentiell, menschennotwendig, als Dinge „von Leben und Tod“.
In aller Trauer um den großen Künstler bleibt doch das Glück, sein Werk, wenn auch nie wieder live, so doch in seinen Aufnahmen nachhören zu können: das wird weiter klingen und die Menschen, die sich öffnen, bereichern und inspirieren… Aber auch Generationen von Musikern wirken weiter an der von ihm angeregten Art, Musik ins Heute und fürs Heute zu holen, denn wenn die „historisch informierte“ Aufführungspraxis eins mit Sicherheit nie war und ist, dann: historisch. Museale Aufführungen sind einfach schlechte, uninteressante. Musizieren heißt Gegenwart, heißt Leben.
Danke, Nikolaus Harnoncourt!
|

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) | Foto (C) Marco Borggreve / Bildquelle: warnerclassics.de
|
Olaf Brühl - 6. März 2016
ID 9187
Weitere Infos siehe auch: http://www.harnoncourt.info
Post an Olaf Brühl
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BAYREUTHER FESTSPIELE
CASTORFOPERN
CD / DVD
INTERVIEWS
KONZERTKRITIKEN
LEUTE MIT MUSIK
LIVE-STREAMS |
ONLINE
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
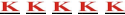
= nicht zu toppen

= schon gut
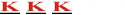
= geht so
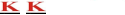
= na ja
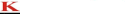
= katastrophal
|