HANS ZENDER
Cabaret Voltaire . Mnemosyne - Hölderlin lesen IV
|
Zu den Kompositionen Cabaret Voltaire und Mnemosyne – Hölderlin lesen von Hans Zender
Text: Gerald Pirner
Bilder: Rosmarie Burger
Sprechen aller Mitteilung verlustig, buchstäblich ins Material zurückgestürzt die Sprache, aus der kein Bedeuten mehr heraushilft – veräußerter Sinn als solcher in Beschwörungen und Ritual sinnlich inszeniert: Dadaismus als Geburt der Dichtung aus dem Geiste des Gesangs… Als auf ihrem Züricher Höhepunkt 1916 die dadaistische Weltzertrümmerung in Hugo Balls Lautgedichten sich und der Menschheit einen Gegenentwurf zu Massenmord und Gaskrieg zelebrierte, schrieb ein paar Häuser weiter, in der selben Straße und zur gleichen Zeit, ein russischer Revolutionär namens Lenin seine Imperialismusanalyse nieder: die Schrift, wie Brecht es später in Die Mutter singen lassen wird als „Lerne das ABC…. Du musst die Führung übernehmen!“ Ganz andere Gesänge an der anderen Ecke der Straße… Gehüllt in „kubistische Maske“ mit Pappschamanenhut versehen, Hugo Ball von Lautmaterial geschüttelt das, unter Rhythmen und Zuckungen des Körpers aus seinem Munde hervorbrechend, in magischer Liturgie er zu bändigen sucht… Was bei Ball noch programmatisch als Rückzug in die „innerste Alchemie des Wortes“ und dessen Wiedereinswerdung mit dem Ding begriffen, lebte hundert Jahre vorher ein anderer ganz leibhaftig und wurde daran wahnsinnig.
„Ein Zeichen sind wir, deutungslos,/Schmerzlos sind wir und haben fast/
Die Sprache in der Fremde verloren“ heißt es in den ersten Versen des Mnemosyne-Hymnus´ von Friedrich Hölderlin… Es ist als fürchte da einer seine eigene Schrift zu werden, lesbar zwar, nicht mehr jedoch von ihm selbst, verdinglicht in Gravur so als erstünde Mnemosyne als Erinnerung zukünftig, indem sie auf ihre andere Bedeutung verwiesen: das Grabmal, das Totengedenken, der Totenstein.
Ganz nahe zusammen rücken Cabaret Voltaire und Mnemosyne – Hölderlin lesen IVdes Komponisten Hans Zender diese fruchtbaren und zugleich furchtbaren Beziehungen des Schriftlichen und des Mündlichen, des Zeichenmaterials und des Gesangs, die jetzt vom Klangforum Wien und der Sängerin Salome Kammer für Kairos eingespielt.
|
Der Raum von Sprache und Musik
Ein kalter Tonstrahl, mikrotonal verschoben, als versuchte er von sich selbst loszukommen. Wenig später die umgekehrte Bewegung: eine schmal verflochtene Klangfläche, als suchte da etwas Halt im eigenen Schatten… Zenders Mnemosyne zu Beginn Klanggeschehen, das vom Streichquartett fast geometrisch aus einer Linie zu Fläche, zu Raum aufgeschlagen… Musik, von Zender in einem Vortrag einmal als „Darstellung von Zeit“ bezeichnet, scheint auch in Cabaret Voltaire in erster Bewegung ihrem Erscheinen erst einmal einen Ort ausspreizen zu müssen. In vertikalen Sprüngen fast kindlich gehüpft, versichert sich die Frauenstimme seiner Tragfähigkeit, während die Ensembleklänge eher flächig zunächst ins Geöffnete einfließen, um sich dann beginnend mit dem Klavier, vom Geflüster und Gezisch und dem Gepiepse der Stimme in der Höhe ermutigt, freier in kleinen Tonläufen zu bewegen. Dargestellte Zeit als Ereignis musikalischer Raumöffnung und der Klang darin in seiner Bewegung Halt und gehalten zugleich... In den Anfängen beider Kompositionen die Frage nach einem Außen gestellt, nach gegründet gründendem Verlass, aber auch nach Geschehen das immer zugleich präsentisch und vergangen… Vor allem aber die Frage nach der Tragfähigkeit des Wortes, die die Dichtung Balls genauso durchzieht wie Hölderlins Mnemosyne…
Von keinem Inhalt hintergehbar bedarf Sprache eines Raumes, in welchem der Sprechende ihr auch zu entkommen vermag. Wo nämlich Wort und Ding in Eins gefallen, läuft der Sprechende Gefahr, der Kraft ihrer Anziehung zu unterliegen und, selbst verdinglicht, in Türme wie dem Tübinger, der nach seinem Insassen Hölderlin benannt, weggesperrt zu werden.
Cabaret Voltaire
für Stimme und acht Instrumente
Balls Lautgedichte, zu buchstäblicher Blöße ausgetrocknete Zeichenspuren, von denen weder Aussage- noch Bedeutungsraum loskommt… Laute, Geräusche, Klang ihren Vortrag erzwingend, ihr Ausschreien, ihr Singen, ihr Geflüster, ihr Gestammel, und der der da liest vom Gelesenen wohl eher befallen, bedarf - entblößt allen Sinnes und Inhalts - der Maske, des Kostüms, der Dramaturgie, die seine Erscheinung, gleichsam von Außen zusammen ihm halten… An solcher „Außeninszenierung“ setzt Zenders Komposition an, konfrontiert die Wortdinghaftigkeit der Dichtung, die Ball als „Sprache an sich“ verstanden wissen wollte, mit Äußerungen von Stimme und Instrumenten, die sich ihrer bedienen, um klangräumliche Beziehungsgeflechte hörbare Zeit werden zu lassen.
Katzen und Pfauen: Kratzen und Streifen der Streicher in die Höhe geschoben, in weitem Glissandobogen vom Gesang zu Ton geführt, die Streicher übernehmen ihn, probieren ihn für sich aus ohne dass solch Klanggeschehen sich durchsetzte – erneut Geräusch, Schaben, metallenes Gekrächz, als hätte Ton wieder und wieder sich erst zu finden…
Die Frauenstimme in Karawane propagandahaft einpeitschend über einem Klanggewebe aus stereotyp wiederholten und immer in gleicher Weise auf- und abtransponierten Tonphrasen, jedem Instrument eine andere, und eine jede in einem anderen Rhythmus gespielt…
Gadji beri bimba: ein hoher Klavierton ununterbrochen und so schnell gespielt, dass er zwischen seinen Unter- und Obertönen kaum zu unterscheiden, der Rest des Ensembles von der Frauenstimme in den Rhythmus eines Hüpfspiels gerissen und auseinander getrieben von Clusterschlägen des Klaviers bis nach gesungenem Schrei, sich alles in Gestalt eines schnell improvisierten Walzers der Stimme erneut unterwirft…
|
Machtbeziehungen blitzen da auf, obschon in nichts von ihnen die Rede, in Seepferdchen und Flugfische etwa: Geflüster zwischen Gehässigkeit und Beschimpfung, vielleicht auch, dass von der Stimme zu etwas aufgerufen, angestachelt, angestiftet auf das die Instrumente verschüchtert reagieren… Inhaltslose Äußerungen zwar, alles andere jedoch als von Macht befreite ästhetische Gebiete. Die Stimme deklamierend deklarierend appellierend flüsternd schreiend in sich außer sich, immer aber wie belauert, und nicht nur von den Instrumentalklängen. Etwas Drittes ist da spürbar, das den Platz der Bedeutung eingenommen, etwas das Hugo Ball vielleicht ahnte, als er in seinem Tagebuch Flucht aus der Zeit von der „motorischen Gewalt“ der Masken sprach: „Die Masken verlangten einfach, dass ihre Träger sich zu einem absurd tragischen Tanz in Bewegung setzten“.
Totenklage
Welches Wort aber sollte einer Sprache geglaubt werden, die immer auch für Massenmord dienstbar? Konnte ein radikaler Angriff auf Militarismus, Nationalismus und Dummheit denn andere Form annehmen als totale Sprachzertrümmerung, wenn sie nicht vorab und erneut Macht und Willkür unterworfen sein wollte? Bevor also auf alten Autoritätsmief lediglich neue Utopien gepflanzt – und der Expressionismus war für die Dadaisten bereits eine solch bourgeoise Veranstaltung – hatten die dadaistischen „Auflösungskräfte“ (Raoul Hausmann) erst einmal alles zu zerstören. Denn wie gut solch idealistische Entwürfe auch gemeint sein mochten, in ihrer Sprachmitteilung erscheinen sie bereits von Anfang an verraten.
Deutlichst tritt solche Skepsis in Totenklage zutage – obschon 1916 auch viele Freunde Balls im Krieg ermordet, stimmte er in diesem Gedicht nicht in das verlogene Lamento der Journaille ein, die zur gleichen Zeit ja auch weiterhin im Sinne der Kriegstreiber einpeitschte.
Zenders Komposition Totenklage setzt diese absolute Distanz und Fremdheit in der Beziehung Frauenstimme/Ensemble um, ohne freilich, welchen Klangelementen auch immer, Rollen zuzuweisen oder sinnliches Geschehen in Sinn wegzusperren. Die Frauenstimme in kindlicher Neugierde beobachtend und beobachtet vom Ensemble, dem Klavier etwa, das fast schüchtern Akkorde vorschlagend sich aus diesen, ohne sie ausklingen zu lassen, ertappt zurückzieht… Dann gleichsam aus einer anderen Richtung ein neuer Versuch, das Schlagwerk dabei tiefdumpfe Mahnung, ohne dass klar, worauf diese gerichtet, Geklacker eingeworfen, gespenstisch kurz…
Die Frauenstimme Brust/Kopfstimm/Brüche, Intervalle austrällernd und so schnell, als wollte sie diese in Gleichzeitigkeit bringen. Was der Körper so kann ausprobiert, Kiefer hin- und hergeschoben, die Zunge raus und schnell zwischen den Lippen rauf und runter, dabei gehorcht was an Ton da so rauskommt. Konsonanten blank gehalten ein rrrrrrrrrrrr… Crescendoartig vom Ensemble Ton-, Klang- und Geräuschflächen eingeworfen, von einem Klavierakkord zum Verstummen gebracht und immer wieder Eingeworfenes und der Akkord und Schnitt, als glitte die Lautstärke sonst ins Unerträgliche, und in einem gesungenen Schrei alles aufgehört ohne etwas beendet zu haben…
|
Mnemosyne – Hölderlin lesen IV
für Frauenstimme, Streichquartett und Zuspielbänder
Erinnerung, niemals von Vergangenem sprechend, ist nicht minder gegenwärtig als die Gegenwart selbst, die sie gleichsam verdoppelt. In Mnemosyne eingeschrieben vermag „Vergangenes“ so es als nichtentfremdete Einheit gelesen – und Hölderlins Dichtung suchte einzig von solcher Lesbarkeit zu sprechen – zu einem ganz irdisch revolutionären Movens zu gerinnen, dessen Entsprechung der Dichter begeistert in der Französischen Revolution erkannt sehen wollte. Tiefste, in antiker und christlicher Symbolik sich bildfassende Religiosität, eingeschmolzen in ein philosophisches Konzept des „Göttlichen in uns“ als Liebe zum Anderen, fand in Leben und Dichtung Wirklichkeitshalt als gegen Unterdrückung und Entfremdung gerichtetes Politikverständnis. Wo aber solcher Art erhoffte Erlösung mit Napoleons Machtergreifung um ihre Realisierung betrogen, war es ganz der Sprache überlassen, die gleichzeitigen Gegenwarten der Mnemosyne auseinanderzuhalten, und Hölderlin tat es in gleichnamigem Gedicht indem er sie, formal zumindest getrennt, auf drei Strophen verteilte. Solcher Art der Sprache ausgeliefert, macht diese zu einer Gefahr, derer keine Form und schon gar nicht das Metrum mehr Herr zu werden versteht. Die ersten Verse des Gedichtes sprechen davon und sie gehören mit zu den letzten, die Hölderlin vor der eingemauerten Zeit des Turms schreiben sollte.
Von Mnemosyne scheinen allein die Schriftzüge übrig, und die Geschichte als Verwirklichung des göttlichen Erlösungsplanes zieht in Zeichen sich zurück, die zu enträtseln dem Dichter misslingt, so dass er unentrinnbar in die eigene Schrift stürzt, lesbar darin wohl, aber nicht mehr von ihm selbst.
Hölderlins Verse, von Zender wörtlich genommen – aus Worten und Syntax gebrochene Silben in gebetsartigem Sprechgesang wiederholt, bis zu Versen sie werden, deren gleichgebliebener Vortrag die Erinnerung an ihre Herkunft immer gegenwärtig hält… Die Streicher zupfend und im Laufe der Sprechgesangslitanei zu einem Schrittrhythmus findend, umso sicherer dieser, wenn später die Frauenstimme wiederholt sekundenweise hinuntersteigt: „Nämlich es reichen/ Die Sterblichen eh an den Abgrund“... Tontupfer in Menschenzeittakt oder als Schrittfolgen herab vom Gebirg´ - aus dem auch gestolpert und aufeinander gestoßen – lang ausgestrichenen Tonlinien gegenüber, die Zeitdauer von ihrer Messbarkeit unterschieden, und wo beides miteinander konfrontiert, diese Linie in vertikalen Tonstößen attackiert oder in gedehnten Glissandi von ihr wegzukommen gesucht, so als gälte es ein Gedächtnis loszuwerden… Zenders auskomponiertes Zerbrechen der Hölderlindichtung ruft den Bruch der Schrift an sich wach: die zerschmetterten Tafeln am Sinai, allein dass der Mensch selbst jetzt Schrift, er, der das Zerschmettern der Schrift einst verursacht…
Die zweite Strophe des Irdischen gedenkend – ruhig ausgestrichene Tonlinien zu Flächen, zu Raum, Sprünge in den Violinen, eine Heiterkeit, Lerchengirren zugemalt, im Sprechgesang die Verse wiederholt und Sprache erneut nur Zerfall, die Violinsprünge blanker Hohn… Mündlichkeit des Sprechgesangs „das Korsett von Rhythmus und Tonhöhen“ (Alban Berg) wiederholt das Geschriebene, im Zuspielband verdoppelt, satzlose Worte übereinander, so dass Rhythmus und Tonhöhen in ihrer Kontinuität allein bleiben, Korsett einer mit sich selbst verschichteten Erinnerung ganz dicht sie freilich, zugleich aber auch vollkommen leer…
Der Gesang, die Tochter der Mnemosyne das, was in der dritten Strophe zwischen Schreien und Flüstern Sprache zu Erzähltem führt… Die Streicher geräuschhafter Hauch, ein Wabern, das kein Wind ist, geschlagene Tritte, als wäre da kein Fleisch mehr, ein gesungenes Wort, dann wieder wie irr gewispert – und wenn endlich die Stimme aus den aufgescheuchten Streichern zu Gesang und Vers gefunden, wiederholt sie die sich verschiebende Linie des Anfangs… Entschlossen ist sie „aber er muss doch“ obschon sie nicht will, kündet sie doch nur den Tod und nach ihrem letzten Wort „Trauer“ reißt einfach alles ab… Das Geschriebene, das gesungen den Dichter einholt… Alle Schrift aber, wiederholt, zerbricht an sich, ist immer anders, reißt den, der sie geschrieben, mit sich – Zenders Musik scheint im Verweis auf Tradition auch hiervon zu sprechen, wenn sich etwa aus abstrakt Mikrotonalem für einen Moment Spätromantisches herausschiebt, das, wie aus der Ferne, an Schönbergs Verklärte Nacht erinnert.
|

Rosmarie Burger, Bleiches was ins Blau vordringt. 2002
|
Gerald Pirner - red / 5. September 2006
ID 00000002641
HANS ZENDER--Cabaret Voltaire . Mnemosyne
Salome Kammer voice
Klangforum Wien
Hans Zender
Includes booklet with text by John T. Hamilton
tracklisting:
Cabaret Voltaire * für Stimme und acht Instrumente nach Texten von Hugo Ball 21:01
1--Wolken 3:08
2--Katzen und Pfauen 2:59
3--Totenklage 5:08
4--Gadji beri bimba 2:01
5--Karawane 2:37
6--Seepferdchen und Flugfische 5.08
Mnemosyne - Hölderlin lesen IV * für Frauenstimme, Streichquartett und Zuspielbänder 33:20
7--1. Strophe 14:08
8--2. Strophe 8:36
9--3. Strophe 10:38
Weitere Infos siehe auch: http://www.klangforum.at/
und
http://www.kairos-music.com
|
|
|
Anzeigen:

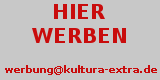
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CD / DVD
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
MUSIKFEST BERLIN
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE

= nicht zu toppen

= schon gut
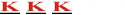
= geht so

= na ja

= katastrophal
|