Staatsoper Hamburg | April 2008
Die Frau ohne Schatten (6.4. 2008)
Daphne – konzertant (20.04. 2008)
Salome (26.4.2008)
|
| Von Salome zu Daphne – zum diesjährigen Schwerpunkt an der Staatsoper Hamburg
|
Lange Zeit stand die Auflistung der Defizite an dem anderen Kurs der nun ins vierte Jahr marschierenden Staatsopernintendantin Simone Young im Zentrum der Rezensionen. Sie sind schnell genannt: die Ignoranz des neueren und neuesten Musiktheaters, die unzähligen Pleiten bei dem Versuch zu dramaturgisch schlüssigen Regiehandschriften, die Verringerung der Premierenzahl und die Unfähigkeit jüngere Publikumsschichten an das Haus zu binden. Das heißt in toto: ein Verlust an Gegenwartsbezogenheit sämtlicher musiktheatralischen Kunstbemühungen. Neben diesen beharrlichen künstlerischen Mankos lassen sich zweifellos auch neue Konturen an der Staatsoper ausmachen, und zu solch Konturen ist doch einmal zu fragen, ob und wenn ja welche künstlerische Qualität sie denn haben?
Seitab spielzeitübergreifender Projekte wie der Britten-Zyklus, der in der kommenden Spielzeit seine Fortsetzung im „Tod in Venedig“ findet und der hinter der Oper Frankfurt munter um Ligaplatz zwei unter den Britten-Spielern konkurriert, oder einer wohlverstandenen Form der Wagner-Pflege, unterstrichen in einer neu in Szene gesetzten Tetralogie, die vor allem musikalisch überzeugt hat und sich sängerisch einmal mehr deutlich für das Ensemble-Format an der Dammtorstrasse ausgesprochen hat, seitab der programmatisch ausgeglichenen wie solistisch meist hochwertig besetzten Philharmonischen Konzerte in der Laeiszhalle, seitab der ständigen Präsenz der Musikdirektorin Young im Haus, ein Faktum, das unlängst für eine absolut verlässliche Qualität im Repertoire-Betrieb gesorgt hat – dem berühmt-berüchtigten Theater-Schlamp begegnet man in den Premieren durchweg häufiger als in einem „Don Giovanni“ oder einer „Tosca“ – seitab all dieser Charakteristika gibt es unter Young das stete Bemühen um einen Opern-Komponisten aus der Vergangenheit. Entweder werden die Herren, wie Mozart im Mozart-Jahr oder im kommenden Jahr Verdi, in bestimmten Wochen gefeiert oder zu ihnen bildet sich in einer Spielzeit ein Schwerpunkt aus. Youngs erster Spielzeit 2005/2006 unterstand dem Versuch, Paul Hindemith ins Licht zu rücken, der letztlich jedoch mit nur zwei Werken, „Mathis, der Maler“ und einer konzertanten „Sancta Susanna“ im Halbdunkeln verbleiben musste. In dieser Spielzeit hat es nun Richard Strauss geregnet. Von seinen 15 Opern kamen immerhin sechs zur Aufführung. Schaut man bei dieser Gelegenheit die Spielpläne von Dresden, München oder einem der letzten Strauss-Zyklaten, Stefan Soltesz in Essen, an, ist das ziemlich viel Strauss-Programm. Schon zu viel? Kann die Hamburger Staatsoper dabei dem Kern des Strauss’schen Musiktheater-Oeuvres – „Seine Musik ist nicht nur fürs Theater, sondern Theater selbst ...“? (Adorno) – gerecht werden?
|
Dramatisierter Mythos: Salome und Elektra
Die frühen musikdramatisch Einakter „Elektra“ und „Salome“ haben durch August Everding (1973) und Willy Decker (1995) eine jeweils hochwertige Realisierung gefunden und beide speichern spezifische Musiktheaterpraxen aus bestimmten Jahrzehnten. Decker mit seiner symbolistisch ritualisierten Glatzen-Salome überzeugt noch immer mit einer zwischen debiler Laszivität und keck-früchtchenhaftem Gehabe changierender Femme fatale, genau wie Deborah Polaski (Elektra) mit ihrem ausgestreckten Callas-Arm vor dem von Majewski konstruierten düsteren Turm Breughellands. Sowohl die Elektra als auch die Salome fanden in dieser Spielzeit authentische Verkörperung und äußerst ambitioniert sowie technisch versierte Ausgestaltungen. Dass man eine Salome nicht so schnell einstudieren kann, wusste schon Strauss. Umso beglückender, wie es der Staatsoper gelungen ist, Eva Johannson relativ kurzfristig für die verletzte Hellen Kwon zu engagieren. Letztere studierte diese Partie nunmehr seit gut einem Jahr ein. Entpuppt hat sich Johannsons als eine wahrhaftige Strauss-Heroine, die ihre Schwächen szenisch in Stärken umzumünzen versteht. Wahrlich klug hat sie sich diese dramatische Partie eingeteilt: Zu Beginn im Auftrittsdialog mit dem jungen entführten Prinzen und jetzigen Hauptmann Narraboth und dem Täufer agiert sie weitaus weniger ambitioniert und hat damit die alte Theatertugend, Je näher es dem Ende zugeht, umso besser muss alles kommen!, hervorragend beherzigt: Bis zur Schlussapotheose findet sie sich zu einer der großen Freikämpferinnen vor und in der Horizontalen gelangt sie zu einem ganz eigenen Piano-Ton für die seelische Selbstaussprache „von Vorgängen, die in das Gebiet der Sexualpathologie gehören“ (Der Wiener Zensor vom 31.10.1905). Im archaischen Pingpong von Libido und Destrudo, musikalisch in der Einschmelzung von Konsonanz und Dissonanz erweist sie sich als die von Strauss gewünschte „keusche Jungfrau, als orientalische Prinzessin“, die „in ihrem Scheitern an dem ihr entgegentretenden Wunder einer großen Welt“ „Mitleid“ erregt, anstatt nur „Schauer und Entsetzen“. Schauer und Entsetzen verschaffen einem der in Diktion und Ausdruck meisterhafte Mezzo Renate Spinglers und der als Charaktertenor immer noch schmucke Siegfried Jerusalem gemeinsam als das im Sinne des Asketen unzüchtig vermählte, sich weder ver- noch ausstehende Herrscherduo, deren Dekadenz-Dasein vollkommen kontrapunktisch zum Propheten verläuft. Der einzig „natürliche“ in dieser Inszenierung ist ja der Täufer selbst, den Wolfgang Koch nach seinen zuletzt so überaus überzeugenden Wagner-Auftritten sowohl einen weihevoll-pastosen als auch einen notwendig schroffen Propheten-Gestus zu verleihen vermag. Aus dem sonstigen Ensemble tut sich insbesondere Carsten Wittmoser als sanft-besonnener Nazarener hervor. Diese zwei Einakter wissen sich gegenüber den Neuproduktionen mehr als zu behaupten.
|
Gehobene Mittelklasse: Der Rosenkavalier und Die Frau ohne Schatten
Auch auf ARTE wurde unterdessen die Mäßigkeit der neuen Koproduktion zum Rosenkavalier in die EU getragen. So wurde dokumentiert, dass Melanie Diener als Marschallin einzig das Prädikat ‚besonders wertvoll’ beanspruchen kann. Daneben präsentierte sich die aufwendigere und von Keith Warner über zwei Drittel recht plausibel symbolistisch inszenierte „Frau ohne Schatten“ gegenüber der vergangenen Spielzeit in einem völlig neuen Stimmgewand und darüber hinaus mit verändertem Schluss. Statt Utopia à la Ursula von der Leyen treten die vier Versöhnten nun in einen hohen dunklen Raum zusammen und bringen dieses Märchen recht nüchtern und gleichsam konzertmäßig zu Ende. Eine Regie-Idee von der Güte, wie sie in Hamburg sonst wohl nur Kulturmanager konsequent verfolgen. Anders als im „Rosenkavalier“ mit seinen etlichen Rollendebütanten sind die gesanglichen Leistungen bei der „Frau ohne Schatten“ durchgebildeter und bewegen sich annähernd auf der Höhe der „Salome“ und „Elektra“: Selbst noch die einzige Ausgangsbesetzung aus der Premierenstaffel, Lisa Gasteen als Färberin; sie singt und spielt im Rahmen ihrer Möglichkeiten wie im letzten Jahr ansprechend und manchmal auch in der nötigen Wortdeutlichkeit. Höchste Gesangskultur demonstrieren Susan Anthony als Kaiserin und Janina Bächle als Amme. Frau Bächle hat gegenüber ihren Jahren an der Hannoveraner Bühne noch deutlich an Reife und Ausgeglichenheit gewonnen. Sie übersetzt diese obskure Keikobadjüngerin, die am Schluss verstoßen wird, mit rhythmischer Musikalität, warmer Dramatik und durchgeistigtem Gesamtarrangement. Neue Kaiserin ist Susan Anthony – altbekannt auf der Staatsopernbühne – singt sie in der gewohnten Synthese aus expressiver Power und deklamatorischen Raffinement. Sie verbirgt ihre beachtlichen lyrischen Qualitäten keineswegs, macht problemlos mal Koloraturwitzchen mit und nimmt große Intervallsprünge ohne zu reißen. Ebenfalls neu besetzt sind die Männerpartien, Franz Grundheber und Scott MacAllister als Barak und Kaiser: Grundheber ist in der Partie des Barak – übrigens der erste Öko auf der Opernbühne – vollkommen zu Hause. Und bekommt dafür honorigen und ausgiebigsten Beifall. Auf der Pausentreppe heißt’s ehrlich: „Schön, dass wir den Abend erwischt haben, wo der Grundheber singt.“ Scott MacAllister ist in der Partie des Kaisers noch nicht ganz so beheimatet wie bei seinen Wagnerpartien oder beim „Apollo“ aus der Daphne. Er betont stellenweise ein wenig unglücklich und im dritten Akt scheint es, als verdanke er es Young, dass er nicht gänzlich aus dem Tritt kommt. Aus dem sonstigen Ensemble ragt neben Benjamin Hulett (Erscheinung des Jünglings) vor allem Gabriele Rossmanith als Stimme des Falken heraus, die alles in allem eine auszeichnungswürdige Spielzeit hinlegt.
|
Versuche zum späten Strauss: Arabella und Daphne (konzertant)
Bei diesen beiden in kontrastbildenden Spätwerken von Richard Strauss erfahren wir hingegen, dass eine gut gesungene Daphne noch keineswegs eine gute Arabella garantiert. Und nur als Daphne konnte uns die dramatische Sopranistin Emily Magee durchweg überzeugen. Ihr Sopran hat eine natürliche Herbheit und Keuschheit und kommt damit der Natur statt Erossuchenden Daphne schon auf halbem Weg entgegen. Mit der anderen Hälfte, durch artikulatorischen wie koloraturtechnischen Scharfsinn (die Quelle tanzt, der Falter schlägt) und silbrig leuchtender, stehender Höhe, versetzt Magee das ungewohnt spärliche Daphne-Publikum in den prächtig komponierten Monologen zu wahrer Konzertbegeisterung hin. Zwischen Apoll und Leukippos sind die Rollen klar verteilt. Angesichts ihrer traumhaften Besetzung ist die ausgebliebene szenische Realisierung in der Tat unverzeihlich: Michael Schade demonstriert, noch etwas souveräner als auf der Einspielung unter Bychkov, eine breite Klangskala vom überraschenden Leerton über schmal-angezogene Erzürnung bis hin zu einem verliebt-verspielt-entäuschten und schließlich getöteten Sandkastenbruder Daphnes. Allein sein Tenor lässt einen künstlerisch hochwertigen „Tod in Venedig“ in der kommenden Spielzeit erwarten, zumindest wenn ihn das brittische, Trash-Culture verdächtige Regieteam nicht mit allzu viel Unfug ausstattet. Sein göttlicher Mörder Apollo, der von Scott MacAllister im Bullenfieber genauso anschaulich gemimt wird wie bei den anspruchsvollen dramatischen und lyrischen Anforderungen in dem ansonsten von Texter Joseph Gregor herrlich versemmelten Schlussmonolog. MacAllister überzeugt so sehr, dass man eigentlich ihn statt John Treleaven als Walther von Stolzing in der kommenden Meistersinger-Wiederaufnahme (zu Weihnachten 2008) wünschte. Flankiert wurde das Trio von dem sattelfesten Fischer Peneios Harald Stamms und der gesund-wohligen Erdanahen Gaea Marjana Lipovšeks. Man kommt bei diesen beiden Produktionen darüber ins philosophieren, welche eigentlich als die bessere Inszenierung gelten muss, die retrograde „Arabella“ ohne jeglichen Spielwitz oder ein vom Blatt gesungenes, konzertantes Daphne-Arrangement mit amüsantem Spontanspiel.
Der Hamburger Strauss-Klang: Elb-Karajanismo
Kommt man zu irgendeinem Hamburger Strauss, ist die Dirigentin gesetzt: Simone Young steht da – und ist auch immer da. Andere Frauen würde das lange Stehen schon allein aus varizenprophylaktischen Gründen vehement ablehnen; davon ist die Wagner- und Strauss-Enthusiastin jedoch weit entfernt. Nach vier-fünf Stunden Parsival oder Tristan kehrt sie regelmäßig wie neu geborenen auf die Bühne zurück. Neugeburten, sprich Ideen, sind ihre Klanginterpretationen durchweg, die sich bei ihr deutlich nach dem Werkcharakter ausrichten. Komischerweise erzielt sie von den sechs bestehenden in den aus der Vorzeit übernommenen Inszenierungen die höchsten und dichtesten Opernmomente. „Salome“ und „Elektra“ sind durchpulst und durchströmt von nervös konzentrierter Dramatik einerseits und polyphon verdichteter sinfonischer Gestaltung andererseits. Beides wird bei Young hörbar eingelöst – doch überwiegt letztlich immer der Stempel Schönklang und Betonung des Sinngeschehens. Etwas unterbestimmt bleibt ihr Interesse an kleinmotivischer Finesse. Bei „Salome“ galoppieren die sich teilweise bereits in die Vertikale legenden Minimotive nur mit gebremstem Schaum und man bekommt das Gefühl nicht los, als soll die retrograd komponierte parodistische Johannes-Musik hier tatsächlich schön sein. Indessen reichen „Arabella“ und „Rosenkavalier“ bislang über niveauvolle Ohren-Unterhaltung nicht hinaus. Beide Interpretationen könnten insbesondere an impressionistischem Raffinement in den nächsten Jahren noch deutlich zugewinnen. Bei der diesjährigen „Frau ohne Schatten“ ist Young dem am nächsten, was man auch von einer guten Einspielung erwarten dürfte: Berückend dumpfe Rhythmusfiguren, aufbrausende Drohgebärden, zartes Geäst, innere Ausgewogenheit des Klangs kombiniert mit einer versierten Ensemblekultur. „Daphne“ als Konzertoper, in einer scheinbaren Simplicitas und der auf Klanggestik, Gesangsfluss und solistische Brillanz (insbesondere der ersten Streicherpulte) abzielenden Einstudierung überzeugt, vor allem das Publikum.
Und zum Klang? Den Hamburger Strauss-Klang der Philharmoniker zeichnet seine spezifische Opulenz aus: sie ist indessen nie schmierig oder klebrig oder gar breit, sondern wird immer getragen wie ein vernünftiges Abendkleid, locker, sanft und edel. Ferner in einer offensiv vorgetragenen tonmalerischen Prägnanz, ja man kann sagen, es herrscht geradezu eine Akribie des musikdramatischen Klangsinns vor: Sturm mit Ausrufungszeichen, Getrappel mit Ausrufungszeichen, Bedrohung mit Ausrufungszeichen oder Musikgeheimnis mit Ausrufungszeichen. Das Ausrufungszeichen und das dezidierte Herauspräparieren auch von scheinbaren Nebenstellen ist bereits zum unterscheidungsfähigen Gestus des Young-Klangs geworden. Immer geht es – ganz nach dem eingangs zitierte Kern der Strauss’schen Musik – um theatralische Präsentation, ums Pragma, nicht ums Abstrakta. Ganz nach dem Strauss’schen Ideal, auf jegliches Ideal zu Gunsten des rein Seienden zu verzichten. Ganz zuletzt noch sagte der Alte ja zu einem Besucher: „Grüßen sie mir die Welt! Grüßen sie mir die Welt!“. Ein Ideal hört sich aber doch durch und das Ideal heißt Elb-Karajanismo.
Der Strauss-Klang geht insgesamt auf Geschmacksbestätigung, nicht auf Geschmackserziehung, auf Genuss, nicht auf Verstörung und auf Verdoppelung des Gemachten, nicht auf Kaschierung oder Retusche. Es soll hiermit kein neues Strauss-Bild gesucht werden, Strauss soll bewahrt werden, bewahrt gegenüber einem amnestischen kollektiven Gedächtnis, das vergessen hat, wer Meister ist und wer Knecht. Strauss selber interessierte der Pöbel bekanntlich erst, wenn er Publikum wurde. So war er freilich vor Nazis nicht gefeit. Heute ist der Pöbel meist chipsessendes Kino-, Fernseh- oder Radiopublikum, das Montags früh für den größten Unfug pünktlich anzutanzen hat. Die Oper scheint ihm teuer und weit weg und eine „Frau ohne Schatten“ wird selbst in der Hamburger Machart als wenig erholsam empfunden; es sei denn, man wäre vertraut mit diesem Werk – dann ersetzte allein eine Stimme wie die von Janina Bächle drei Wochen Kuraufenthalt in Karlsbad. Wenn also doch noch Leute von fern und nah extra zum Hamburger Strauss-Besuch anreisen, so hat es wohl genau etwas mit diesen in dieser Spielzeit so offen zu Tage tretenden besonderen Stimmen an der Hamburger Oper zu tun. Die Sänger und Sängerinnen an der Staatsoper bilden neben einer Intendantin, die glücklicherweise durch die USA-gebürtige und zuletzt das Freiburger Pult bestellenden Karen Kamensek in der kommenden Spielzeit eine Pult-Vertreterin auf Augenhöhe ans Haus dazu bekommt, zweifelsohne die neue Kontur; sie sind zu erwähnen, über sie wird weiter zu schreiben sein. Wie eingangs erwähnt, kann man und muss an der Hamburger Staatsoper künstlerisch-programmatisch trotz immer wieder exquisitester Programmheftartikel der nicht nur Straussexpertin Dr. Kerstin Schüssler-Bach vieles bemäkeln und vieles wird auch künftig schief hängen, selbst wenn „Harry“ (Young) in der nächsten Spielzeit anreist, um Frau Glawari lustig zu machen; eines wird man bei Young zu beobachten haben – für uns das bis dato entscheidende Element ihrer Intendanzzeit: Ihre stete Suche nach dem orphischen Urmelos der Werke. Das bleibt das ungenommen Spannende und ist bei jeder Aufführung mit ihr am Pult das, was Interesse und Inspiration weckt, was offene Ohren und Herzen hervorruft.
Zum Erfolg von Schwerpunktsetzungen
Woran bemisst sich nun der Erfolg eines solchen Strauss-Schwerpunkts? An äußerlichen Kriterien wie Zuschauerzahlen oder Applausverhalten? Meist war Strauss gut ausverkauft, am wenigsten noch bei der „Daphne“ und selbst eine „Frau ohne Schatten“ wird, anders als in New York, auch gut angenommen. Vielleicht bemisst sich Erfolg aber besser an künstlerischen Kriterien wie Ausdruck, Klang, Sinnhaltigkeit und Zeitgenossenschaft oder mehr noch an gesellschaftlichen wie Bildungsanforderungen der Gegenwart oder den realen Leidensbedingungen der Schwachen? Oder an Verdikten von in fast jedem Takt avancierteren Kollegen wie Schönberg: dieser meinte einst, dass er Einsicht in die Probleme und Techniken des Komponierens Zemlinsky verdanke und dass er, was ihm Strauss beigebracht habe, „Gott sei Dank“ vergessen habe. Vielleicht besteht aber doch ein Unterschied zwischen Lehrer Strauss und seiner Musik. Vor, ich glaube, drei oder vier Jahren hat der ehemalige Staatsopernintendant und Salzburger Kulturmanager und (Opern-)Komponist Peter Ruzicka verlauten lassen, dass Strauss zu denjenigen Komponisten gehöre, die ihrer vollen Entdeckung erst noch harrten. Wir denken, der Hamburger Schwerpunkt hat gezeigt, wie recht er damit hat. Auch und gerade weil Werke wie „Guntram“, „Feuersnot“ oder „Capriccio“ heuer unangetastet geblieben sind. Und Ruzicka erwähnte bei der Gelegenheit, dass ihn als Pubertierender in Wien die „Elektra“ vollständig auf die Seite der Bühnenmusik gezogen habe. Man wünschte in Anbetracht solcher Erfahrungen der Hamburger Staatsoper Mäzene, wie es das Oldenburgische Staatstheater vorzuweisen hat: Dort dürfen alle Zwölftklässler die Oper oder das Schauspiel oder das Ballett umsonst besuchen. Wir fänden das vorbildlich, beträfe es alle Achtzehnjährigen, auch und gerade diejenigen jungen Menschen mit und ohne Ausbildungsplatz. Denn nur im Strauss-Theater lässt sich die allemal zukunftsweisende wie aufgeklärte Strauss-Religion erlernen, deren erstes und einziges Gebot besagt, dass das Leben einzig dazu da ist, Kunst zu ermöglichen.
|
Wolfgang Hoops - red / 15. Juni 2008
ID 00000003890
Links zu weiteren Hamburger Strauss-Rezensionen:
http://www.kultura-extra.de/theater/feull/richard_strauss_frau_ohne_schatten_hamburger_staatsoper2007.php
http://www.kultura-extra.de/theater/feull/arabella_strauss_hamburg2008.php
http://www.kultura-extra.de/theater/feull/rosenkavalier_staatsoper_hamburg2007.php
http://www.kultura-extra.de/theater/feull/elektra_staatsoper_hamburg2007.php
Weitere Infos siehe auch: http://www.hamburgische-staatsoper.de/
|
|
|
Anzeigen:

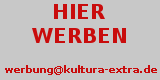
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CD / DVD
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
MUSIKFEST BERLIN
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE

= nicht zu toppen

= schon gut
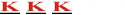
= geht so

= na ja

= katastrophal
|