Wenn das
Opernhaus
selbst zur
Bühne wird
|

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Deutschen Oper Berlin | Foto (Detail): Thomas Aurin
|
Bewertung: 
Was ist Oper im 21. Jahrhundert? Benedikt von Peter hat darauf eine radikale und sinnlich erfahrbare Antwort. Seine Inszenierung von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Deutschen Oper Berlin ist weit mehr als ein Musiktheaterabend. Sie ist ein Experiment, eine begehbare Versuchsanordnung, eine Einladung zur Reflexion – und zugleich eine Herausforderung an Publikum, Personal und Technik. Die Oper wird zur begehbaren Erfahrung, zum gesellschaftspolitischen Happening, zum dystopischen Spiegel einer Welt, die ihre Orientierung verloren hat.
Bereits beim Betreten des Hauses ist klar: Hier ist nichts wie gewohnt. In den Foyers hängen Menschen herum wie nach einer durchzechten Nacht, das große Parkett ist abgehängt, Bars sind geöffnet, ein Schild auf der Bühne verkündet: „Außer Betrieb“. Platzkarten gibt es keine. Wer sich dennoch einen Platz sucht, wird freundlich gebeten, sich zu bewegen – zu tanzen, zu beobachten, sich einzulassen. Die Frage stellt sich schnell: Hat die Aufführung bereits begonnen? Und wenn ja – wo?
Eine Gesellschaft in der Zerreißprobe
Brecht und Weill erzählen die Geschichte einer Stadtgründung in der Wüste – eines Ortes, an dem das Menschliche dem Ökonomischen geopfert wird. Benedikt von Peter versteht Mahagonny als ein Modell unserer Gegenwart: ein Labor zur Reflexion der Spätfolgen des liberalisierten Kapitalismus. „Wer kein Geld hat, ist tot. Wer liebt, ist ebenfalls tot“ – so formuliert es der Regisseur. Der Einzelne wird in ein System gedrängt, in dem Leistung, Konsum und Ausschluss die Regeln bestimmen.
Der Holzfäller Jim Mahoney, der aus Alaska kommt, um hier zu „leben“, merkt schnell: Das Eigentliche fehlt. Keine Werte, keine Gemeinschaft, keine Idee von Zukunft – nur sozialdarwinistische Prinzipien. „Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du’s.“ Auch die Besucher:innen dieser Inszenierung verfangen sich in diesen Netzen. Sie suchen – genau wie Jim – das Zentrum eines Spektakels, das keins hat. Und erleben so den zentralen Befund dieser Oper körperlich: etwas fehlt.
Theater als Vergnügungstempel?
Oder als Ort gemeinschaftlicher Erkenntnis?
Der erste Teil der Aufführung spielt in den Foyers: das Orchester musiziert auf der Bühne, die Musik wird in alle Bereiche des Hauses übertragen, Seifenblasen schweben, auf Rollwägen wird Mahagonny-Sekt angeboten – dessen Preis, im Börsenmodus, schwankt. Screens zeigen die Ankunft der Männer aus Alaska, live gefilmt mit zwei Kamerateams. Sänger:innen und Chor bewegen sich unter den Zuschauer:innen.
Später wird das Publikum auf die Bühne gebeten. Dort entsteht innerhalb kürzester Zeit ein Matratzenlager, das an eine Turnhalle erinnert. In dieser fast absurden Gemeinschaftsanordnung hört man die Musik von Kurt Weill – grell, ironisch, jazzig, marschierend – mit völlig neuer Klarheit. Der zweite Akt wird so zu einem nihilistischen Rausch, einer orchestrierten Selbstzerstörung im Stile von Karl Kraus’ Letzten Tagen der Menschheit oder Ferreris Großem Fressen. Und doch – ganz am Rand – bleibt die Hoffnung auf ein „Beieinandersein, das Sinn stiftet“, wie von Peter formuliert. Das Theater als Ort einer utopischen Mini-Gesellschaft?
Eine Jenny gegen den Opernkanon
Einen besonderen Kontrapunkt zu all dem setzt die Figur der Jenny – gesungen von einer Sängerin, die ihrer Rolle mit Haltung und Widerstandskraft begegnet. Jenny ist keine Erlöserin, keine Märtyrerin, kein sentimentales Opfer. Sie verkauft sich – aber nicht emotional. Sie verweigert die Rollen, die Opernfrauen seit Jahrhunderten zugewiesen wurden.
„Endlich mal eine Figur, die sich nicht opfert. Jenny bleibt sich treu – auch wenn das nicht gefällt“, sagt die Sängerin. „Viele erwarten, dass sie sich irgendwie veredelt, doch sie entzieht sich dem.“
Gesungen wird Jenny mit bewusster Klarheit, nicht mit Pathos. Der Text zählt, die Gedanken sind präzise gefasst – alles andere wäre unvereinbar mit der schroffen Ehrlichkeit dieser Figur. Der Gesang bleibt nah an der Sprache, ohne ins Singschauspiel abzugleiten.
„Wenn ich ‚Erst kommt das Fressen‘ in Opernpose schmettere, wird es lächerlich“, so die Sängerin. „Man muss Jenny denken, dann singt man sie richtig.“
Auch räumlich löst sie sich aus der Hierarchie: Sie bewegt sich mitten im Publikum, begegnet dem Gegenüber direkt. „Ich habe nie verstanden, warum wir auf der Bühne Kunststückchen machen, und dann durch den Hinterausgang verschwinden. Jetzt ist alles offen.“
Jenny hat für die Sängerin auch persönlich Spuren hinterlassen: „Ich sehe seitdem alle Rollen anders. Wie zeigen wir Frauenkörper auf der Bühne? Wer erzählt die Sinnlichkeit – und wessen Blick wird da bedient?“ Mahagonny wird so auch zur Reflexionsfläche über Macht und Repräsentation im Theater selbst.
Technik, Timing und das Unwägbare
Was organisatorisch und technisch hinter dieser Inszenierung steht, ist kaum zu überschätzen. Der technische Direktor Christoph Hill spricht von einer Herausforderung „in völlig neuer Dimension“. Neue Datenleitungen wurden ins Foyer verlegt, vier Mischpultplätze koordinieren Bild, Ton und Dirigat, Sänger:innen sind mit Mikroports ausgestattet und von technischen „Runnern“ begleitet. Das Orchester wird auf einer beweglichen Drehscheibe platziert – ein tonnenschwerer LKW gleichsam, der durch die Partitur fährt. Und nichts darf aus dem Takt geraten.
Die Komplexität liegt in der Gleichzeitigkeit: Von Peter inszeniert nicht linear, sondern parallel – in mehreren Räumen gleichzeitig, mit Echtzeitverschiebungen. Auch die Darsteller:innen müssen sich auf das Unwägbare einstellen: Sie agieren nicht vor, sondern in einem Publikum, das jeden Abend anders reagiert.
Fazit: Oper als soziales Labor
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny wird hier nicht gezeigt, sondern erlebt. Benedikt von Peter nimmt Brechts Lehrstück beim Wort – und macht daraus ein Labor der Gegenwart. Es ist laut, grell, anstrengend – aber es ist auch heilsam. Denn es schafft Bewusstsein für ein System, das sich auf seine eigene Zerstörung zubewegt. Und vielleicht – inmitten der Seifenblasen, des Sekts, der Screens und der Stimmen – auch einen Moment echter Gemeinschaft.
Ein Muss für Berliner und Berlin-Besucher gleichermaßen. Und ein Glücksfall für das moderne Musiktheater.
|

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Deutschen Oper Berlin | Foto (C) Thomas Aurin
|
Steffen Kühn - 19. Juli 2025
ID 15371
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY (Deutsche Oper Berlin, 17.07.2025)
Musikalische Leitung: Stefan Klingele
Inszenierung: Benedikt von Peter
Bühne: Katrin Wittig
Kostüme: Geraldine Arnold
Licht: Ulrich Niepel
Video: Bert Zander
Live-Kameras ... Kathrin Krottenthaler, Bert Zander und Hannah Dörr
Klangdesign: Benjamin Schultz
Dramaturgie: Sylvia Roth und Carolin Müller-Dohle
Chöre: Jeremy Bines sowie Philip Lawton und Senta Aue
Besetzung:
Leokadja Begbick ... Evelyn Herlitzius
Fatty, der „Prokurist“ ... Thomas Cilluffo
Dreieinigkeitsmoses ... Robert Gleadow
Jenny Hill ... Annette Dasch
Jim Mahoney ... Nikolai Schukoff
Jakob Schmidt ... Kieran Carrel
Bill, genannt Sparbüchsenbill ... Artur Garbas
Joe, genannt Alaskawolfjoe ... Padraic Rowan
Werktätigenchor
Generationenchor der Deutschen Oper Berlin
Mitarbeiter*innen der Deutschen Oper Berlin
Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin
Premiere war am 17. Juli 2025.
Weitere Termine: 20., 22., 24., 26.07.2025
Weitere Infos siehe auch: https://deutscheoperberlin.de
Post an Steffen Kühn
http://www.hofklang.de
Konzerte
Musiktheater
Neue Musik
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:

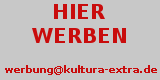
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CD / DVD
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
MUSIKFEST BERLIN
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE

= nicht zu toppen

= schon gut
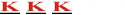
= geht so

= na ja

= katastrophal
|