"Literatur als
Akt des
Widerstands"
|

|
Bewertung: 
"Der Film spielt in den 1980er und 1990er Jahren in Teheran und ist eine sehr persönliche und intime Geschichte, spiegelt aber gleichzeitig die ewige Weltpolitik wider, die brennende, aktuelle Themen auf der ganzen Welt reflektiert." (Marica Stocchi & Gianluca Curti, Produzenten)
*
Lolita lesen in Teheran basiert auf dem gleichnamigen Buch der Hochschulprofessorin und Schriftstellerin Azar Nafisi, die darin persönliche Erfahrungen aus ihrem Leben in Teheran verarbeitete und in dem sie selbst die Hauptfigur ist. Der Film entstand unter der Regie des Israelis Eran Riklis und nach einem Drehbuch von Marjorie David, verwendet aber nur einzelne Aspekte der Romanvorlage, in der auf etliche Bücher westlicher Literatur eingegangen wird. Bei Riklis sind es nur vier. Sein Film beginnt im Jahr 1979 mit der Rückkehr vieler Exil-Iraner, die sich nach dem Sturz des Schahs von Persien und der darauf folgenden Machtübernahme durch Ajatollah Chomeini eine Verbesserung der politischen Lage versprachen.
Schon am Flughafen von Teheran hätten Azar Nafisi (Golshifteh Farahani) und ihrem Ehemann Bijan (Arash Marandi) bei der Einreise Zweifel kommen können. Der Zollbeamte macht ein missbilligendes Gesicht, als er den Lippenstift in Azars Handtasche entdeckt, und als sie ihn bittet mit ihren Büchern vorsichtiger umzugehen, bekommt sie die verächtliche Grundeinstellung des Regimes Frauen gegenüber zu spüren. Später fragen sich Azar und Bijan, ob sie die Eskalation der Ereignisse hätten kommen sehen können und müssen das bejahen.
Zunächst unterrichtet Azar englischsprachige Literatur an einer Teheraner Universität und begeistert eine Reihe junger Studentinnen. Die Machthaber verbieten nach und nach westliche Bücher, und an der Universität kommt es zu einer gespielten Gerichtsverhandlung. Darf man ein Buch wie Der große Gatsby von Scott Fitzgerald lesen, das von Ehebruch, Korruption, Kriminalität und anderen unerbaulichen Themen handelt. Azar verteidigt das Werk, aber die islamischen Hardliner wollen es nicht dulden, obwohl der Roman die Dekadenz der amerikanischen Gesellschaft der 1920er Jahre schildert. An der Wand der Universität steht in englischer Sprache, das man den USA den Tod wünscht. - Schon 1981 wird Azar suspendiert, weil sie sich weigert, den Hijab, das Kopftuch, zu tragen. Die Theokratie im Iran, die religiös orientiert und auf einen Stellvertreter Gottes auf Erden ausgerichtet ist, verfestigt sich immer mehr. Insbesondere wird das Leben von Frauen zunehmend eingeschränkt. Diejenigen, die sich öffentlich gegen das Regime auflehnen, riskieren Verhaftung und einige sogar die Hinrichtung.
Ein Zeitsprung. Im Jahr 1995, fünfzehn Jahre später, hat sich noch nicht viel geändert. Azar trifft sich gelegentlich mit einem älteren Mann, der nur der Magier (Shabaz Noshir) genannt wird. Er ist auch ein Literaturbegeisterter, der darunter leidet, dass viele Bücher verboten sind. Mit ihm tauscht sie heimlich verbannte literarische Werke aus. Trotzdem verkümmert sie zunehmend unter den Repressalien, doch ihr Mann Bijan hat ihnen eine Existenz aufgebaut und ist als Architekt erfolgreich. Azar trifft sich im Geheimen einmal die Woche mit einigen ihrer Studentinnen, um mit ihnen über verbannte Bücher zu sprechen, in denen sie sich und ihre Lebenssituation partiell wiedererkennen. Das gibt allen Auftrieb. Als sie den Roman Lolita von Vladimir Nabokov lesen, stellen sie fest, dass dessen männliche Hauptfigur der blutjungen Lolita Gewalt antut und sie ihrer Zukunft beraubt.
Der dritte Teil behandelt Daisy Miller von Henry James und führt die Geschichte noch einmal ins Jahr 1988 zurück. Der Iran-Irak-Krieg (1980-88) ist beendet, und Azar unterrichtet wieder an der Hochschule – mit Hijab. Daisy Miller wird ausschließlich durch die Augen von Männern geschildert und – obwohl am Ende unschuldig - verurteilt, weil sie sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen hält. Wie Lolita ist auch sie ein Spielball von Männern und deren Fantasie. "Wir sind alle Lolitas", ist eine zentrale Erkenntnis der Literaturstudentinnen.
Der vierte und letzte Teil ist Jane Austen und ihrem Roman Stolz und Vorurteil gewidmet. Er spielt im Jahr 1996. Azar unterrichtet immer noch heimlich ihre Studentinnen, für die diese Treffen ein Akt der inneren Befreiung und des Widerstands sind. Azar lehrt die jungen Frauen den englischen Gesellschaftstanz der Zeit, der sehr streng und reglementiert ist, wie das Leben der Frauen in England zu Austens Zeit. Die Tanzveranstaltungen sind öffentliche Rituale, und es ist ein gewisses Aufbegehren, dass sich Austens Protagonisten währenddessen unterhalten. Wie im Iran waren im damaligen England arrangierte Ehen durchaus üblich. Die Frauen hatten keine Rechte, nicht einmal an ihren Kindern, wie Azin (Lara Wolf), die bei ihrem gewalttätigen Mann bleibt, weil sie sonst ihre Tochter verlieren würde. So haben alle unter der Unterdrückung von Frauen in unterschiedlichem Ausmaß zu leiden, darunter Inhaftierungen, Gewalttaten, erzwungene gynäkologische Untersuchungen und Geständnisse. Der Film endet mit der Veröffentlichung des Buches Lolita lesen in Teheran, das Azar Nafisi im Jahr 2003 im amerikanischen Exil verfasste. Darin hielt sie ihre eigenen subjektiven Erlebnisse und die ihrer Studentinnen fest. Das Ehepaar hatte sich zur Emigration entschlossen, weil es nicht wollte, dass seine Kinder aufwachsen, ohne je etwas anderes gekannt zu haben.
* *
Eran Riklis ist israelischer Jude und hat sich mit Filmen wie Die syrische Braut und Lemon Tree mit dem israelisch-arabischen Konflikt auseinandergesetzt und bei Aus nächster Distanz schon einmal mit Golshifteh Farahani in der Hauptrolle gearbeitet. In dem damaligen Interview von 2018 geht er auf die Lage in Israel ein, und der Inhalt des Gesprächs ist heute noch in großen Teilen gültig. Er hat die Fähigkeit die Befindlichkeit von Frauen zu illustrieren und hat meistens eine gute Portion Humor angesichts der Absurditäten des Lebens z.B. unter Besatzung. Bei Lolita lesen in Teheran hat er sich in dieser Hinsicht völlig zurückgenommen. Er nimmt die Zermürbung und zerstörerische Kraft durch die Entwertung und gesellschaftliche Missachtung der Frauen sehr ernst, unter der die Protagonistinnen ungemein leiden. Golshifteh Farahani und ihre Mitstreiterinnen, die alle Exil-Iranerinnen sind, spielen ihre Rollen sehr intensiv und überzeugend, und auch die Darstellung des restlichen Ensembles – inklusive der Männer – ist beeindruckend und allein deshalb schon sehenswert.
Riklis setzt sich wieder einmal zwischen die Stühle, denn der Iran kann den Film nicht gut heißen, und auch die Israelis üben Kritik, denn zwischen der Produktion des Films – in Italien - und seinem Kinostart lagen kriegerische Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern. Dieses Mal geht es bei Riklis nicht um Israel, obwohl die Geschehnisse im Iran immer eine Auswirkung auf seine Heimat haben. Genau genommen geht es auch nicht primär um die historischen Ereignisse im Iran, denn die Benachteiligung von Frauen ist ein weltweites Phänomen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Es geht allgemein um Diktaturen und inwieweit Kunst, in diesem Fall Literatur, Auflehnung dagegen sein kann, denn die Macht der Worte ist Potentaten ein Dorn im Auge. Riklis setzt auch in diesem Film auf Annäherung und Dialog.
"Dieser Film ist, wie das Buch, für ein globales Publikum gedacht und trifft in der heutigen unruhigen Welt überall viele Themen. Es ist ein Film, der tief in die Gedanken und Herzen von Frauen blickt, die völlig unterschiedlich sind, sich aber auch ergänzen. Für mich handelt dieser Film nicht nur vom Iran. Er behandelt leider den Zustand der Dinge - und das, was in vielen Ländern und Regionen der Welt noch bevorsteht. Er handelt von meinem eigenen Land, Israel. Er handelt vom Nahen Osten. Er handelt von so vielen Orten in Europa. Und er handelt von den Vereinigten Staaten. Tatsächlich handelt er also von der Welt, in der wir heute leben." (Eran Riklis)
|

Die Professorin mit ihren sechs Studentinnen, (unten v. li. n. re.) Sanaz (Zar Amir Ebrahimi), Azar (Golshifteh Farahani) und Nassrin (Mina Kavani), oben v. li. n. re.) Mashid (Bahar Beihaghi), Manna (Raha Rahbari), Azin (Lara Wolf) und Yassi (Isabella Nefar) | © Eitan Riklis
|
Helga Fitzner - 19. November 2025
ID 15565
https://weltkino.de/filme/lolita-lesen-in-teheran
Post an Helga Fitzner
Dokumentarfilme
Neues deutsches Kino
Spielfilme, international
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
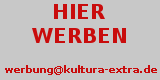
Rothschilds Kolumnen
DOKUMENTARFILME
DVD
FERNSEHFILME
HEIMKINO
INTERVIEWS
NEUES DEUTSCHES KINO
SPIELFILME
TATORT IM ERSTEN
Gesehen von Bobby King
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
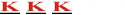
= geht so

= na ja

= katastrophal
|