Die besten Spiel- und Dokumentarfilme im BERLINALE-Angebot sind über den Nahostkonflikt
63. BERLINALE
|

|
Hoffnung dringend gesucht
|
Angesichts des riesigen Angebotes an Filmen in den verschiedenen BERLINALE-Sektionen wirkt es teils erschreckend, wie wenig Regisseure im saturierten Westen, also Europa und den USA, zu virulenten Krisen was zu sagen haben und wie ausgeleiert ihre Themenwahl wirkt. Ganz anders die Filme aus dem Nahen Osten, die den Zuschauer tief bewegen und aufwühlen: Hier geht es um wahrhaft existenzielle Themen und, keineswegs nur aus dramaturgischen Gründen, bisweilen um Leben und Tod.
|

Art/Violence, Palestinian Territories/USA 2013 (Regie: Udi Aloni, Batoul Taleb, Mariam Abu-Khaled) - Foto (C) Berlinale
|
Einer derjenigen, die sich weder mit der Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel noch mit der gegenseitigen Sprachlosigkeit der verfeindeten Völker abfinden wollten, war der palästinensisch-jüdische Schauspieler, Regisseur und Friedensaktivist Juliano Mer-Khamis, der mitten im palästinensischen Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland das „Freedom Theatre“ gegründet hatte, damit die Flüchtlinge etwas anderes sehen und fühlen können als Ohnmacht und Resignation. Am 4. April 2011 wurde Juliano Mer-Khamis von Unbekannten auf offener Straße erschossen, wohlmöglich von Landsleuten. Die amerikanisch produzierte Dokumentation Art/Violence zeigt die bedrückende Zeit nach Mer-Khamis Tod und die Bemühungen seines israelischen Freundes und Kollegen Udi Aloni, zusammen mit drei jungen palästinensischen Schauspielerinnen – darunter Mer-Khamis Tochter – sowie anderen Mitstreitern das Theaterkonzept des Ermordeten fortzuführen und zugleich dessen Schicksal und dessen Abwesenheit zum Bühnenthema zu machen. Ausschnitte von Neuadaptionen des „Freedom Theatres“ von Klassikern wie Warten auf Godot oder Antigone drücken den Wunsch nach einer Welt aus, die von Toleranz und Fantasie und nicht von Gewalt und Unterdrückung (insbesondere gegen Frauen) geprägt ist. Hier hat Theater noch Relevanz und Dringlichkeit. Schade nur, dass man über Leben und Werk des Ermordeten so wenig erfährt.
Wie sich die Gewaltspirale im Angesicht einer andauernden, aber auf Dauer unhaltbaren Misere immer wieder hochdreht, das zeigt der Spielfilm Inch'Allah der Regisseurin Anaïs Barbeau-Lavalette: Die junge kanadische Ärztin Chloé, die für die UN in einem Krankenhaus in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Westjordanland schwangere Frauen behandelt, versucht trotz des Militarismus und der Angst vor Gewalt, die um sie herum herrschen, die Fassung zu bewahren und allen Menschen mit Respekt zu begegnen. Und doch wird die sensible junge Frau schließlich auf tragische Weise tief in den Nahost-Konflikt verwickelt, nachdem sie miterlebt hat, wie ein arabischer Junge grundlos von einem israelischen Armeejeep überrollt wurde. Die dramaturgisch packend gebaute, sich zuspitzende Handlung des Films stellt den Alltag des palästinensisch-israelischen Konfliktes als eine für Außenstehende unentwirrbare Zwickmühle dar. In der Figur der in ihrer Loyalität zu arabischen Patienten und israelischen Freunden überforderten Chloé spiegelt sich quasi der Schlamassel der Weltgemeinschaft wieder: Vernunft und Augenmaß greifen ins Leere, wo eine Art archaische Stammeszugehörigkeit die bedingungslose Unterstützung jeweils einer Seite einfordert und Trotz, Rachegelüste oder Rechthaberei dominieren.
Ebenso wie im israelisch produzierten Rock the Casbah wird die israelische Besatzungspolitik scharf kritisiert, wobei Inch’Allah noch eindringlichere Bilder findet. Dazu zählt die Szene, in der ein kleiner arabischer Junge in einem abgewetzten Supermannkostüm inmitten des Zivilisationsmülls, der auf der palästinensischen Seite der israelischen Grenzmauer aufgetürmt ist, ein kitschiges Ölgemälde der heiligen Stadt Jerusalem findet. Der vom Israeli Yariv Horowitz inszenierte Spielfilm Rock the Casbah, dessen Titel auf einen Popsong der achtziger Jahre anspielt, schildert authentisch (und wohl autobiografisch) die bedrückenden Erlebnisse einer Kompanie junger israelischer Soldaten, die im Frühsommer 1989 ihren Dienst im besetzten Gaza-Streifen antritt und prompt in gewalttätige Situationen gerät. Auch hier wird die Handlung aus der Perspektive eines intellektuellen und sensiblen Menschen geschildert, der feststellen muss, dass bewaffnete Aktionen mitten in einem dicht besiedelten Gebiet zu einer endlosen Spirale aus Aggression und Rache führt, die die Betroffenen entweder gefühllos, halb wahnsinnig oder tot zurück lässt. Erstaunlicherweise spielen auch in diesem Film religiöse Bezüge im Gegensatz zu politischen so gut wie keine Rolle. Gelegentlich sieht man Menschen zwar beten oder über die historische Berechtigung ihrer Taten sprechen, aber all das wirkt in einem Kontext von nervöser Anspannung, Einschüchterung und Frustabbau geradezu deplatziert. Offensichtlich eine inszenatorisch beabsichtigte Leerstelle, die besagen soll, dass sich Gewalt und Gegengewalt längst verselbstständigt und von ihren ursprünglichen Bezügen gelöst haben.
Während israelische Filmemacher die Kritik an der Politik ihrer Regierung offenkundig immer schärfer formulieren, sind auf arabischer Seite viele Kreative erst noch dabei, sich die Möglichkeiten, die das Massenmedium Film bietet, zu erschließen, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Anders als bisher geschehen, wird das Schicksal der Nahostregion im Dokumentarfilm Alam Laysa Lana (Die Welt, die nicht uns gehört) des mit seinen Eltern im dänischen bzw. englischen Exil lebenden Arabers Mahdi Fleifel geschildert: Er nutzt die Sicht mit starken familiären Bezügen, um die Folgen von abstrakter Politik auf eine konkrete, persönliche Ebene zu ziehen und zugleich die eigene Rolle kritisch zu reflektieren: Fleifel zeigt das Leben dreier Generationen im palästinensischen Flüchtlingslager Ain el-Helweh im Süd-Libanon, in dem er selbst Teile seiner Kindheit verbracht hat. Die flüssig und abwechslungsreich geschnittene Collage aus aktuellen Aufnahmen und Videos aus den achtziger Jahren gibt auf eindringliche Weise Aufschluss über die zum Teil menschenunwürdigen Lebensumstände, unter denen mehr als 70.000 Menschen auf einem Quadratkilometer seit über 60 Jahren zusammenleben müssen. Dank der Sensibilität des Regisseurs für die Absurditäten der Situation und dem fatalistischen Humor seiner Gesprächspartner unterhält der Film durchgängig, ohne dass die allgemeine Verzweiflung und Resignation der Betroffenen verharmlost wird.
Der vielleicht interessantesten Beitrag ist der Spielfilm Lamma shoftak (Als ich dich sah) der in Jordanien lebenden palästinensischen Regisseurin Annemarie Jacir, die versichert, dass sie ihren deutschen Vornamen nur deshalb hat, weil er ihren Eltern so sehr gefiel. Jacir greift am weitesten in die Geschichte zurück und schildert quasi den Beginn allen heutigen Elends: In der Folge des Sechstagekriegs von 1967 lebt der elfjährige Tarek mit seiner Mutter in einem palästinensischen Flüchtlingslager, bis er auf der Suche nach seinem Vater trotzig Richtung alter Heimat aufbricht und dabei an eine Gruppe von PLO-Kämpfern gerät. Clou des ebenso unterhaltsamen wie berührenden Films ist die Schilderung des Konfliktes aus kindlicher Sicht, die das Trauma der Betroffenen nachvollziehbar macht und Raum für absurd-komische Momente lässt. Tareks naive Illusion, den Heimatverlust überwinden zu können, unterscheidet sich von derjenigen der PLO-Rebellen nur graduell. „Ich war nicht daran interessiert, zu zeigen, was alles seit damals schiefläuft und warum meine Generation die Hoffnung verloren hat“, sagt die 38-jährige Annemarie Jacir. „Stattdessen wollte ich der damaligen Naivität nachspüren, dem Moment der Hoffnung, die einem Menschen das Herz öffnet und er sich dadurch der ganzen Welt – ein kurzer Moment, in dem aber alles möglich scheint.“
|

Die Regisseurin des Films Lamma shoftak mit ihren Produzenten: Ossama Bawardi, Annemarie Jacir, Rami Yasin (v. l. n. r.) - Foto (C) Berlinale
|
Max-Peter Heyne - 11. Februar 2013
ID 6551
Weitere Infos siehe auch: http://www.berlinale.de
Post an Max-Peter Heyne
|
|
|

Rothschilds Kolumnen
DOKUMENTARFILME
DVD
FERNSEHFILME
HEIMKINO
INTERVIEWS
NEUES DEUTSCHES KINO
SPIELFILME
TATORT IM ERSTEN
Gesehen von Bobby King
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
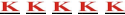
= nicht zu toppen

= schon gut
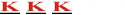
= geht so
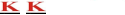
= na ja
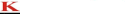
= katastrophal
|