Kunstgeschichte
im Konjunktiv
|
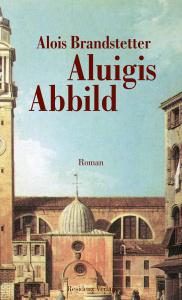
|
Bewertung: 
Die Handlung des Buches lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen. Aloysius Gonzaga, der wohl jüngste Heilige der katholischen Kirche, soll von keinem geringeren als Peter Paul Rubens gemalt werden. Doch der lehnt ab und schickt seinen Meisterschüler Anthonis van Dyck nach Mantua, Italien. Nun sind es sogar nur zwei Sätze geworden, die den dürftigen Sachverhalt schildern. Dennoch hat sich der österreichische Deutsch-Philologe Alois Brandstetter mit Lust und Laune an diese Geschichte [Aluigis Abbild] gewagt und schmückt sie in Schilderungen und Briefen fantasievoll aus. Gern im Konjunktiv kommen die Mutter des Heiligen, ihre Freundin, aber auch Rubens und Van Dyck sowie weitere Zeitgenossen zu Worte. So erfahren wir einiges über das Umfeld von Aloisius, der 1591 mit nur 23 Jahren an der Pest starb und der Jahre später nach alten Bildern für einen ihm gewidmeten Kirchenbau neu gemalt werden soll. Gottesfürchtig und keusch sei er gewesen, berichtet die Mutter Donna Marta Tana di Santena über ihren ungewöhnlichen Sohn, den sie zärtlich Aluigi nennt:
„Es sei richtig, daß der Prinz jede Zweisamkeit mit weiblichen Menschen vermieden habe und immer Räume, in denen er mit einzelnen weiblichen Personen nolens volens zusammengekommen sei, fluchtartig verlassen habe. Auch sei richtig, daß er Frauen, auch nicht ihr, seiner Mutter, niemals geradewegs ins Auge geblickt habe. Es gab auch keine Küsse unter Verwandten und Familiaren. Es gab auch kein Händeschütteln. Er habe die Augen vielmehr immer niedergeschlagen, an den Mädchen oder Frauen vorbei oder über sie hinweggesehen.“
(S. 82)
Neben solcher Kuriosa und der Tatsache, dass der Jesuit Aloysius erst gut hundert Jahre später heilig gesprochene wurde, erfahren wir einiges über die Malerei in dieser Zeit, aber eben leider nur einiges.
Die Flut der Personen, die im Buch auftreten, ist unübersichtlich, die Handlung dagegen sparsam. Der Leser wird mit Namen konfrontiert, die er vermutlich nie zuvor gehört hat. Italienische wie auch flämische Sätze sind in den Text eingestreut, werden zwar übersetzt, dienen aber nicht der Belebung der Handlung. Erst im Epilog erreicht der Maler Van Dyck überhaupt Italien, doch anscheinend niemals Mantua. Denn nun erfährt der Leser, dass das Bild von Aloisius niemals zu Stande kam, für den Laien völlig unerwartet.
*
Alois Brandstetter ist sicher ein kluger Mensch, der sich zweifelsohne seine Gedanken zum Thema gemacht hat. Diese mögen für den Insider eine amüsante Unterhaltung darstellen. Der Durchschnittsleser kämpft sich mühsam durch Namen und Sachverhalte und lernt dabei wenig über Kunstgeschichte, Zeitgeist und Historie. Somit scheint mir das Buch nur an eine kleine, interessierte Minderheit adressiert zu sein, für andere Leser ist es viel zu speziell.
|
Ellen Norten - 12. November 2015
ID 8977
Alois Brandstetter, Aluigis Abbild
Gebunden, 192 Seiten
EUR 19,90
Residenz Verlag, 2015
ISBN 978-3-7017-1647-0
Weitere Infos siehe auch: http://www.residenzverlag.com/print.php?m=30&o=2&id_title=1782
Post an Dr. Ellen Norten
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
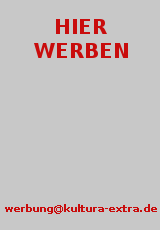
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
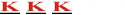
= geht so

= na ja

= katastrophal
|