|
John Jeremiah Sullivan - Pulphead. Vom Ende Amerikas
Aus dem Englischen von Thomas Pletzinger und Kirsten Riesselmann Suhrkamp Verlag 2012
ISBN 978-3-518-06890-8
|

|
Zugegeben: Es gäbe jede Menge deutscher Journalisten, die dazu in der Lage wären. Aber nur wenige können sich hierzulande leisten, „ich“ zu sagen und Geschichten so zu erzählen wie dieser amerikanische Autor. Man kann darüber staunen, man kann es zur Kenntnis nehmen und man kann es verschweigen: Man kann ignorieren, dass der Journalismus in Deutschland so bieder und muffig daherkommt; dass originelle Texte Mangelware sind und reihenweise der stilistischen Zensur zum Opfer fallen. Und natürlich kann man sich darüber auch ärgern: Aber das alles wird ohne Folgen bleiben. Vergleichbar mit den deutschen Sittenwächtern, die auf notorische Weise Moral und Sitte verwechseln (und das gilt übrigens auch für ihre Gegner), gibt es hierzulande Stilwächter in Verlagen und Redaktionen, die peinlichst genau darauf achten, dass nur saubere Texte publiziert werden. In den Lektoren-Hirnen treibt diese unerbittliche Carver-Hemingway-Schere ihr Unwesen. Sie sorgt geflissentlich dafür, dass den deutschen Schreiberlingen die Schnäbel nicht zu lange wachsen. Könnte gefährlich werden. Könnte Unheil in der Seele des Lesers anrichten. Sagen wir es kurz und bündig so: Keine Geschichte des amerikanischen Journalisten John Jeremiah Sullivan wäre in einer deutschen Zeitung oder Zeitschrift veröffentlicht worden. Ganz zu schweigen von Buchverlagen! So sieht es doch aus.
Vielleicht hat es mit dem zu tun, was die Angelsachsen „german angst“ nennen. Ein spezifisches Weltgefühl, schwer vermittelbar für Menschen aus anderen Ländern. Angstepidemien im Alltag, die sich wellenförmig in Impulsen ausbreiten und alle Bereiche der Lebenswelt infizieren. Die dazu führen, dass alles ständig kontrolliert und durch Gesetze abgesichert werden muss: Angst vor kitschiger Weihnachtsbeleuchtung. Angst vor einer neuen Haarfarbe. Angst vor dem Urlaub. Angst vor den Kollegen. Angst vor einer neuen Wohnung. Angst vor Widerworten. Angst vor neuen Perspektiven. Angst Angst Angst wohin man blickt. Und natürlich auch: Angst vor denjenigen, die anders schreiben und denken. Den Freien. Und so kommt es, dass in diesem Lande selbst diejenigen, die sich „liberal“ nennen, weniger von Freiheit verstehen als jene bornierten Konservativen in jenem Land, von dem Sullivan so trefflich berichtet.
Spätestens jetzt zuckt es durch das kontinentaleuropäische Hirn, und die moralisierenden Brauen recken sich wie eine Eins: Ist sie denn nicht eine gefährliche, verantwortungslose Freiheit, die in diesem Land und in Sullivans Texten zu finden ist? Vielleicht. Im Zentrum dieser Freiheit jedenfalls findet man nichts als das Individuum, dem man hierzulande betrüblicherweise ja nicht über den Weg traut und das doch die Quelle jeder freien menschlichen Gesellschaft ist. Eine Freiheit ohne Garantie. Ein gefräßiges Untier. Bisweilen eine Katastrophe. Bisweilen ein Wunder.
John Jeremiah Sullivan erzählt vehement und kompromissarm von dieser Freiheit und ihren Tücken. Von der urwüchsigen und bedingungslosen Freiheit, die sich Bahn bricht in allen Winkeln der amerikanischen Gesellschaft und die in ihren gewaltigen Amplituden kaum einzufangen ist auf herkömmliche journalistische Weise. Das wussten übrigens schon Tom Wolfe und Truman Capote. Und auch David Foster Wallace war das glasklar. Und nicht anders ergeht es Sullivan. Diese Freiheit ist keine Befreiung, keine Unabhängigkeit. Sie ist ein Frei-Raum, eine Aufgabe, die es mühsam zu gestalten gilt. Und natürlich wirkt sich das auch auf den Stil des Berichterstatters aus. Denn das, was dieser Kerl veröffentlicht, hat mit herkömmlichen Reportagen wenig zu tun. Aber wer definiert denn diese Gattung? Ist das „Gute-Reportage-Kriterium“ so etwas wie das Urmeter in Paris? Wer erdreistet sich, die richtigen Kriterien für sich zu reklamieren?
Nach Veröffentlichung seines Buches wurde Sullivan hoch gelobt. Der 37-jährige Autor schreibt für die Paris Review, für Harper's , für das New York Times Magazine oder die amerikanische Ausgabe des Männermagazins GQ. Es sind Reportagen von teilweise bis zu vierzig Seiten, ein Format, das für deutsche Leser schwer einzuordnen ist. Kein Roman, keine klassische Reprotage. Vielleicht non-fiction Kurzgeschichten. Egal.
Denn wofür diese Kategorien? Ist das Publikum so beschränkt, dass es Schubladen braucht, um unterhaltsame und intelligente Texte zu würdigen? Eine rhetorische Frage. Möglicherweise wären es nach strengen Kriterien etwa Bruchstücke einer Autobiografie, weil Sullivan das eherne journalistische Gesetz bricht und sich mit der Sache gleich macht und die Ereignisse radikal mit Blick auf seine eigene Person schildert. Aber wie sonst sollte man eine Sache auch verstehen, wenn nicht durch ein individuelles Bewusstein, das sich dieser annimmt? Sich den Dingen auf Augenhöhe nähern – so sollte das neue journalistische Motto lauten. Sich gleich machen mit der Sache.
Zur Erinnerung: Ursprünglich und lange Zeit waren Journalisten nichts anders als Geschichtenerzähler. Doch Leuten, die Geschichten erzählen, sollte man nicht vorschreiben, wie sie zu erzählen haben. Sonst kann nichts Neues entdeckt und erkannt werden. Sonst sind es immer die alten Schablonen, mit denen man sich vergeblich bemüht, Neues darzustellen.
Sullivan erzählt deshalb auf seine Weise. Da ist der Auftritt dieses Konservativen bei einem Townhall-Meeting eines demokratischen Politikers. Irgendwie taucht diese Geschichte die Tea-Party-Bewegung in ein ganz neues, ungewöhnliches, verstörendes Licht. Oder Sullivan erzählt von Disney World und legt nahe, diesen Ort lieber früher als später zu besuchen, um etwas Essentielles über dieses Land zu verstehen, das man eben nur dort erahnen kann. In einer Reportage über den amerikanischen Blues erinnert diese Musik an die Songlines der australischen Ureinwohner, die den Hörer durch die emotionale Landkarte dieses Landes führt, vorbei an Kitsch und Tränen, an Kunst und Romantik. Bei allem Einfallsreichtum ist Sullivan übrigens auch ein eifriger Journalist, der sich minutiös vorbereitet, um etwas zu finden, was bisher in keiner Story über das jeweilige Sujet erzählt wurde:
"Ich finde es aufregend, auf Dokumente zu stoßen, die noch nicht Teil einer Story sind. Sie sind so etwas wie Inseln der Legitimität, von denen aus man sich dann trauen kann, selbst etwas zu erzählen."
Und schon darf er erzählen, wobei er Stil und Sprache jeweils seinem Gegenstand anpasst. Dass er damit gelegentlich bewusst über das Ziel hinausschießt, bleibt dabei nicht aus. Es ist ebenso Methode wie es an anderen Stellen seine bewusste Methode ist, sich ganz zurückzunehmen, auch wenn Letzteres seltener vorkommt.
Im Gedächtnis bleiben die Details dieser Geschichten, die verweigerten oder verlorenen Intimitäten, die den erwähnten Freiraum einst ausfüllten und heute nur noch leblose Abbilder einer ehemaligen Behaglichkeit sind. So etwa, wenn Sullivan davon erzählt, wie eine TV-Serien über Jahre hinweg in seinem Haus gedreht wurde und nach und nach das Verhältnis der Familienmitglieder zueinander, aber auch zu dem Haus und den Nachbarn verstellte. Eines Tages erobern sich die Sullivans ihre Lebenswelt, die sprichwörtlichen „vier Wände“ zurück und müssen erkennen, dass sie mit all diesen freien Räumen nichts mehr anfangen können, weil sie sich eingerichtet haben in der engen fürsorglichen Belagerung der Medienwelt. Einer Welt, die alles auf den Kopf stellt und dabei den Anschein erweckt, als wäre es nicht geborgt, sondern urwüchsiges Eigentum einer irren Fantasie. Sagen wir so: Niemand käme hier auf die verrückte Idee, Realität und Fantasie zu verwechseln. Der Punkt ist, dass längst schon kein Interesse mehr besteht an dem, was einst „Fantasie“ genannt wurde.
Vielleicht erweist sich die Behauptung als falsch, aber Sullivan wird für die Literatur wohl unerheblich bleiben. Seine Bedeutung wäre sein Einfluss auf den Journalismus gewesen – wenn es die digitale Revolution nicht gegeben hätte. In Zeiten des Internetjournalismus ist der autobiografische Charakter der Texte ebenso geläufig wie der individuelle, rücksichtlose Stil. Die Literatur begann, nach Henry Millers denkwürdiger Prognose, schon sehr früh mit dieser radikalisierenden Entwicklung. Sullivan kommt da gewissermaßen zur Unzeit. Im Netz ist es mittlerweile üblich, die Welt als eine private Matrix zu lesen. Und was die aussterbenden Papierformate unserer Zeitungen betrifft, so käme diese Neuerung für sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu spät.
Jo Balle - 1. Februar 2013
ID 00000006518
John Jeremiah Sullivan: Pulphead
Suhrkamp Verlag 2012
416 S.
Klappenbroschur
20,00 € (D) 20,60 € (A) 28,90 sFr (CH)
ISBN 978-3-518-06890-8
Siehe auch:
http://www.suhrkamp.de
Post an Dr. Johannes Balle
|
|
|
Anzeige:
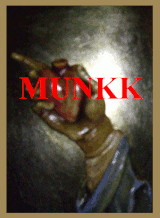
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
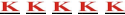
= nicht zu toppen

= schon gut
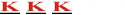
= geht so
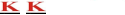
= na ja
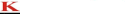
= katastrophal
|