|
Die Kunst der
Beiläufigkeit
|
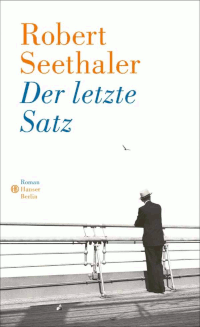
|
Bewertung: 
Gustav Mahler (1860-1911) war schon als kleiner Junge eine außerordentliche Begabung, wurde einer der bedeutendsten Komponisten, war aber auch Dirigent, Operndirektor, und er reformierte das starre Musiktheater seiner Zeit. Von einer biografischen Schrift über ihn würde man nun erwarten, dass sie voll des Lobes über sein Genie wäre, musikwissenschaftliche Erläuterungen über die Bedeutung seines Werkes enthielte sowie ausführlich und inhaltsreich wäre.
Nicht so bei dem österreichischen Schriftsteller Robert Seethaler, der in Der letzte Satz, einem dünnen Bändchen von nur 126 Seiten, das Innenleben des Musikers skizziert. Sterbenskrank verbringt Mahler seine letzte Seereise von New York nach Europa am liebsten an Deck. Er zweifelt an der Qualität seiner Opern und meint, seine Zeit mit ihnen verschwendet zu haben, anstatt gute Musik zu komponieren. Der größte Erfolg, die Aufführung seiner monumental inszenierten 8. Sinfonie, liegt dabei gerade hinter ihm und war ein Triumph. Von Fieber und Selbstzweifeln geschüttelt, lässt Mahler seine Lebensgeschichte Revue passieren.
Er war als Kind schon sehr kränklich:
„Seit seiner Schulzeit litt er unter Migräne, Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, entzündeten Mandeln, schmerzenden Hämorrhoiden, einem gereizten Magen, einem unruhigen Herzen.“ (S. 15)
Ein befreundeter Arzt riet ihm sogar, sich ein ganzes Leben lang auszuruhen. Doch die Musik ließ ihn nicht zur Ruhe kommen:
„Er dachte an die Musik. In der Dunkelheit konnte er ihre Anwesenheit fühlen, als sei sie ein Lebewesen, das atmete und dessen gewichtsloser Körper sich immer weiter ausdehnte, bis er das ganze Zimmer auszufüllen schien.“ (S. 14)
In Wien dirigierte und inszenierte er als junger Mann hunderte von Aufführungen:
„Zum ersten Mal wurden die Stücke so erzählt, dass man ihnen auch folgen konnte: Musik, Dichtung, Raum, Licht, Bewegung – alles war eins und erhielt im Zusammenspiel einen Sinn, der tiefer wirkte, als es das bloße Nebeneinander der einzelnen Teile vermocht hätte... Vor allem aber wollte man diesen kleinen, zappeligen Juden sehen, der es aus unerfindlichen Gründen geschafft hatte, das beste und störrischste Orchester der Welt zu disziplinieren.“ (S. 32f)
Das war ein ziemlicher Kraftakt für den von Krankheiten geplagten Mahler, aber er war auch von einer außerordentlichen Willenskraft getrieben.
Die 19 Jahre jüngere Alma Schindler war die Liebe seines Lebens. Mahler konnte sein Glück nicht fassen, dass die schöne und hochbegehrte Frau seinen Heiratsantrag angenommen hatte. Sie bekamen zwei Töchter, und ihr Glück schien vollkommen, bis das jüngere Kind, die kleine Maria, an einer Infektionskrankheit verstarb. Seine Familie mag zwar der emotionale Mittelpunkt gewesen sein, doch den größten Teil seiner relativ kurzen Lebenszeit widmete er der Musik. Die selbst sehr begabte Alma fand sich damit ab, hinter seiner Arbeit zurückzustehen und auf ihn zu warten. Bis sie sich in den Architekten Walter Gropius verliebte. Die Beziehung mit ihm war durchaus ernst, aber aufgrund von Mahlers schlechtem Gesundheitszustand, blieb sie bei ihm.
*
Seethaler schildert Mahler so, dass er ohne Alma gar nicht zurecht gekommen wäre. In Der letzte Satz geht er der Befindlichkeit seines Protagonisten auf den Grund wie schon bei Der Trafikant (2012), wo er die Auswirkung des aufkommenden Nationalsozialismus auf einen Jugendlichen schildert, oder in Das Feld (2018), in dem er gar Verstorbene ihre Geschichten erzählen lässt. Das alles geschieht in einer Verdichtung, fast Beiläufigkeit und Schlichtheit, die deshalb umso wirksamer sind: z. B. schwingt der Antisemitismus mit, ohne groß thematisiert zu werden. Aufgrund seines desolaten seelischen Zustands spricht Mahler sogar einmal bei Sigmund Freud vor, was Seethaler als vierstündigen Spaziergang schildert, in dem Mahler die ganze Zeit redet. Mahler glaubt zwar nicht, dass es ihm geholfen hätte, ist aber merkwürdig erleichtert. (Freud kommt in Der Trafikant ausführlicher vor).
Es gelingt Seethaler, Mahler der Leserschaft gefühlsmäßig näher zu bringen, jenseits von Notenschrift, dramaturgischer Überhöhung oder Detailliertheit. Rational ist man nach der Lektüre des Buches wohl nicht viel klüger geworden, wer aber danach noch einmal in seine Sinfonien hineinhört, könnte die Erfahrung eines tieferen Verständnisses seiner Musik machen.
„Es geht um alles. Dafür gibt es keine Worte. Es gibt keine Worte für das Leben, keine für den Tod und keine für die Musik.“ (S. 116)
Helga Fitzner - 21. August 2020
ID 12404
Hanser-Link zum Roman
Der letzte Satz
Post an Helga Fitzner
Neue Bücher
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
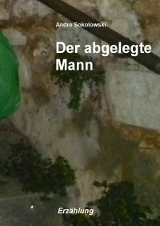
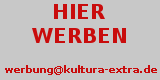
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
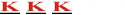
= geht so

= na ja

= katastrophal
|