|
Die Liebe
bleibt
|

|
Bewertung: 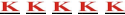
Kürzlich besuchte ich nach vielen Jahren das erste Mal wieder meine ehemalige Stammkneipe. Wie es der Teufel will, traf ich dort auf einen Bekannten, dessen Namen ich im ersten Moment vergessen hatte. Die Begegnung war mir unangenehm, weil sie mich an jenen Abend erinnerte, da ich das letzte Mal in diesem Pub war. Außer uns beiden gab es keinen weiteren Gast, weshalb ich nicht umhin konnte, mit Ruben, so hieß er, ins Gespräch zu kommen. Es war seine damalige Freundin, die ihn damals mit mir betrogen hatte, die zwischen uns stand. Mittlerweile hatten sie sich getrennt und ich fürchte, die Affäre mit mir hatte ihrer angeschlagenen Beziehung den Rest gegeben. Es war dieses verdammte Deja-vu, mit dem ich an diesem Abend zu kämpfen hatte: Ruben hatte damals die Kneipe betreten und mich zuerst handgreiflich, dann niedergeschlagen und schließlich unter Tränen mit meinem Vergehen konfrontiert.
Gut, es waren zehn Jahre vergangen, und doch stieg mir die Schamesröte ins Gesicht, als ich ihn wiedererkannte. Er war blass und schien kränklich. Er bestellte sich einen Weißwein und setzte sich, ohne um Erlaubnis zu bitten, neben mich. Wir sprachen über dies und das, er sah den Roman von Julian Barnes in meiner Hand mit dem ein wenig pathetischen Titel Die einzige Geschichte.
Ruben war anders, als ich ihn in Erinnerung behalten hatte. Gut, bei unserer letzten Begegnung war er außer sich gewesen. Nun erzählte er ruhig vom Ende mit Julia, so war ihr Name. Der Kontakt zu ihr sei schon kurz nach unserem damaligen Treffen abgebrochen. Er wisse nicht, was sie heute mache.
Es war alles nicht geplant, was dann an diesem Abend geschah - natürlich nicht, wie hätte es auch geplant sein können. Aber je mehr Grauburgunder Ruben in sich hineinschüttete, desto leichter wurde seine Zunge. Heute wisse er, dass es nur eine Liebe gebe, säuselte er, und niemand könne ihn von diesem Glauben abbringen. Übrigens gelte das nicht nur für ihn. Wir alle, so behauptete er feierlich, lieben nur einmal im Leben wirklich. Alles andere sei seichte Wiederholung und nichts als Illusion. Die Liebe sei eine Art Geheimwissen, das verloren gegangen sei und von dem man keinen überzeugen könne. Es sei eine mystische Erfahrung, die nichts mit unserem Zeitgeist zu tun habe. Im Gegenteil, so verkündete Ruben feierlich: Wir hätten alle verlernt, die Liebe ernsthaft zu verstehen. Stattdessen flüchteten wir uns in eine Beziehung nach der anderen. Kein Wunder also, dass wir selbst davon überzeugt seien, dass ein Mensch öfter als einmal lieben könne.
So schwafelte er, und irgendwann war er hinüber. Ich begleitete ihn nach Hause, das schlechte Gewissen begleitete uns beide. Er war ein Wrack, das war nicht zu übersehen und ich war zwar nicht Schuld daran, aber ich hatte dazu beigetragen, dass es soweit gekommen war. Denn zweifellos war er ein Wrack seit dem Ende der Beziehung mit Julia. Als ich zurücklief, hielt ich noch immer den Roman von Julian Barnes in der Hand, und da ich nicht müde genug war, ging ich zurück zu der Bar und las mit wachsender Irritation in diesem Buch, bis mich der Barkeeper schließlich vor die Tür setzte, um zu schließen.
*
Es war nicht so sehr der Erzähler des Romans, der mich irritierte, weil er aus allen denkbaren Perspektiven berichtete, als Ich und als Er, und über Gott und die Welt räsonierte, es war vielmehr die Tatsache, dass er dies alles auf eine Weise erzählte, die mich an Ruben denken ließ, so dass mich Rubens Stimme und Ausdruck durch die verbleibenden hundert Seiten dieses Meisterwerkes trugen.
Vielleicht hat das gesellschaftliche Leben im London der Sechziger Jahre wenig gemein mit dem heutigen. Und doch riefe wohl eine Beziehung zwischen einem neunzehnjährigen Mann, Paul Roberts, Einzelkind, Mittelklasse, und Susan Macleod, einer erheblich älteren Frau, genau gesagt dreißig Jahre, nach wie vor einiges Erstaunen hervor. In drei Teilen erzählt der unterkühlte Sentimentalist Julian Barnes diese Geschichte, und als Ruben die Bar betrat, war ich gerade im Begriff, den dritten Teil zu beginnen. Nennen wir ihn das Nachspiel oder besser: die lebenslangen Nachwehen der Liebe.
Natürlich tendiert auch dieser Roman von Julian Barnes zum Essayistischen. Früher störte es mich, jetzt habe ich mich daran gewöhnt und lese sogar Sterne und Musil mit einem gewissen Wohlgefallen. Gut, Barnes ist nicht so weitschweifig und gewollt tiefsinnig, seine Überlegungen sind pointierter und irgendwie auch verzweifelter im Tonfall: „Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?“ So in der Art. Nennen wir es pathetische Essayistik. Da fällt mir ein, dass diese Art zu sprechen ziemlich genau jenem Tonfall entspricht, die wir alle, wenn es um lebensentscheidende Themen und Ereignisse geht, an den Tag legen. So wie Ruben, als er mir, dem Täter, von Julia, seiner einzigen und verlorenen Liebe erzählte. Wenn man so etwas erzählt, wechselt man beständig die Perspektive, springt in der Geschichte hin und her, stellt theoretische Überlegungen an und kommt wieder zurück zu Beschreibungen oder puren Emotionen, von denen wir alle wissen, dass diese Gefühle so, wie wir sie selbst empfinden, niemand dort draußen in der Welt zu vermitteln sind.
Niemand versteht sie, auch wenn es jeder dem Wortsinn nach und dem, was dieser jeweils in ihm auslöst, nachvollziehen kann.
Aber das bringt uns gar nichts. So wie Ruben.
Deshalb und nur deshalb erzählen wir. Weil es keinen Sinn hat.
Bei Julian Barnes zieht die Liaison erstmal eine Art Skandal nach sich. Man wird aus dem Tennisclub ausgeschlossen – na ja, eine lässliche Strafe. Susan verfällt aber immer mehr dem Alkohol. Das ist schon ein ernstes Problem. Mit knappen Pinselstrichen gibt der Autor das Umfeld wieder, skizziert die Umgebung und die Mitmenschen – um diese sozialen Details geht es ihm Gott sei Dank nicht. Wir haben noch Kopfschmerzen von der Jahre zurückliegenden Lektüre der „Korrekturen“! Stattdessen springt er, wie gesagt, unterkühlt und britisch, keine sprachlichen Faxen, kaum Zierrat, von einer zur anderen Perspektive und Episode, um so einen gerade noch ausreichenden, jedenfalls sparsamen Eindruck des Geschehens und der Umstände zu liefern.
Auch Susan bleibt - an sinnlichen Informationen gemessen - ein wenig fade, jedenfalls gemessen an Standards des realistischen Erzählens (Gottvater und Sohn und Heiliger Geist der gegenwärtigen Literatur nicht nur hierzulande). Absicht? Möglich, denn Susan könnte auch einfach eine kaum bemerkenswerte Person sein und tatsächlich blüht die Liebe ja nicht im Schatten unserer Ansprüche. Ich fürchte aber, so war es bei Julia nicht, wohingegen Ruben der Anlage nach ein selbstsüchtiger Langweiler und Klugscheißer ist.
Also wie geht das jetzt mit diesem Roman? Genau wie der Erzähler Barnes eigentlich nur über sich selbst nachdenkt, seine Existenz und das, was die Liebe mit ihm gemacht hat – und es ist immer und ausschließlich die Liebe, die uns de-formiert – so kann jeder Leser in diesem Buch sich selbst lesen, auch wenn er nicht keine direkte Ruben-Begegnung hatte. Warum das so ist? Weil Barnes im Grunde deutlich macht, dass sich die Liebe notorisch larviert, darin besteht nachgerade ihre eigentliche Wesensart: Immer wenn wir sie erforschen wollen oder auch nur in den Blick nehmen, entgleitet sie uns. Sie ist nicht nur der blinde Fleck, sondern sie maskiert sich berufsmäßig und tatsächlich ist sie auch dann umhüllt von lauter Leben, wenn wir sie so genau wie möglich lokalisiert haben. Und schließlich ist sie immer singulär - Kitsch hin oder her. Und überhaupt, so wird während des Liebesweges von Paul und Susan klar, ist sie auch nur einen Augenblick lang angenehm. Was wir lieben, das ist niemals angenehm. Es wäre sogar eine dementsprechende Faustregel zu entwickeln: Fühlt es sich (auf Dauer) gut an, so ist es garantiert alles, nur nicht Liebe.
Diese permanente Spiegelung des eigenen Ich des Helden Paul, die im zweiten Teil hinter mir lag, als Ruben die Bar betrat, hat es wirklich in sich. Sagen wir, ich war auf Rubens Vortrag mit Hilfe von Doktor Barnes trefflich vorbereitet. Diese Art des Nachdenkens und Überlegens ist eine essentiell poetische, und es war vor allem Ruben zu verdanken, dass mir aufging, wie sehr diese besondere literarische Reflexionsform unserem alltäglichen Denken entspringt und deshalb, anders als Wissenschaft und Philosophien und Essayistik, so berührend sein kann.
Zuletzt: Der langsame Verfall des Liebenden. Hier Susans Niedergang. Es könnte auch als der Verfall Rubens bezeichnet werden. Die Rollen sind ja so flexibel. Aber immer, immer gibt es einen, der mehr liebt und einen, der weniger liebt. Und es ist bis zuletzt, und es gibt ja immer ein „zuletzt“, egal, ob man zusammen bleibt oder nicht – bis zuletzt ist es keineswegs ausgemacht, ob nach der Liebe derjenige verfällt, der mehr liebte oder derjenige, der weniger liebte. So verwirrend ist das. Gut gehen Trennungen nur dann für beide Beteiligten aus und ihr Leben glücklich weiter, wenn sie Beide nicht wahrhaftig geliebt haben. Auch dies eine ganz einfache Regel.
Der Erzähler Paul wechselt im zweiten Teil ins „Du“, das machte auch Ruben, bedenkt die Umstände, räsoniert über die Genese der Beziehung, über Herkunft und Umstände und Arbeit und Zeitgeist, gerät in Rage gegen Susans Ehemann, diesen übelriechenden bornierten Heuchler, psychologisiert haltlos und ohne Pointe über die Deformationen von Susans Seele infolge ihrer Missbrauchserfahrungen und kommt schließlic, ermattet, zu keinem endgültigen Schluss, wie wir allesamt immer und immer wieder: Nicht anders als Paul, Julia und der Rezensent selbst.
Der dritte Teil dann erzählt von der Zeit nach der Zeit, der Geschichte nach der Geschichte, also von keiner Geschichte. Ich stelle mir Ruben exakt so vor: Ein Mensch, der sein Zeitquantum gewissermaßen noch auflebt, nachdem seine einzige Geschichte eigentlich vorbei ist. Nachdem Julia fern ist. Und das Schlimmste: Es gibt für ihn keine Moral der Geschichte. So auch für Paul. Keine Erkenntnis, die ihn weitertrüge. Da war dieses eine Urereignis, die Umwelt macht sich genussvoll lustig über ihn, die Anderen sind längst über ihre Untiefen und gescheiterten Ehen hinweg, doch Ruben und Paul sitzen da, ohne Erlösung, im Wissen, das sie , wie Max Frisch einst schrieb, sinnlos erlöschen werden im Licht über Ginster.
Aber so wollen wir hier nicht enden. Und auch Paul endet nicht so: Vielleicht fehlte den Liebenden die Sprache, denkt er, ein nicht zu unterschätzender Faktor, wobei wiederum zu lernen wäre, dass es nicht die treffliche, die richtige und klare Sprache ist, die retten könnte, sondern jene Sprache, die im Anderen etwas auslöst, fernab des Denkens, so dass sie wirkt wie eine körperliche Berührung oder eine Gestik. Das war es auch, was vielleicht Paul und Susan gefehlt hat und das ein rechtes Tonikum gewesen wäre, damit ihre Liebe überdauert. Im Anfang war das Wort. Auch in der Liebe. Also dieses spezielle Wort. Vielleicht rettet dieses richtige Wort. Man kann es nur hoffen. „Die Liebe war in der Regel einfach nur Liebe.“ So Paul. Und weiter: „Selbst wenn sie manche Leute zu einem Verhalten trieb, das den Verdacht nahelegte, dass es da keine Liebe mehr gab und vielleicht nie gegeben hatte.“
Wenn Pauls Existenz eine gescheiterte ist, dann deshalb, weil er diese Worte nie zu Susan sagen konnte, das sie sie nie verstanden hätte. Dass die Liebe bleibt. Für ihn. Sie hätte niemals verstehen können, dass die Liebe für Paul das einzige gültige Glaubenssystem darstellt und sein Leben sinnvoll gemacht hätte, eben weil sie alles andere als leicht ist.
Ich habe von Julia gehört. Man sagt, sie sei glücklich.
Jo Balle - 24. März 2019
ID 11300
Link zum Roman
Die einzige Geschichte von Julian Barnes
Post an Dr. Johannes Balle
BUCHKRITIKEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
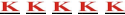
= nicht zu toppen

= schon gut
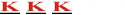
= geht so
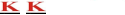
= na ja
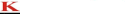
= katastrophal
|