|
Gelebte
Demokratie
|
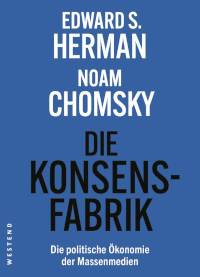
|
Bewertung: 
In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts fand innerhalb der Allgemeinen Sprachwissenschaft statt, was man mit Fug und Recht eine Revolution nennen darf. Dass man sie, wie so vieles, an Westdeutschlands Universitäten um gut ein Jahrzehnt verschlafen hat, während in der benachbarten Tschechoslowakei und auch in der DDR längst Institute und einzelne Linguisten unter ihrem Einfluss forschten, sei nur nebenbei erwähnt für jene, die sich überschlagen im Stolz auf die westliche Freiheit und in der Überzeugung, im „Kommunismus“ habe es nur geistigen Stillstand gegeben. Der Amerikaner Noam Chomsky hatte sich gefragt, wie es komme, dass Kinder überall auf der Welt in relativ kurzer Zeit erlernten, richtige Sätze in ihrer Sprache zu bilden, die sie so noch nie gehört hatten. Er entwickelte eine universale Theorie der sprachlichen Strukturen, die er mathematischen Theorien anzunähern versuchte und die er „Generative Grammatik“ nannte.
Ausgerechnet dieser Mann, der als Wissenschaftler nach naturwissenschaftlicher Exaktheit auf einem traditionell geisteswissenschaftlichen Gebiet strebte, der also Sprache zunächst von ihren sozialen und historischen Determinationen zu abstrahieren trachtete, mischte sich, zunehmend unter dem Eindruck des Vietnam-Kriegs, in gesellschaftliche Angelegenheiten ein. Er schrieb über die Verantwortung der Intellektuellen (die damals auch im deutschsprachigen Raum diskutierte Oppenheimer-Problematik), beschäftigte sich mit dem Anarchismus, den bei uns viele nach wie vor mit Terrorismus assoziieren, aus Unkenntnis und weil jene Kreise, die von einer Theorie der Herrschaftslosigkeit etwas zu befürchten haben, dieses Missverständnis bewusst schüren. Der mittlerweile 94-jährige Noam Chomsky, der als Typus alles eher ist als ein eifernder Fanatiker, kritisierte die Außenpolitik seines Landes und die Willfährigkeit der Medien und wurde, was manche Amerikaner mit guten Gründen das Gewissen der Nation nennen. Charakteristisch für Chomskys Engagement war seine Kolumne in der kleinen Zeitschrift Lies Of Our Times. Der Titel ist ein Wortspiel. Er meint einmal die Lügen unserer Zeit, dann aber vor allem die Lügen der (New York) Times. Das Magazine to Correct the Record hat es sich zur Aufgabe gemacht, festzuhalten, wo die amerikanische Presse und insbesondere die New York Times direkt lügen oder indirekt, indem sie Nachrichten und Tatsachen unterdrücken. Chefredakteur war der 2017 verstorbene Volkswirtschafter Edward S. Herman, der auch zusammen mit Chomsky drei Bücher verfasst hat.
Die Kanadier Mark Achbar und Peter Wintonick interessierten sich für diesen ungewöhnlichen Mann und stellten 1992 einen Dokumentarfilm von 165 Minuten Überlänge vor, der in Kanada zur erfolgreichsten Dokumentation aller Zeiten und auch im Ausland, vor allem auf Festivals, vielfach beachtet wurde. Er hat offensichtlich zu einer vermehrten Lektüre von Chomskys meist in entlegenen Verlagen erschienenen politischen Büchern beigetragen.
Ungewöhnlich in unserer lesefeindlichen Zeit: 1996 wurde im kleinen Marino Verlag auch ein Buch nachgeliefert, das den Film ins Medium des gedruckten Worts mit Fotoillustrationen übersetzt und dabei auch Passagen festhält, die im Film lediglich aus Zeitgründen geschnitten werden mussten. Der von Chomsky und Herman übernommene Originaltitel Manufacturing Consent wurde, etwas reißerisch und irreführend, durch Wege zur intellektuellen Selbstverteidigung ersetzt. Nur im Untertitel taucht das Stichwort "Fabrikation von Konsens" auf. Sei's drum. Jedenfalls konnte jetzt auch der deutschsprachige Leser erfahren, wie und warum die Presse Jahrzehnte hindurch den
Völkermord in Osttimor verschwieg. Er konnte überprüfen, wie Chomsky in Gesprächen, Artikeln, Büchern und Reden argumentiert, etwa in seiner Kritik am Golfkrieg und an der Berichterstattung darüber, etwa über die Palästinenserpolitik Israels, etwa über die Einmischung der USA in Nicaragua. Und er konnte sich davon überzeugen, wie die feinen Herrschaften in den Medien und den Universitäten ihre Conténance verlieren, wenn es ans Eingemachte geht. So ereiferte sich der Präsident der Boston University in einer Diskussion mit Chomsky: "Sie sind ein Scharlatan, Mister, und es wird höchste Zeit, dass die Leute Ihr Geschreibsel auch mal so einschätzen."
*
Jetzt ist Die Konsensfabrik. Die politische Ökonomie der Massenmedien von Noam Chomsky und Edward S. Herman, 35 Jahre nach der Erstveröffentlichung und bis heute von keiner Publikation zum Thema überboten, in seiner vollen Länge, sorgfältig ediert, mit den umfangreichen Vorwörtern von 1988 und 2002 und einer ebenfalls ausführlichen Einleitung in deutscher Übersetzung im Westend Verlag erschienen. Wer an einer linken Kritik an den Massenmedien sowie an der Politik der USA interessiert ist, sollte das Buch als Pflichtlektüre betrachten. Es liefert ein Modell dafür, wie intelligente und redliche Menschen mit dem Staat, dessen Bürger sie sind oder mit dessen Bürgern sie sich identifizieren, mit dessen Regierung und dessen Meinungsmachern umgehen sollten, Amerikaner mit Amerika, Russen mit Russland, Ungarn mit Ungarn, Israelis mit Israel, Deutsche mit Deutschland. Das ist nicht Mangel an Patriotismus, das ist nicht antiamerikanisch, antirussisch, antiungarisch, antisemitisch, antideutsch, sondern das genaue Gegenteil. Indem es Demokratiefeindlichkeit und Staatsverbrechen im eigenen Land anprangert, ist es gelebte Demokratie. Auch wenn die Konsensfabrik das bestreitet und bekämpft. Manufacturing Consent: Sie will Konsens herstellen. Auch wenn es bisweilen angesichts der Macht- und Besitzverhältnisse hoffnungslos erscheint: man kann Widerstand leisten.
Thomas Rothschild – 5. September 2023
ID 14375
Verlagslink zur
Konsensfabrik von Chomsky/Herman
Post an Dr. Thomas Rothschild
Bücher
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
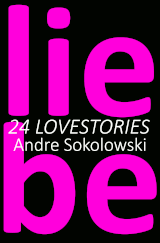
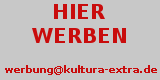
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE

= nicht zu toppen

= schon gut
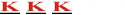
= geht so

= na ja

= katastrophal
|