|
Jacques
und der
König
|
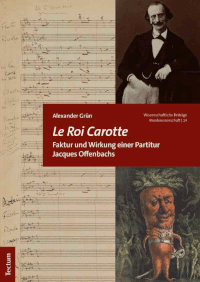
|
Bewertung: 
Das Konfetti ist längst weggefegt und der Champagner ausgetrunken: Das zweite Jacques Offenbach-Jahr in Folge biegt in die Schlusskurve. Und? Ist etwas hängengeblieben? Das auf jeden Fall. Für die große Renaissance hat es zwar nicht gereicht, noch nicht, aber selbst in zermürbenden Corona-Zeiten konnten einige prägnante Akzente gesetzt werden, vor allem im Bereich der Raritäten. Bru Zane räumte mit der Einspielung von Maitre Péronilla etliche Preise ab, cpo veröffentlichte Aufnahmen von Pomme d'Api, Sur un Volcan sowie Le Royaume de Neptune, und landauf-landab wurden seltene Einakter wie Ba-ta-clan aufgeführt, wenn auch kurz darauf zum zweiten Mal der Lockdown-Vorhang fiel. Zudem sind gerade zwei bemerkenswerte Bücher erschienen, in denen jeweils ein Bühnenwerk Offenbachs als musikwissenschaftliches Forschungsobjekt im Mittelpunkt steht: Anatol Stefan Riemer geht in Die Rheinnixen contra Tristan und Isolde an der Wiener Hofoper (Frankfurter Wagner-Kontexte, Band 3) Offenbachs romantischer Oper auf den Grund; Alexander Grün analysiert auf unglaublichen 514 Seiten Faktur und Wirkung der Opéra-bouffe-féerique Le Roi Carotte.
Das zweite Stück genießt unter Offenbachianern absoluten Kultstatus, auch weil alles an ihm XXL ist. Zuletzt trieb König Karotte an der Staatsoper Hannover sein unterhaltsames Unwesen, allerdings als szenisch derart flache Flunder, dass man in der Pause die Flucht aus Krokodyne antrat. Von der Gemüseoper gibt es nur sehr wenig Konservenkost: Abgesehen von einigen einzelnen Nummern existiert eine deutschsprachige Gesamtaufnahme des Hamburger Archivs für Gesangskunst von 1986 - mit Rosemarie Fendel als Hexe Coloquinte; Caspar Richter dirigiert das RSO Frankfurt. Umso großartiger ist es, dass nun dieses Buch von Alexander Grün vorliegt, welches die volle Pracht des hybriden Werks entfaltet.
Den Anfang nutzt der Autor vor allem dazu, alte Offenbach-Klischees aus dem Weg zu räumen: Dass seine Opern nicht nur in parodiefreudige Töne gekleidete Gesellschaftssatiren sind (S. 4), er kein “Empire-Kapellmeister von Napoleons Gnaden” war, “dessen Werk man nicht recht ernstnehmen könne und brauche” (S. 8), und es auch keinen “Abstieg” im Zuge des deutsch-französischen Krieges gab (S. 64). Völlig zu Recht bemerkt Grün, dass das durch Klavierauszüge geprägte Meinungsbild grundlegend falsch ist und über Offenbach längst nicht alles gesagt sei - “Das Gegenteil ist der Fall” (S. 4). Und auch wenn man von fragwürdigen Interpretationen liest, von willkürlichen Kürzungen, zweifelhaften Übersetzungen (S. 8) und überforderten Regisseur*innen (S. 443), verfällt man in zustimmendes Nicken.
Hierauf schwenkt Grün konkret auf das Werk und dessen Uraufführung, liefert Fakten wie die Gagen des Bühnenpersonals (S. 48), Höhe der Eintrittspreise (S. 152/153), sogar etwas Gossip (Bühnenunfälle S. 118/119, konkurrierende Sängerinnen S. 309/401) und zeichnet en détail die Entstehung des Roi Carotte nach, welcher schlussendlich auf eine stattliche Größe von 30 musikalischen Nummern heranwächst (S. 80/257). Höchst aufschlussreich ist die Aufzählung der vielen Inspirationsquellen Victorien Sardous (S. 180) sowie die Schilderung von Offenbachs schreibökonomischer wie akribisch organisierter Arbeitsweise (S. 194/200). Außerdem gefallen die sinnfällig platzierten Abbildungen, beispielsweise wenn von Figuren und Tableaus die Rede ist.
Wer sich recherchierend mit “Monsieur Offenbak” beschäftigt, bekommt augenblicklich die schwierige Quellenlage zu spüren. Was oftmals fehlt, sind zuverlässige Aufführungsmaterialien, da sich ein Großteil der Autographe in privater Hand befindet oder für immer verloren ist. Auch lassen sich die unzähligen, aber winzig geschriebenen Briefe Offenbachs nur schwer entziffern (S. 16). Im Fall von Le Roi Carotte konnte Grün u.a. die rund 550-seitige autographe Partitur, das vollständig erhaltene Zensurlibretto, den (offenbar leserlichen) Briefwechsel Offenbach/Sardou und 77 farbige Figurinen sowie drei dreidimensionale Bühnenbildmodelle studieren. Das Ergebnis wird im zweiten Teil des Buches präsentiert - und zwar Nummer für Nummer. Wer an dieser Stelle knochentrockene Lektüre vermutet, wird eines Besseren belehrt, denn Grün wirft hier eine Menge spannender Schlaglichter. Welchen Anteil an der Partitur hat der Dirigent der Uraufführung, Albert Vizentini? Wie komponiert Offenbach reißende Hosen oder Karottes Niesen? Was bedeuten die Namen der Figuren? Warum ist das Werk ein Genremix? Sie erfahren es auf den Seiten 287 bis 440.
Gibt es Mankos? Ob Le Roi Carotte aufgrund einer Affeninsel als Vorläufer der Science-Fantasy gelten kann, ist Ansichtssache (S. 443). Meiner Meinung nach trifft das eher auf Offenbachs Die Reise in den Mond zu. Was jedoch wirklich betrüblich ist: Die vielen, vielen Passagen französischer Zeitungsartikel werden allesamt in Originalsprache zitiert; es gibt keine deutsche Übersetzung. Wer also nur das Schulfranzösisch drauf hat oder gar kein Französisch spricht, guckt in die Röhre. Dabei fällt auf, dass Grün an anderer Stelle deutsche Übersetzungen übernimmt, etwa einen Bericht von Ludovic Halévy, zitiert nach dem Offenbach-Biografen Anton Henseler (S. 194). Und dann das Schlusswort. Grün lässt sich zu einem Vergleich hinreißen, den man nicht unkommentiert stehen lassen kann, nicht nach so viel Lektüre über etwas, das einzigartig ist. So wie Offenbach nicht der “Mozart der Champs-Élysèes” ist - was angeblich Rossini gesagt haben soll -, ist auch Le Roi Carotte nicht “die Zauberflöte des 19. Jahrhunderts schlechthin” (S. 448). Offenbach ist Offenbach ist Offenbach und als solcher ein Original. Was dieses Buch wiederum eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Heiko Schon - 18. Dezember 2020
ID 12658
Tectum-Link zu
Le Roi Carotte
Post an Heiko Schon
Bücher
Premieren (vor Ort)
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
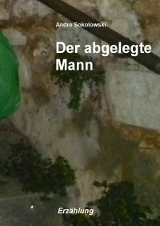
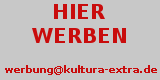
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
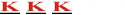
= geht so

= na ja

= katastrophal
|