Bernhard Heiliger Stiftung, Berlin
Heiligers Augen oder
die Bewegung der Skulptur in der Hand.
Text: Gerald Pirner
Foto: Adel
|
Wort- und bildlos ist Berührung ein Angriff, Tasten immer mit Zerstörung und Zersetzung verbunden… Nicht allein physisch liegt darin eine Bedrohung für den Tastenden und das, was betastet. Die Wahrnehmung selbst, zerstückt in der Hand, reißt Fetzen nur aus Berührtem. Noch am eigenen Körper die Hand bildlos, bleiben ihr nur Fragmente und als Fragment wird sie gespürt. Der Blinde ist sich selbst immer Torso. Kein Bild hält für ihn Ganzes bereit. Sich tastend Bildhauerei und Plastik zu nähern, was im Folgenden aus der Hand eines Blinden in Sprache gebracht werden soll, heißt zuerst von Vermittlung von Kunst als einem Gegenstand Abstand zu nehmen. Statt dessen setzt das Folgende auf eine offene Praxis der Kunsterfahrung, die in Berührung und Bewegung der Hände Materialspuren nachzutasten sucht, ohne dabei das Ertastete zu einem bildhaften Abschluss bringen zu können oder zu wollen – auch auf die Gefahr hin, dass Kunst und Künstler in einem von Händen dergestalt entleertem Raum verschwinden…
Die Bernhard Heiliger Stiftung geht ein solches „Risiko“ ein und eröffnet damit ganz neue Wege der Werkrezeption des 1995 verstorbenen Bildhauers und Plastikers Bernhard Heiliger. Zunächst - mittels Führungen freilich - allein der kleinen Schar von Blinden und Sehbehinderten vorbehalten…. Vielleicht aber trägt dieser Artikel dazu bei an-Hand, und das ganz wörtlich gemeint, einiger ausgewählter Exponate aus verschiedenen Schaffensphasen Heiligers – der der Porträtköpfe etwa aber auch Arbeiten aus der abstrakten und der konstruktivistischen Phase – mittels Tasten, Berühren und Be-Greifen einen ganz unmittelbaren Zugang zu Heiliger Œuvre, ja zu Skulptur und Plastik überhaupt zu finden.
Geleitet und mit Beiträgen zu Leben und Werk des Künstlers versehen, wird die Ateliersbegehung von der ebenfalls erblindeten Indologin Anja Winter, die Blinde und Sehbehinderte bereits durch die Heiliger Retrospektive im Gropiusbau geführt hatte und die ähnliche Führungen anhand von Themenschwerpunkten auch im Museum für Indische Kunst in Dahlem anbietet.
Die Initiative der Heiliger Stiftung und ihrer Vorsitzenden Sabine Wellmann-Heiliger, der Witwe des Künstlers, ist auch insofern äußert begrüßenswert, als dem Autoren außer dem Ägyptischen Museum, dem Georg Kolbe Museum und einigen wenigen Galerien, kein Ort bekannt ist an welchem Blinden es gestattet wäre, sich skulpturaler Kunst tastend anzunähern.
Der große Atelierraum, neun Meter hoch ohne dass das zu hören, eine kompakte Akustik, kein Ton entkommt in ein von Hall geöffnetes Außen…
Der Gebäudekomplex, für den faschistischen Bildhauer Arno Breker errichtet „…damals mitten in den Wald gebaut“ wurde von diesem aber nicht bezogen, zog Breker es doch - letztlich auch aufgrund der Bombardierung Berlins – vor, mit den Hundert ihm von der Faschistenführung für seine Monstrositäten zugeteilten Zwangsarbeitern in Wriezen zu bleiben. Nach dem Krieg wurde der Gebäudekomplex aus Backstein verschiedenen Künstlern zur Ateliernutzung überlassen; u. a. arbeiteten hier neben Heiliger Vedova und Vostell, letzterer bis zu seinem Tode.
Heiliger, der selbst einige Jahre bei Breker studierte, sich frühzeitig allerdings in Politik und Werk von ihm distanziert hatte, bezog die ihm vom Senat zugewiesenen Räumlichkeiten zunächst eher zögernd; zu frisch war die Erinnerung an eine Kunst, die in Leichenberge gepflanzt…
Stellt von diesem Grauen her der Begriff der Berührung selbst sich nicht ganz und gar neu? Was bleibt von Augen die das gesehen haben? Von der Sprache wird „Berührung“ als Grenzhaut zwischen Außen und Innen gezogen, als Scheide des, dem Seelischen zugedachten Empfindens, vom Tasten. Was aber wenn Hand und Finger eines Blinden unvorbereitet in Augen geraten, die wie durchschnitten…. Deren Lider als verkümmerte Hautfetzen wie zur Seite geschoben, Pupillen herausgeschnitten oder durchbohrt.
Vier Köpfe.
Nein, kein Lid umrandeter Kugelausschnitt, kein ebenmäßig gearbeiteter Ausdruck von Vollkommenheit und Ganzheit, an Köpfen von Göttern, Helden, Königen und von Bourgeois uns aus Antike und Klassizismus herkommend, findet sich bei Heiliger an Stelle der Augen. Bereits am ältesten der vier im Atelier befindlichen Porträtköpfe, dem der Fotografin Gerda Schimpf von 1948 nimmt Heiliger den mandelförmigen Schnitt eines Auges ganz wörtlich, indem er ihn der Länge nach durchspaltet, dabei an den Andalusischen Hund von Louis Bunuel erinnernd, in dessen Anfangsszene ein Rasiermesser durch einen Augapfel gezogen wird… Scharfkantig das Rund herausgeschnittener Pupillen am Porträtkopf Karl Hofers (1951) Löcher in ein Innen von keinem „Filter“ geschützt, geöffnete Augen im wahrsten Sinne des Wortes, alles vermag einzudringen und kommt doch nicht hinein…
Die durch Brillengläser herausplatzenden Augen der überlebensgroßen Max-Planck-Skulptur von 1948-49 (getastet in der Gropiusbau-Retrospektive) scheinen mit ihren Blick - und auch hier spielt Heiliger mit Worten - alles zu durchbohren, zu durch-blicken. Ähnlich wie am Porträtkopf des Malers scheint auch am Körper des Physikers eine Kraft am Werke, die ihn, die Hände auf den Katheder gestützt, zur Seite wegzuziehen sucht. Am Porträtkopf Hofers, halslos aufliegend dieser am linken Rand eines nach rechtshin abfallenden Körper-Fleisch-Restes, wirkt diese Kraft, diese Bewegung zudem ins Innere des Kopfes selbst hinein: einem Soge gleich zieht sie die Augen in Höhlen zurück, so dass von dieser Tastbewegung her die Puppillenlöcher nach Innen geplatzt erscheinen. Überhaupt ist es diese innere Bewegung, die die Werkphasen Bernhard Heiligers, freilich immer wieder vollkommen unterschiedlich umgesetzt, miteinander verbindet. Solche Unterschiede vor allem an Intensität und Wucht eben angesprochener Bewegung, lassen sich bereits zwischen den beiden im Atelier befindlichen „Frauenköpfen“ – neben Gerda Schimpf der Porträtkopf der Tänzerin Katherine Dunham (1954) – und den beiden „Männerköpfen“ – Karl Hofer und Theodor Heuss (1960) – ertasten. Während bei Hofer allerdings diese Kraft der Bewegung gleichsam nach Innen wirkt, platzt sie die Gesichtsanatomie des ehemaligen Staatoberhauptes mit solcher Wucht nach Außen, dass der Mund als einzig ruhender Pol solch berstender Physiognomie von Heiliger nur geschlossen dargestellt werden konnte, auf dass nichts durch seine Öffnung hinausgeschleudert. Falten zu schroffen Graten aufgeworfen reißen die Hand hinten nach unten… Der Schädel, Reste einer tastbaren Matrix mit Fleischlappen notdürftig bestückt, da hinein Lider geheftet, Spuren anatomischer Orientierung in etwas, das Heiliger selbst einmal „Kopflandschaften“ genannt. All dieser nach vorne drängenden Wucht scheint ein Schlag von rechts, die Spuren handballengroß am oberen Schädelteil, Gegengewicht zu geben: die Hände wie von einem imaginären Querbalken nach links geführt und von dort nach hinten, in ihrer Bewegung das Gewicht fassend, von dem letztlich nicht gesagt werden könnte, ob es den Rumor des Kopfes nicht selbst nach vorne treibt.
|
Ganz anders die Porträtköpfe der beiden Frauen. Leicht wellig bis rau und die Hand dadurch bei sich haltend, die Oberfläche des Porträtkopfes Gerda Schimpfs, patinierter Gips sich beinahe wie Bronze anfühlend, stumpf allerdings nach Innen in seiner Berührung: alles Betastete den Eindruck von Aufgetragenem erweckend… Glatt und an Stein denken lassend der Porträtkopf Hofers, an welchem die Hand abgleitet so als wolle er sie schnellstens loswerden… Bei den beiden Frauenporträts die innere Dynamik im Rhythmus anatomischer Markierungen gebändigt, sie nach vorne hin weich auslaufen lassend am Porträtkopf Gerda Schimpfs, gebrochen skandiert in hervortretenden Knochen von Backen und Kiefer am Zementkopf Katherine Dunhams, dessen Oberfläche mit ihrem weichen klebrigen Staubüberzug die über sie streifenden Finger ins Gleiten und ins Rutschen bringt, sie zum Nachtasten zum Nachfühlen verleitend, obschon der weiche Staub von der spürbaren Härte des Materials ablenkt, einer Härte, die ihn wie organisch aus ihrem Inneren selbst hervorzubringen scheint, indem sie alles Poröse in Staubesgestalt ausscheidet.
Die Hand der Kopf der Rhythmus
Teilweise die Köpfe wie der Gerda Schimpfs auf Metallstäbe gesteckt, Körperfragmente dabei präsentiert, die an das fragmentierende Tasten des Blinden erinnern, hinterlässt dieses, alle Psychologie eines Gesichtes, allen Ausdruck zersetzend, einzig Abdrücke/Eindrücke des Berührten, in Finger- oder Handgestalt aus ihm herausgeschnitten, das Ganze des Berührten dabei aber immer zerstörend, ein immer scheiterndes Erkennen, das kein Gesicht im Eigentlichen wahrzunehmen vermag und den blinden Wahrnehmenden in seiner eigenen Fragmentiertheit zurücklässt. Zurückgelassen er mitsamt dem Berührten das, wie an all den durchstreiften durchtasteten Porträtköpfen zu spüren, in dieser Bruchstückhaftigkeit selbst als Plastik ausgebrochen erfahrbar wird. Jenseits dieser existenziellen Erfahrung des Fragmentiertseins im Tasten – zumal im Be-Tasten und Be-Rühren von Plastik oder Skulptur – der auch Sehende in ihren sie bespiegelnden Körperbildern nicht zu entgehen vermögen, wird Sehen doch, wie die Hirnforschung lehrt, nicht im Auge erstellt sondern im Hirn „erdacht“, bleiben zwei Momente der blinden Rezeption von Bildhauerei und Plastik, denen entlang über Kunst und Ästhetik nachzudenken mir mehr als lohnend erscheint: die Berührung als Ein- und Ausschnitt einerseits und die Bewegung als von ihr skandierte Aufnahme eines Oberflächenrhythmuses durch das Streifen der Hände andererseits – entfernt diese dabei freilich im ganz bewussten Zugreifen, Zufassen, Berühren einzig im Berühren reflektiert, von der Matrize eines Gesichtsbegriffes, dem im anatomischen oder physiognomischen Anhaltspunkten herkömmlicher Weise einfach nachgegrapst wird, und das gerade von Blinden, nicht selten vom Ehrgeiz erpackt, noch sehender sein zu wollen als die Sehenden. Von daher erscheinen die plastischen Hautfetzen und Fleischlappen im Porträtkopf Theodor Heussens etwa, nicht als Ausdruck expressiv gestalteter Physiognomie, zumindest nicht allein: im Berühren werden sie zu einer besonderen Art der Skandierung der handführenden Bewegung, die, immer wieder wiederholt von all den Oberflächen Verrauungen und Ausstülpungen, von all den Graten Gravuren, von all den Wülsten Rundungen Furchen Schnitten Rissen und Löchern in eine Art Schwung, in eine Art Rhythmus getrieben, von denen der Sehende zwar zu sprechen vermag und dies in der Bildhauerei auch sehr häufig tut, der in den blinden Händen - oder überhaupt in Händen die bildlos sich Skulptur und Plastik hingeben - erst und tatsächlich lebendig wird. Um nicht missverstanden zu werden: dies ist kein Loblied eines Blinden auf seine Blindheit; im Gegenteil es ist die Erfahrung eines Blinden häufig nicht blind genug zu sein, sich nicht genügend auf die zuweilen zerstörerische Kraft seines Körpers einzulassen. Denn bildlos zerstört die Hand in ihrem Griff, nichts vermag ihr ganz zu bleiben. Sie erfasst weder Bedeutung noch Wesen, sie fasst an Bezeichnendes, ohne dass solch Zeichen präzise wenn überhaupt „seinen Gegenstand“ fände. In der blinden Hand entleert das Zeichen sich seiner Bedeutung. Anatomische und physiognomische Markierungen, Spuren des Bildhauers unterwirft sie einem Oberflächenrhythmus, der von solch Aufgefundenem skandiert, in ihrer Bewegung sich verfestigend, wiederholbar wird.
Die Gestalt der Bewegung
Leicht aber glitte solcherlei Tasten und Streifen in Beliebigkeit ab, hielte es sich nicht immer eng an der ertasteten Plastik. Allein ihr, und in jedem Moment ganz bewusst ergeben, geführt gleichsam von ihr, wird ein Abgleiten in den Gegenpol zur Identifizierung, einer schlicht als angenehm empfundenen Sinnlichkeit (hart an der Grenze zur Kunst-Wellness) der hier genauso wenig das Wort zu reden wie dem Erkenntnis- und Identifizierungszwang des Sehenden, verhindert - vielleicht auch dies ein Grund für die Entscheidung der Heiliger Stiftung die teilpolierten Bronzeplastiken Heiligers nur mit Handschuhen berühren zu lassen…. In jedem Falle ist das Tragen von Handschuhen für das Berühren polierter Bronze nur zuträglich, schliert die bloße Hand in ihrem Streifen über sie an einem gewissen Punkte nur über ihre eigenen Fettspuren, sich stockend und stolpernd dabei vor lauter Sensitivität um Schwung und Rhythmus des Berührten bringend.
Diesem Rhythmus, genauer diese in Rhythmus tastbare Bewegung suchte Heiliger in späteren Werken wie der teilpolierten Plastik Naissance d´une forme (Die Geburt der Form) von 1980 und der Gipsplastik Seraph I (1950) selbst Gestalt zu geben.
Ein Riss am Torso hoch, als wäre die Figur derer sich der Schwung hier bedient seiner Wucht nicht gewachsen… Beine Arme oder Brust hier erkennen zu wollen hieße die Bewegung verraten, die solche Glieder zu ihrer Darstellung nur vernutzt – Seraph I, die Zahl deutet darauf hin, nur eine unter mehreren Erscheinungsmöglichkeiten von etwas ansonsten gänzlich Unfassbarem; Seraph I, Kontraktion einer Geste auf das zu ihrer Ausführung Nötigste, was anders denn ein Torso könnte davon zurückbleiben; Seraph I, Spur der Kündung wie aus den Tagen der Prophetie zwischen Ausruf und Aufbruch…
Naissance d´une forme - eine geschwungene Platte, raurissig die Oberfläche, aus ihrer Mitte ein poliertes Eirund berstend, das sie zerreist, zu ihrer Gestalt erst krümmt; an der Seite dieser bergenden Schroffheit ein weiteres poliertes Stück, genauer eine Stelle poliert an ihr zu tasten, das ihr Innen ahnen lässt, sie zum Außen erst macht, zum Äußeren, zum Äußersten dessen was aus ihr hervorbricht… Form aus sie hegender Vorform, Bewegung als Zeit in Darstellung zweier Phasen ausgespannt… Die an den Köpfen stark spürbare Unruhe wirkt in Heiligers teilpolierten Plastiken eher gebändigt. Zwei Pole erscheinen da, die von Erreichbarkeit und Abschließbarkeit sprechen, von erfüllbaren Zeitabschnitten, von Entwicklung, von Richtung, ja vom Entkommenkönnen - gleitet die Hand doch allzu gern aus einer in sie schneidenden ritzenden Bronzeoberfläche zu deren herauspoliertem Teil, lässt diese Schroffheit die Hand aus ihrem unwirtlichen Gefild allzu leicht ins Weiche Glatte tasten… Erst der Unterschied, hier der in der Bearbeitung ertastbar, erlaubt es der Berührung von Form zu sprechen: ein sprachlicher Trick dies? Eine Begriffsentscheidung ganz nahe an den „Gesetzen der Form“ (Spencer-Brown) des radikalen Konstruktivismus für den „Form“ mit „Unterscheidung“ beginnt? Merkwürdig dabei allerdings, dass ins Körpergedächtnis dessen, der tastend den Porträtköpfen näher zu kommen sucht, sich keine Formen einschreiben, eher im Handgriff herausgerissene Gestalten. Ganz anders die konstruktivistischen Arbeiten und hierin zumindest den teilpolierten Plastiken nahe, finden doch auch sie in Formen der Abgeschlossenheit – einer tastbaren Kugel etwa, einer tastbaren Welle, eines tastbaren Berges – gleichsam von Außen zu ihrem Rhythmus, die Hand dabei etwas abschließen lassend, das begrifflich vorgegeben und das im Tasten auch nur wieder zum Begriffe führt, der wie Berg und Kugel oder Welle und Kugel (1974) obendrein als Titel vorgelegt. Die Hand wiederum löst ganze Teile aus den Konstruktionen, zerlegt diese in sich wie industriell gefertigt anfühlende Gegenstände, in bloße Tasteinheiten, die in den Bewegungen von Berühren und Fühlen die Hand bei sich lassen, darin in gewisser Weise – Heiliger möge es mir verzeihen – an minimalistische Objekte erinnernd, wo auch sie doch in ihrer Er-Fassung alle tröge Inhaltsschwere abfallen lassen: Wahrnehmung zur Wahrnehmung der Wahrnehmung führend, zu einem Punkte an dem es nicht weiter geht und auch nicht weitergehen muss, an dem die Hand schlicht eine Bewegung vollzieht und nichts als der Vollzug dieser Bewegung selbst ist. Gegenstand und Hand allein Mittel dieser Bewegung, die Blöße der Hand, Blöße dieser Bewegung selbst…
Das Ende der Figur
Zieht einerseits Naissance d´une forme Befreiung ganz abstrakt in die Form des Werkes, vielleicht der Kunst überhaupt zurück – auch an anderen teilpolierten Plastiken wie etwa der in der Gropiusbau Retrospektive zu tastenden Entfaltung ist solche Hermetik, die einzig von der Geschichte ihrer Erstellung zu sprechen weiß spürbar – kann andererseits auch die Entwicklung eines zunächst stark politischen Ansatzes Heiligers hin zu einer gewissen Resignation an einigen seiner Arbeit geradezu nachgetastet werden.
|
Stellte man etwa Denkmal des Unbekannten politischen Gefangenen von 1952 (Gropiusbau Retrospektive) und Gefangener III (1956/60) nebeneinander, so fände sich in der ersten Version ein zerrissener Torso inmitten von Gefängnisgestänge, trennbar von diesem allerdings oder gelöst, trotz seiner Zerrissenheit also „befreibar“, während Gefangener III eine Herauslösung der Körperteile aus den sie durchbohrenden oder eher aus ihnen herausgewachsenen Gitterspießen – in Knubblichkeit und Rauheit Geäst ganz ähnlich – vollkommen unmöglich erscheinen lässt. Die Gefängnisgitter, mit dem Körper ganz verwachsen, wird der Mensch im Aufstand oder Systemwechsel nicht mehr los… Den Machtbegriff Michel Foucaults vorwegnehmend, wird in Gefangener III eine jede Bewegung des durchbohrten Körpers zur Bewegung der Gitterstäbe selbst die so, Marionettenlatten gleich, allen Konflikt als machtimmanent einzig be-greifbar werden lassen.
Das Streifen über den hochgeblähten Körper der Bronzeplastik Kleiner Phönix II (1961) – ein Echo davon aus seinem entleerten Innern wie gehaucht zu hören, auch akustisch ein Gegenstück zur undurchlässigen Entschiedenheit von Welle und Kugel …. Eine geschundene durchlöcherte Tierhaut, mit der Haut des Tastenden schmerzhaft sich austauschend, Federn bis auf den Kiel blank geschabt, die Handknöchel darüber gestreift, macht das Geräusch einer Maschinengewehrgarbe, irgendwo aus seinem Rumpf geleert hörbar, durch Hautfetzen noch offene Narben und klaffende Löcher eher ausgedünstet als herausgeklungen, und nur eine Frage noch, die nämlich, in welches Leben da hinein wieder und immer wieder geboren, das so doch mit seiner Kreatur umgeht… Nochmals die Knöchel an verschiedenen Stellen aufgeklopft aber immer die gleiche Leere, so als habe alles Innere sich in Gestalt veräußert, so als gäbe es nicht mehr, so als gäbe es nicht mehr her, als diese sinnlose Wucht von Federn und Fleisch, die nicht mehr kann, die nicht mehr will und die dennoch immer wieder muss, eine Innschrift des Körpergedächtnisses dabei zitierend: die Grabskulptur Giacomettis in Stampa – ausgeplatzte Poren die alle Organöffnungen überflüssig machen. Aller Stoffwechsel alle Aufnahme alle Ausscheidung aus und durch sie ohne Handlung ohne Bewegung ein zu Tode gekommener Organismus der dennoch nicht aufhört zu atmen…
|
| Freilich bliebe da noch der Optimismus des Explorer (1976-77), Aluminiumrinnen sich nach oben hinausschiebend, im Klang ganz flach, wo es doch hinaufgeht, als gäbe es, noch dazu angestoßen von einer Art metallmassiven Sporn im rechten Winkel von vorne, nichts weiter zu sagen und erst recht keinen Zweifel, dass alles immer höher besser und weiter wird… Eine Ironie Heiligers? In jedem Falle eine weitere Ausgestaltung des Begriffes der Bewegung, dem heimlichen Hauptmodell des Heiliger Ateliers, dem hier mit bloßer Hand ein wenig nachgetastet nachgespürt werden sollte, und das freilich mit der Hoffnung, dass dem Beispiel der Heiliger Stiftung noch viele Ateliers, Museen und Ausstellungen folgen mögen, Blinden und Sehbehinderten Kunst weniger durch Audioguides anekdotenartig zu vermitteln, sondern sie selbst Pfade und Schleichwege zu Plastik und Skulptur erkunden zu lassen.
|
Text: Gerald Pirner - red / 5. Juli 2006
ID 00000002520
Bernhard-Heiliger-Stiftung
Käuzchensteig 8 · 14195 Berlin
Fon: 030-831 20 12 · Fax: 030-831 64 35
e-mail: info@bernhard-heiliger-stiftung.de
Anja Winter: tel.: 030/76769909 und anjawinter@ngi.de
Weitere Infos siehe auch: http://www.bernhard-heiliger-stiftung.de
|
|
|
Anzeigen:
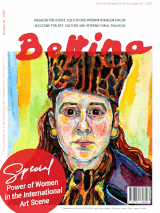
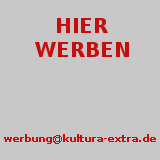

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk

= nicht zu toppen

= schon gut
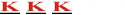
= geht so

= na ja

= katastrophal
|