 |
|
|
 |
15. Dezember 2004 – 8. Januar 2005
Reisebericht
Senegal
TROMMELN IM AFRIKANISCHEN BUSCH
|
Erst vor zehn Tage aus dem Kongo zurückgekehrt, stand ich bei eisiger Kälte in St. Petersburg auf dem Newskij Prospekt, als ich einen Anruf aus Deutschland erhielt.“ Lust auf ein Abenteuer im Senegal?“
In dieser traurigen russischen Kälte überfiel mich die Sehnsucht nach der Sonne Afrikas und ich sagte spontan zu. Ein paar Wochen später waren wir auf dem Weg nach Maastricht, von wo aus unsere Reise in den südlichen Teil des Senegal gehen sollte. Was uns dort erwartete, war mir noch immer ein Rätsel. Ich fragte nicht danach. Es war ein Trip ins Ungewisse und das suchte ich am meisten.
|
| |
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
ANTHOLOGIE
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
THEMEN
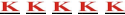
= nicht zu toppen

= schon gut
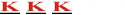
= geht so
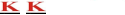
= na ja
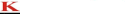
= katastrophal
|
| |
|
Mit dem Ferienflieger nach „back to nature“
| |
|
10.000 Meter über dem Mittelmeer herrschte kommerzialisierte Ferienfliegerstimmung. Weder Getränke noch die abgepackten, rationierten und exakt portionierten Flugzeuggerichte waren im Flugpreis enthalten. So tauschten wir untereinander belegte Brötchen gegen Gummibärchen und Caprisonne. Ich fühlte mich stundenlang wie auf einer Klassenfahrt, dabei wollte ich dem Konsumdenken doch so schnell wie möglich entgehen.
Ein leichtes Gruppenungefühl stieg in mir auf und ich wäre am liebsten über der einsamen Sahara abgesprungen. In dem Chaos am Flughafen hatte ich nicht ausmachen können, wer nun genau zu unserer Gruppe zählte.
|  |
|
Immerhin hatten wir mit 18 Leuten und jeder Menge Übergepäck am Flughafen eingecheckt. Ich kannte davon fast niemanden, nur Grischa, Tina und Anja waren mir als gute Freunde aus Berlin vertraut. All die anderen lernte ich erst kennen, als wir die Sahara schon weit hinter uns gelassen hatten.
| |
 |
SEN-JAM. Das ist der Name der Band, mit der wir die folgenden Wochen im Senegal verbrachten. Sie bestand aus mehreren Senegalesen und einigen Deutschen, die auch in Berlin oder in der Nähe von Düsseldorf wohnten. Grischa hatte früher in der Band gespielt und so das Angebot erhalten, mit zu intensiven Bandproben und einigen Auftritten in den Senegal zu reisen. So erklärten sich mir im Nachhinein auch das Übergepäck, welches in Maastricht auf das Band geladen und all die Instrumente, die irgendwo zwischen den Sitzen verstaut wurden.
| |
|
Wir waren ein bunt zusammen gewürfelter Haufen, gehörten verschiedenen Generationen an und kamen aus allen erdenklichen Lebensumständen. Plötzlich hatten wir ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Zeit vor uns.
Ein Cocktail aus Vorfreude, Erwartungen, Neugierde und Abenteuerlust ließ mich Stunden später kaum ruhig auf meinem 7B-Platz sitzen, berauschte mich langsam aber merklich. Ich konnte den Blick nicht vom Fenster lösen. Das Meer schien unendlich groß und die Sahara eine große Unendlichkeit. In diesem Moment verlor ich das Gefühl von Raum und Zeit, schraubte die Batterien aus meiner Armbanduhr heraus und zerbrach so mit voller Absicht die Bindung nach zu Hause: Weihnachten, Sylvester, Jahreswechsel. Das alles wollte ich weit hinter mir lassen, einfach nur ausbrechen aus der strukturierten, berechenbaren und sozial konstruierten Welt unserer ach so modernen Zivilisation.
| |
 |
Irgendwann als die Sonne nicht mehr im Zenit stand, landeten wir in Banjul, der Hauptstadt Gambias. Gambia liegt wie eine kleine Insel mitten im Senegal und trennt den trockenen Norden vom weit fruchtbareren Süden des Landes. Das afrikanische Organisationschaos brach unangekündigt über uns herein: Plötzlich waren da viele Menschen, die unsere zahllosen Koffer und Rucksäcke auf den Parkplatz schleppten. Mehrere hundert Kilogramm Gepäck wurden auf dem Dach eines Minibusses festgezurrt. Ich verlor den Überblick, wusste schon lange nicht mehr, wo mein Koffer hingekommen war.
| |
|
Knapp eine Stunde später war es mir egal und ich fühlte mich wieder angekommen in Afrika, welches ich im Kongo bereits einige Monate zuvor aus einem der schlimmsten Blickwinkel kennen gelernt hatte. Ich war auf vieles vorbereitet und suchte mit Absicht jenes Unvorhersagbare. Lange darauf warten musste ich nicht. Nach vielen Kilometern über sandige Schlaglochpisten erreichten wir die Grenze zum Senegal. Wir wanderten von einer Passkontrolle zur nächsten: Stempel, Registrierung, Gepäckkontrolle, Bestechungsaktionen. Dann mussten wir das Auto wechseln, einige Kilometer später auch den ersten und den zweiten Reifen.
In der Dämmerung hielten uns am Straßenrand Tee trinkende Gendarmen an. Sie zeigten auf den großen Pappkarton auf dem Dach, worauf ein nagelneuer Fernseher abgebildet war. Als sie ihn auspackten, glaubte ich meinen Augen kaum. Wir hatten wirklich einen Fernseher dabei!
Angestrengt wurde verhandelt, ohne Ergebnis. Der Fernseher blieb am Straßenrand stehen und Albèrt, einer unserer senegalesischen Bandmitglieder, blieb darauf sitzen, um mit den Uniformierten Tee zu trinken. Wir tuckerten weiter in unserem voll beladenen Minibus.
Spät am Abend kam auch Albèrt mit dem Fernseher wieder an. Nach dem dritten Tee hatte sich im Gespräch mit den Gendarmen herausgestellt, dass sie über einige Ecken verwandt waren.
Es war tiefschwarze Nacht, als wir irgendwo ankamen. Mit der Taschenlampe versuchte ich die Umgebung zu erkunden. Palmen, Gebüsch, kleine Hütten mit Bambusdach, mehr war nicht auszumachen. Ich setzte mich in den feinen Sand und schloss die Augen. Auf einmal war es schön, nicht zu wissen, wo man sich befand, was dahinter war, was als nächstes passieren würde. Von weitem war der Rhythmus der Trommeln zu hören, Grillen zirpten im Konzert, der Wind strich durch die Palmen und irgendwo hinter mir war das Rauschen der Brandung.
Die Nacht blieb dunkel an jenem ersten Abend und auch die Nächte darauf. Das einsame Fischerdorf mit dem wunderbaren Namen Abené am südwestlichsten Zipfel des Senegal war noch ohne jegliche Stromanbindung. Lagerfeuer erhellten hie und da die Finsternis des afrikanischen Buschs, doch schon einige Meter weiter waren unendlich viele Sterne die einzige sichtbare Lichtquelle weit und breit.
| |
|
Ankommen in Afrika
Die ersten Sonnenstrahlen lockten mich aus meinem Schlafsack und ich wühlte mich unter dem Moskitonetz hervor. Kunterbunte Vögel sangen ihr Morgenlied und hießen mich willkommen als ich aus der kleinen Hütte heraustrat. Stundenlang saß ich einfach nur da und sah die Sonne aufgehen. Mein Körper wartete, bis meine Seele ankam.
|  |
 |
Das kleine Fischerdorf zählte vielleicht 2000 Einwohner und erstreckte sich kilometerweit entlang einer staubigen Hauptstrasse. Es gab mehrere kleine Buden, die alles verkauften, vom Bier bis zur Seife. Dazwischen gab es eine Schule und einen Kindergarten, eine Apotheke und ein kleines Krankenhaus. Die großen Grundstücke waren mit Bambuszäunen voneinander abgegrenzt, daran entlang schlängelten sich kleine Trampelpfade durch den rötlichen Sand. Hühner, Ziegen, Rinder und allerlei Getier wuselten wie wild über die Wege, nicht nachvollziehbar, wem was gehörte.
| |
|
Die Senegalesen aus der Band stammten überwiegend aus dieser Region im südlichen Senegal, Casamace. Sie hatten ihre Familien und ihre Grundstücke dort. Wir Deutschen wurden aufgeteilt und in den verschiedenen Häuschen untergebracht. Wir lernten Brüder, Onkel, Tanten und Cousins kennen…. So viele Namen, dass ich sie nicht auseinander halten konnte.
Der riesige Pavillon mit Bambusdach auf Papes Grundstück sollte in den nächsten Wochen unser gemeinsamer Aufenthaltsraum werden. Dort wurde gemeinsam gekocht und gegessen, erzählt, getrommelt und getanzt.
|  |
 |
Zum Frühstück gab es Weißbrot mit Orangenmarmelade und die Cousinen und Schwestern von Pape schälten unentwegt Zwiebeln und Kartoffeln, um unserer Mannschaft von knapp 20 Leuten am Abend ein leckeres Essen servieren zu können. Es gab drei Wochen lang ausnahmslos Fisch mit Reis und Pommes, dazu in Senfsoße geschmorte Zwiebeln. Man gewöhnt sich an alles, wenn man bereit ist, unser europäisches Junk- und Fastfood für einen Moment zu vergessen und sich darauf einzulassen.
OK, das Plumpsklo hinter der Hütte war eine Herausforderung, und Wasser aus einem Brunnen zu ziehen stellte sich nicht als einfach heraus. Hier zeigte sich schnell, wer sich mit dem Staub und Dreck arrangieren konnte, den man selbst nach einer provisorischen Dusche nicht loswurde.
| |
|
Viel Palaver in Abené
Schon nach einigen Tagen hatte ich das Gefühl, weit, weit weg zu sein, von dem, was mich sonst täglich antreibt. Ich ließ mich nun gleiten, ohne zu wissen wohin. Ich hatte Mühe, den Wochentag auszurechnen, und die Mittagshitze von mehr als 30 Grad raubte mir jegliche Weihnachtsstimmung.
|  |
 |
Am Nachmittag schlenderten wir die Hauptstrasse entlang. Von allen Seiten kamen die Menschen auf uns zugelaufen, überwiegend junge Männer in unserem Alter, die üblichen Verdächtigen. „Ca va? Oui, ca va…“. Palaver von allen Seiten. Immer und immer wieder die gleichen Fragen: wie wir heißen, woher wir kommen, wer wir sind. Unverblümte Neugierde an jeder Straßenecke. Bald hatten wir eine Eskorte hinter und neben uns. Ich verlor den Überblick und gab auf, meinen Freunden all die Fragen zu übersetzen. Wir machten Halt und Grischa, Anja und Tina gingen in einen kleinen Shop hinein, um Zigaretten zu kaufen. Die Jungs warteten.
| |
|
Ich setzte mich auf die Stufen und ließ den feinen Sand durch meine Hände rieseln. Wo die Kinder alle herkamen, die mich plötzlich umringten, ist mir ein Rätsel geblieben. Kleine klebrige Hände fassten mir ins Gesicht, sie waren von Schleim verschmiert. Riesige Augen schauten mich seltsam fassungslos und fasziniert an. Ich fühlte mich plötzlich seltsam fremd hier in diesem Dorf.
An jedem Finger ein kleines klebriges Kind und umringt von wild gestikulierenden jungen Männern, zogen wir durch die Strassen und erregten so noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin schon.
|  |
 |
Viel Palaver in Abené
Zeit- und ziellos lebten wir in den Tag hinein. Überall war stets ein buntes Treiben, Trommeln und Lachen zu hören. Nach dem Frühstück wanderten wir kilometerweit den einsamen Sandstrand entlang. Keine Menschenseele, nur die Kinder und Jungs, die uns ständig begleiteten. Ab und zu waren einige Fischerboote zu sehen, die den Fang an Land brachten, dann ein paar Rinder, die sich an den Strand verlaufen hatten. Vielleicht suchten auch sie nach einer frischen Briese in der Mittagshitze.
Von Touristen keine Spur.
| |
|
Am Nachmittag kehrte Ruhe ein im Camp. Nur das gleichmäßige und rhythmische Trommeln der Band im Hintergrund. Solche Momente verbrachte ich unter Palmen in der Hängematte. Im Gleichtakt der Musik schaukelte ich mich in den Dämmerschlummer.
Eigentlich sind wir alle davon überzeugt, einen sehr alternativen Urlaub zu verleben, weit weg vom kommerziellen Tourismus in All-Inclusive-Hotels. Doch irgendwie fühlt es sich ähnlich an und scheinbar sind wir Rucksack-Touristen, die es abenteuerlich finden, ohne Strom und fließend Wasser zu leben - die Vorboten von jenen, die hier irgendwann mit Tennisschlägern und Sonnenschirmen ankommen werden.
|  |
 |
Kein Kontinent klingt köstlicher.
So viele verschiedene Sprachen, Rhythmen und Melodien - begleitet vom Zirpen der Grillen und dem dumpfen Meeresrauschen; dazwischen überall herzliches Lachen. Das Licht hat ebenfalls seine ganz eigene Faszination. Es scheint förmlich von allen Seiten abzustrahlen und nicht nur einfach von oben zu kommen. Als stecke die Sonne in jedem einzelnen Sandkorn. Der Sand reflektiert sämtliche Spektren, sogar wenn nur der Mond scheint. Als würde der Sand tagsüber den Schatten absorbieren und nachts die Sandkörner noch lange nachleuchten.
| |
|
Europa aus einem anderen Blickwinkel
| |
|
Der einzig funktionierende Stromgenerator war das Herzstück des Dorfes. Er übertönte die Trommeln und knatterte in einem stumpfen Takt in die Dunkelheit hinein. Egal ob man tagsüber eine kalte Cola suchte oder abends unterwegs war zur nächsten Party, man musste nur dem Geräusch des Generators nachgehen. Meistens gegen Abend stand dieser ölige und lärmende Knattermotor direkt neben unseren Hängematten auf dem Grundstück mit dem Pavillon, um dort den Verstärker der Band anzutreiben. Kilometerweit schlurften wir dann durch das staubige Dorf, um dem Geräuschpegel zu entfliehen. Irgendwo vor der nächsten kleinen Bude waren die Jugendlichen so laut, dass wir uns dazugesellten. Es gab große Flaschen senegalesischen Biers, gute Laune und viele Fragen und Geschichten.
| |
 |
Wir lenkten die Fragen auf Europa. Sobald man weit weg ist, reflektiert man seine kulturellen Eigenarten aus einem ganz anderen Blickwinkel. An diesem Abend lernte ich Europa wieder aus zwei ganz andere Brillen kennen.
Sal war ein ruhiger Typ und ein Rastamann - so, wie ich ihn mir im Senegal vorgestellt hatte. Er dachte nach bevor er sprach, machte sich viele Gedanken und schaute ganz genau hin. Er war Maler und Künstler zugleich, er hatte das ganze Dorf bunt angemalt und war dennoch ständig am Trommeln. Die sechs Monate Aufenthalt in Frankreich und Deutschland hatten ihn geprägt. Er wusste, dass er in dieses einsame westafrikanische Fischerdorf gehörte. Viele fragten ihn unentwegt, warum er zurückgekommen sei. Unverständnis.
„Was hätte ich ihnen sagen sollen?“ fragte er auf Französisch. „Dass die Menschen in Europa nicht zugänglich sind, sie stumm und nichts sagend in der Metro sitzen und keiner nach links oder rechts blickt?“
| |
|
Unvorstellbare Welten lagen zwischen den unseren. Wir redeten lange. Ich verstand. Für ihn, der jeden Einzelnen in diesem Dorf hier sehr genau kannte und jeden Tag sah, war ein Dasein in Paris zwischen so vielen Millionen Einzelgängern kein Leben wert. Er war einsam gewesen in Europa, kannte keinen und besaß vieles, das er nicht haben wollte: „Der Fernseher konnte mir meine Familie und Freunde nicht ersetzen“.
Omar dagegen zappelte unentwegt auf seinem Stuhl herum, war ständig unterwegs und überall anzutreffen. Er redete und redete pausenlos. Beim Stichwort „Deutschland“ plapperte er auch schon vor sich hin, dass er unbedingt mal nach Deutschland wolle und auf ein Ticket spare. Dann erzählte er mir die sonderlichste aller Geschichten über die nationalsozialistische Vergangenheit: „Stammst du aus dem Süden von Deutschland?“ fragte er und nachdem ich genickt hatte, traf mich seine nächste Frage wie ein Schlag ins Gesicht: „Stammst du etwa vom Volksstamm der Nazis, die leben doch im Süden, oder?“. Aller Schlagfertigkeit zum Trotz, in diesem Moment fiel mein Reaktionsvermögen aus. Omar redete aber schon wieder weiter und ich musste ihn bitten, alles noch einmal zu wiederholen. Seiner Version der Geschichte nach hätte der Volksstamm der Nazis vor vielen Jahren das ganze Land erobert und danach auch die benachbarten Völker angegriffen.
Aus seinem Blickwinkel heraus betrachtet war dies eindeutig logisch. In der nach regionalen Stammeszugehörigkeiten strukturierten Gesellschaft entscheidet nicht der Einzelne, welcher politischen Richtung er sich angehörig fühlt. Auch der Senegal - und besonders jene Region im Süden - hatte jahrzehntelang Krieg erlebt. Bis vor ein bis zwei Jahren haben die Rebellen im Busch um die Unabhängigkeit gekämpft. Wir sprachen lange und immer wieder darüber. Ich versuchte ihm die deutsche Geschichte in einem anderen Kontext darzustellen, aber wir hatten verschiedene Brillen auf.
| |
|
Kein Thema wurde vor unserem kleinen Häuschen so oft diskutiert wie das Wasser.
Jetzt erst lerne ich es zu schätzen und betrachte es als Luxus, unendlich viel davon täglich fließend zur Verfügung zu haben.
Man kann vergessen, wie es sich anfühlt, morgens mit einer warmen Dusche wach zu werden, sich im Waschbecken die Zähne zu putzen oder ganz einfach die Toilettenspülung zu drücken, sich danach umzudrehen und das Licht im Badezimmer auszuschalten.
Ich werde jedoch nie vergessen, wie ich dort neben dem zehn Meter tiefen Brunnen stand und versuchte, einen halbwegs vollen Eimer hinauf zu ziehen. Planlos ließ ich den Plastikeimer mehrfach hineinfallen und er schwamm immer wieder leicht gekippt auf der Seite. Viel Wasser holte er jedenfalls nicht mit herauf. Anja stand daneben. Sie kannte den Trick mit dem Kopf-über-hineinfallen-lassen. Vergeblich.
| |
|
Dann kam eine Frau vorbei und lächelte uns an, als hätte sie uns von weitem bereits beobachtet. Sie trug ein kleines schläfriges Baby in einem bunten Tragetuch auf dem Rücken, dazu eine Schüssel Fisch und Wasserflaschen auf dem Kopf. Zwinkernd nahm sie uns den Eimer aus der Hand und ich hörte, wie er unten aufschlug. Mit ihren kräftigen Armen zog sie den vollen Eimer heraus, als wäre nicht ein Tropfen Wasser darin. Nur als sie ihn über den Brunnenrand hob, schwankte die Schale auf ihrem Kopf leicht hin und her.
Als sie sich verabschiedete, brach ich unter dem Gewicht des Eimers schier zusammen und auf dem Weg zu unserer provisorisch eingerichteten Duschwanne hinterließen wir nasse Spuren im Sand. Wir hatten bereits die Hälfte verschüttet und reduzierten daraufhin die ersehnte Erfrischung auf ein paar Spritzer Wasser, in dem die toten Fliegen schwammen.
|  |
 |
Batanguore, der heilige Baum
Ich hatte schon viele Geschichten gehört, bevor ich den Baum überhaupt erst sah. Er ist der geistige und historische Mittelpunkt des Dorfes.
Bei sengender Hitze pilgerten wie quer durch die Mangoplantagen. Kinder folgten uns. Alte Frauen saßen betend im Schatten.
| |
|
Man sagt, der Baum sei so hoch, dass man seine Krone nicht sehen könne. Es stimmte. Ich jedenfalls stand in einem Labyrinth dicker, fast versteinerter Wurzeln. Von diesem Baum ging eine eigenartige Faszination aus.
Er hatte die Geschichte überlebt und war nun selbst Geschichte geworden. Auch wenn der Senegal überwiegend vom muslimischen Glauben geprägt ist, so haben doch die traditionellen Mythen überlebt. So sagte man uns, dass wir den Frauen Geld dafür spenden müssten, damit sie für uns beten. Ich gab ihnen welches. Sie lächelten durch ihre Zahnlücken hindurch und versanken wieder im Gebet. |  |
|
Wir hatten uns schnell eingewöhnt auf diesem kleinen Fleckchen Erde. Wir kannten nun Nachbarn und Leute und sie kannten uns. Das Wasser aus dem Brunnen fühlte sich nicht mehr so kalt an und die Nächte wurden heller.
Am Kauderwelsch der Sprachen im Camp fand ich am meisten Vergnügen. Die Senegalesen sprachen die regionale Sprache Wolof, untereinander benutzten wir französisch oder englisch, natürlich deutsch und überall ein bunter Mix an Übersetzungen, je nachdem welche Leute gerade beieinander saßen. Es gelang mir, mich in das Wolof etwas hineinzuhören, da viele französische Wörter benutzt wurden. Eines Abends saß ich nicht mehr wie ein Outsider daneben, wenn Geschichten erzählt wurden. Auch wenn ich nichts Genaues verstand, die Sätze bekamen eine Melodie und irgendwie konnte ich mich hineinfühlen.
| |
 |
Jedoch mussten wir irgendwie ein eigenartiges Bild abgeben, wenn wir vier Freunde – Grischa, Tina, Anja und ich – vor unserer Hütte saßen.
Im Senegal ist es durchaus normal, dass ein Mann mehrere Frauen in seinem Haushalt unterhält. Eines Tages wurde Grischa sogar gefragt, ob es bei uns ebenfalls üblich sei, nach zwei Nächten das Bett zu wechseln. Müde von der Mittagshitze stimmte Grischa zu.
Am folgenden Tag hatten wir viel Besuch bei unserer Hütte, Frauen blinzelten neugierig über den Zaun. Sie beobachteten uns, wie wir drei junge Frauen Kaffee trinkend und rauchend im Schatten saßen und uns unterhielten. Grischa dagegen kniete am Brunnen über zwei Eimern schaumigem Wasser und einem Berg schmutziger Wäsche. Fassungsloses Staunen verbreitete sich in der umliegenden Nachbarschaft, noch bevor Grischa die Wäsche zum trocknen aufgehängt hatte. Mamona, die Tochter unseres Nachbarn, kam vorbei und setzte sich. Sie bot uns an, die Wäsche für uns zu waschen. Grischa winkte ab.
| |
|
Heiligabend mit Hochzeitstanz
| |
|
Weihnachten war seltsam fern in diesem überwiegend muslimischen Land. Gefeiert wurde aber dennoch überall, Trommeln wurden geschlagen und dazu Wallach getanzt. Wallach ist eine Musikrichtung, die der Zeit der afrikanischen Befreiungsbewegung entsprungen war. Auch die traditionellen Feten am 24. Dezember entstammten jener Zeit, als die muslimische Bevölkerung alternative Feiern zum christlich-kolonialen Weihnachten abhielten.
Wir waren an diesem Heiligen Abend auf einer katholischen Hochzeit eingeladen. Der Bräutigam war ein Deutscher, der die SEN-JAM Band engagiert hatte.
|  |
 |
Wie üblich um Stunden zu spät, also fast pünktlich nach afrikanischer Zeitrechnung, fuhren wir gegen Mittag in die nächst größere Stadt: Ziguinchor. In einem klapprigen, alten und total überladenen Minibus ächzten wir mit 20 Stundenkilometern über die löchrigen Sandpisten. 70 Kilometer und drei Reifenpannen später erreichten wir trotz kaputtem Anlasser die Hafenstadt. Berge aus Erdnüssen waren zum Abtransport am Hafen aufgeschüttet, es roch nach Fisch und Muscheln überall. Wir sahen nicht viel von Ziguinchor, denn die Hochzeit fand in einem Hinterhof statt.
| |
|
Nach einer Dusche kamen wir gerade rechtzeitig in sauberen Klamotten zum katholisch anmutenden Hochzeitstanz, als es kurz danach auch schon mit senegalesischem Wallach weiterging. Die Musik war viel zu laut. Es war ein bunter Mix aus Menschen, Musik und Zeremonien. Der Bräutigam sprang und tanzte zum Wallach wie wild umher und die Braut sah in ihrem weißen Hochzeitskleid wunderschön aus.
| |
|
Heiligabend mit Hochzeitstanz
Da es auf der Hochzeit so laut war, bekam ich die Geschichte drum herum erst später zu hören. Der Bräutigam aus Deutschland war wohl nur für eine Woche in den Senegal gereist, um zu heiraten, nachdem er die junge 21jährige während seines vergangenen Urlaubs kennen gelernt hatte. Für mich hörte es sich etwas seltsam an, als mir erzählt wurde, dass die Braut nur wenige Jahre älter sei als seine Tochter aus erster Ehe - und wohl auch nur wenige Jahre älter als die Schüler, die er unterrichtete. Nach einer Woche reiste er wieder nach Deutschland zurück und seine Frau blieb im Senegal, um weiter Deutsch zu lernen und sich die nötigen Papiere zu beschaffen.
|
 |
|
Nach einer Dusche kamen wir gerade rechtzeitig in sauberen Klamotten zum katholisch anmutenden Hochzeitstanz, als es kurz danach auch schon mit senegalesischem Wallach weiterging. Die Musik war viel zu laut. Es war ein bunter Mix aus Menschen, Musik und Zeremonien. Der Bräutigam sprang und tanzte zum Wallach wie wild umher und die Braut sah in ihrem weißen Hochzeitskleid wunderschön aus.
Ich dachte nicht länger darüber nach und war mir auch nicht sicher, was ich davon halten sollte, denn die ganze Nacht dröhnte von irgendwoher laut Musik an mein Ohr.
Wir wurden bei Familien unserer Band untergebracht. Mitten in der Nacht lernte ich Schwestern, Tanten und Cousinen von Dgiby kennen, ein Haus voller Frauen und Kinder. An Schlaf war nicht zu denken. Auf den Strassen feierten und trommelten die Menschen bis morgens nach Sonnenaufgang, als der Muezzin von seinem Minarett aus den Lärm übertönte und es zum Morgengebet still wurde auf den Strassen.
Erst als wir müde und erschöpft nach Abené zurückkehrten, holten mich die Gedanken an dieses doch recht eigenartige Hochzeitspaar wieder ein.
In unserem schönen geräumigen Pavillon unter dem Bambusdach saß ein Deutscher, vielleicht Mitte 40. Er rauchte viel Gras durch eine kleine Pfeife und ignorierte mit tiefbreitem Blick die kleine Lady, die neben ihm verschüchtert ihr Weißbrot in den Tee tunkte. Wie alt sie war, war unmöglich zu schätzen, denn sie wirkte mit Schminke und kurzem Trägershirt sehr aufgedonnert. Vielleicht 16 oder 17, jedenfalls nicht viel älter, denn sie war noch so schüchtern, dass sie nicht mit mir sprechen wollte und sich am liebsten unsichtbar gemacht hätte. Er dagegen grinste mich mit seinem bekifften Lachen breit an und laberte mir zwischen Pfeife und Kaffee unaufgefordert seine Lebensgeschichte ans Ohr. Mir verging die Lust auf Weißbrot mit Orangenmarmelade: Ein Architekt im Scheidungskrieg. Er hatte seine halbwegs erwachsenen Töchter schon lange nicht gesehen. Die kleine Senegalesin war Ersatz für vieles, was er in Deutschland verloren hatte. Er war in diesem Jahre nun bereits zum dritten Mal im Senegal, er wollte einfach nur aussteigen und trommeln.
Meine Gedanken waren weit weg. Über einen dieser doch recht seltsamen deutschen Kandidaten für junge hübsche Senegalesinnen hätte ich mir nicht den Kopf zerbrochen. Jetzt waren es aber schon zwei und irgendwie waren sie beide sehr eigenartig und sozial wenig verträglich. In den nächsten Tagen lernte ich dann auch noch einen dritten jener Sorte kennen: ein etwas kirchlich angehauchter Typ mit dickem Bierbauch und Halbglatze, aber in jedem Arm drei junge hübsche Frauen. Irgendwie wollte und konnte ich das alles nicht so ganz begreifen. Vielleicht wollte ich weniger als ich konnte. Doch es ist auch zu leicht, einfach nicht hinzusehen. Einige hundert Jahre zuvor waren es die kolonialen Gouverneure, die nach Westafrika geschickt oder strafversetzt wurden und sich dann einen Stall voll junger Frauen hielten. Heute sind es die geschiedenen Männer, die es sich selbst noch einmal beweisen müssen.
| |
 |
Ein weiteres Mal schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass es mein ganz persönlicher Alptraum war, eines Morgens als afrikanische Frau aufzuwachen. Mit einem Baby auf dem Rücken Wasser aus dem Brunnen zu holen, darin Wäsche zu scheuern und danach auf einer einzigen Feuerstelle Essen für die Großfamilie zuzubereiten, kiloweise Fisch und Holz jeden Tag auf meinem Kopf heranzutragen…… während der Mann mit seinen Brüdern und Cousins vor der Hütte sitzt, stundenlang den traditionellen Attaya-Tee aufbrüht und darüber diskutiert, ob es nicht besser für einen funktionierenden Haushalt sei, eine zweite oder dritte Frau zu unterhalten.
| |
|
Backery, der Gott der Bouckarabou-Trommeln. Eines Abends war er plötzlich da. Er saß am Lagerfeuer und machte seine vier Trommeln heiß. Danach spielte er die ganze Nacht hindurch, mit Händen, Füßen und Ellenbogen, bis keiner mehr zuhörte.
Sein Rhythmus begleitete mich in den Schlaf und als wir am nächsten Morgen zum Frühstücken kamen, hörten wir ihn schon von weitem. Soviel Energie für einen alten Mann über 60. Manche sagen, er sei noch viel älter und wieder andere sagen, er wüsste selbst nicht, wie alt er sei.
|  |
|
Backery hatte bereits Touren durch Europa und die USA gemacht und war wohl der berühmteste Senegalese, der je wieder zurückgekehrt war. Er hatte weltweit so manch schräge Geschichte hinterlassen und auch in Abené erzählten sich die Leute Geschichten über diesen recht stillen und in sich versunkenen Mann.
| |
|
Ohne Taschentücher im afrikanischen Busch hörte man Backery schon von weitem, da er laut schnaubend stets in den Sand rotzte. Weder Manager noch Übersetzer hatten ihm das abgewöhnen können, als er in Deutschland auf jener Musikertagung über den roten Teppich in dem noblen Hotel schlurfte und dabei schleimige Spuren hinterließ. Man sagte, es sei die Erkältung des Jahrhunderts gewesen, die sich Backery in diesem winterkalten Europa eingefangen hatte, und noch nie hatte er so viele piekfeine Hände geschüttelt.
|
 |
|
Zum Glück stand ich bereits neben dem Brunnen, als ich Backery persönlich kennen lernte. In der Nacht zuvor hatte ich stundenlang mit der Videokamera neben seinen Trommeln verbracht und ihn gefilmt. Doch seine Hände waren so schnell über die Felle gehuscht, dass die Kamera in der Dunkelheit nur Streifen anstatt Hände aufzeichnete. Ich dachte noch, er würde seine Umwelt nicht einmal wahrnehmen, da er wie in Trance ins Leere blickte und einfach weit weg zu sein schien.
| |
 |
Doch er hatte offensichtlich eine unverkennbare Schwäche für junge Mädchen. Denn als er mich am Brunnen mit seinen muskulösen Armen an seinen mit Ketten verzierten Hals drückte, gab er mir gleichzeitig einen deutlichen Klaps auf den Hintern. Seine Ketten und Armreifen machten dabei permanent Geräusche. Es war, als würde er stetig einen Rhythmus spielen. Durch seine riesige Hornbrille hindurch suchend, wühlte er in seiner Tasche und kramte stolz eine Kassette zutage. Sein Grinsen war eine einzige Zahnlücke. Er drückte mir diese in die Hand: „Du bist so eine schöne Frau“, meinte er auf Französisch. Ich solle doch auf seine Musik tanzen lernen und mit dem Hintern wackeln.
| |
|
Leicht verlegen stand ich da, wusch mir endlich die Hände und musste wieder an die peinliche Aktion der vergangenen Nacht denken. Viele Leute standen im Kreis und klatschten zu Backerys Schlägen. Ich stand neben dem Lagerfeuer, filmte und wippte leicht im Takt mit. Als ich nur kurz die Kamera aus der Hand legte, kam Backery plötzlich hinter seinen Trommeln hervorgesprungen und zog mich in den Kreis hinein. Ziemlich überfordert stand ich nun da zwischen all den wild klatschenden Leuten und Backery schlug schon wieder die Trommeln und forderte mich zum Tanzen auf. Es war mehr als peinlich, was ich als weiße Frau mit meinen Hüften alles nicht machen konnte. Schnell hielt ich mich wieder an der Videokamera fest und filmte, wie auch den anderen Deutschen diese Peinlichkeit nicht erspart blieb.
| |
|
Der Gott der Trommeln
Der Vollmond erhellte die Nächte und jedes Palmblatt warf deutliche Schatten in den feinen Sand. Es war herrlich, sich nachts so durch den dichten Busch zu kämpfen, alles ohne Taschenlampe erkennen zu können.
|
 |
|
Tage später jedoch ließ sich der abnehmende Mond Zeit, bis er kurz vor Mitternacht über den Palmwipfeln zum Vorschein kam. Plötzlich war es wieder eigenartig dunkel im Gebüsch. Ganz Abené war am Tanzen in jenen Nächten, als viele Künstler und Musiker in das kleine Dorf kamen, um ein Festival abzuhalten.
Tagsüber trafen sich viele zum Fußballspiel oder zu den traditionellen Ringkämpfen, die anderen schliefen in der Mittagshitze ihren Rausch der vergangenen Nacht aus.
Es war still am Strand, keine Menschenseele unterwegs.
| |
 |
Nachts dagegen hallten die Trommeln und Gesänge durch den Busch, kilometerweit. Überall wurde wild gefeiert. Es war ein Spektakel aus bunten Klängen und Rhythmen, die nur vom Knattern des Stromgenerators übertönt wurden.
Die Schule wurde nach Mitternacht zu einer Disco umfunktioniert. Auf dem Schulhof versammelten sich die Leute, standen rum, rauchten, aßen und pinkelten an den Zaun. Ewig und immer wieder spielte der DJ die eine und einzige Kassette ab.
| |
|
Mal die A-Seite zu erst, dann die B-Seite und umgekehrt. Ich kannte bald die Reihenfolge der Lieder und wusste schon Minuten vorher, dass das Band nach dem nächsten Song geklebt war und an dieser Stelle auch wieder reißen würde.
Mir wurde langweilig, nachdem mir der dritte Typ, den ich im Dunkeln nicht erkennen konnte, schmutzige Sachen ins Ohr zischte. Sie alle kannten meinen Namen und ich erkannte niemanden in der Finsternis. Ich machte mich allein auf den Weg nach Hause durch den dunklen Busch.
| |
|
Dann tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Ich erschrak fürchterlich.
Cheikh war groß, breitschultrig, muskulös und doch kaum zu sehen in der Dunkelheit. Er war der Schlagzeuger der SEN-JAM-Band und lebte in Dakar, der Hauptstadt des Senegal.
Ich wollte ihn eben darum bitten, mich bis zu unserer Hütte zu begleiten, als er fest meine Hand drückte und mir leise zuflüsterte, dass er Angst im Dunkeln habe. Ich solle nicht einfach ohne ihn losgehen. In die Dunkelheit hineinschmunzelnd begleitete ich ihn die wenigen Kilometer bis zu seiner Hütte. Ich konnte seine Gänsehaut spüren und er zuckte bei jedem Geräusch zusammen - dabei wirkte er auf den ersten Blick wie jemand, der lange beim Militär gewesen sein musste.
Aus irgendeinem Grund spürte ich, dass es nicht der richtige Moment war, danach zu fragen. Wir gingen schweigend nebeneinander her.
|  |
|
Erst Wochen später, nachdem wir viel Zeit miteinander verbracht und gelacht hatten, spazierten wir in Dakar durch das nächtliche Militärcamp, in dem wir untergebracht waren. Er erzählte mir seine Geschichte: Zwei Jahre Militärdienst, freiwillig. Das sei das einzige gewesen, was er in seinen 27 Lebensjahren je bereut hätte. Er war dort gewesen, im Busch, im Süden des Landes, dort wo wir heute in diesem friedlichen Fischerdorf feierten.
Er war Fährtensucher gewesen, war alleine in der Dunkelheit unterwegs. Nacht für Nacht hatte er nach den Rebellen Ausschau gehalten. Eines Nachts, der Mond war noch nicht aufgegangen, war er im Alleingang über die Rebellen gestolpert oder sie über ihn, so genau wusste er es nicht mehr. Erst Schüsse, dann Schreie und letzten Endes eine unerträgliche Stille. Diese Stille, meinte er, hörte er nach wie vor in seinem Kopf. Das sei der Grund, warum er unentwegt Musik mache, trommelte oder irgendein Lied vor sich her summte. Es war seine traumatisierte Seele, die zum Tanzen zwang, um einfach nur zu vergessen.
| |
 |
Nächstes Ziel: Gambia
Nach den eher ruhigen Weihnachtstagen packte uns das Reisefieber erneut und wir vier Freunde zogen los nach Gambia. Dieses kleine Konstrukt an Land mitten im Herzen des Senegals ist ein Relikt der kolonialen Ära. Gambia war britische Kolonie gewesen, während der Senegal von Frankreich aus verwaltet wurde. Die Unterschiede waren deutlich zu spüren.
| |
|
Die Menschen hinter der Grenze sahen zwar aus wie jene davor, sprachen aber neben Wolof auch Englisch als erste Fremdsprache. Bis vor wenigen Jahren war auf den Strassen von Gambia noch Linksverkehr verordnet gewesen. Das hatte man praktischerweise abgeschafft, da es an der Grenze zu viele Unfälle gegeben hatte, sobald die Fahrzeuge die Spur wechseln wollten. Seit einem Fußballspiel vor zwei Jahren, als Gambia gegen Senegal haushoch verloren hatte, war es zudem verboten, mit einem senegalesischen Auto durch Gambia zu fahren.
| |
|
Es war nicht so einfach für uns, einen Fahrer zu finden, der sowohl eine Fahrerlaubnis für Gambia als auch für den Senegal hatte und noch dazu zwei Autos mit unterschiedlichen Kennzeichen besaß.
Wir fragten uns durch und trafen auf Ansuman. Er war der Fahrer, der regelmäßig das Geld in unser kleines Dörfchen brachte, sozusagen eine mobile Bank. Er lebte in einer Stadt direkt an der Grenze und hatte sowohl zwei Autos als auch zwei Führerscheine.
|  |
 |
Er sprach englisch, so überließ ich es Grischa, Tina und Anja, mit ihm unseren Aufenthalt in Gambia durchzuplanen.
Mich interessierte es nur wenig, da ich davon ausging, dass alles nach afrikanischer Manier dann doch wieder ganz anders funktionieren müsste. Doch dieses Mal wurde ich eines Besseren belehrt. Ansuman brachte uns vier Weißgesichter - auf Wolof „Tubats“ genannt - ohne große Probleme über die Grenze. Er kannte die Polizisten sehr gut und nach einer Stunde des Wartens sowie vielen Stempeln und Registrierungen saßen wir in seinem gambianischen Auto und fuhren weiter nach Senegambia Beach. Die Sandpiste hatte viele Schlaglöcher, Affen huschten über die Straßen, Rinderherden blockierten die Fahrbahn, viel Staub und lautes Hupen.
| |
|
Gambia sah aus wie der Senegal. Die gleichen bunten Menschenmassen auf den Straßen, kleine voll gestellte Buden, an denen es alles zu kaufen gab, die gleichen schlechten Autopisten. Doch die Menschen sprachen plötzlich englisch, die Preise waren in einer anderen Währung ausgezeichnet und es lag etwas mehr Müll auf den Straßen. Zudem gab es andere Produkte in Gambia zu kaufen: Zigaretten aus England, Trinkwasser aus der Türkei, Bier aus Deutschland. Ansonsten konnte ich keine wirklichen Unterschiede erkennen.
Jedenfalls nicht bis wir nach Senegambia hinein fuhren. Plötzlich wurden die niedrigen Wellblechhütten zu zwei- bis dreistöckigen Häusern. Hotels, Restaurants, Bungalows am Strand. Briten, Holländer, Deutsche und Amerikaner quetschten sich mit ihren Liegestühlen und Sonnenschirmen an den kurzen Küstenabschnitt. Immerhin gab es dort einen Visa-Bankautomaten, einen von vier in ganz Gambia.
|  |
|
Erst viel weiter nördlich, in Bakau, fanden wir ein kleines, aber nettes Hotel nicht weit weg vom Strand, an dem es einsame Buchten gab. Wir quartierten uns dort ein.
| |
|

| |
|
Endlos liefen wir am Strand entlang. Dann wurde es stockdunkel in Bakau, wieder kein Strom, kein Mond, keine Taschenlampen. Die Stadt war ein einziges Knattern. Tausende von Stromgeneratoren rasten mal schneller, mal langsamer vor sich her, wie Nähmaschinen. Die Gambianer schienen diese Geräuschkulisse nicht mehr wahrzunehmen. Wir dagegen hatten eine schlaflose Nacht, denn auch zwischen unseren Zimmern in dem Hotel liefen bis in die Frühe die Generatoren. Wie abgesprochen verstummten am Morgen mit dem ersten Sonnenstrahl die Motoren und der Muezzin schickte seinen Gebetsaufruf über die Dächer von Bakau.
Am nächsten Tag: Operation Serenkunda. Die größte Stadt in Gambia ist das eigentliche Zentrum des Landes, nicht die Hauptstadt Banjul. Dort leben die Menschen, die in Banjul arbeiten. Wir wollten den Markt sehen, die Stadt, die Menschen. Nicht die Regierungsviertel und Verwaltungsgebäude.
| |
|
Das Minibusunternehmen bestand aus mehreren Fahrern und einem Jungen, der das Geld einsammelt, immer wieder die Schiebetür auf- und zuknallt und laut aus dem Fenster schreit, wohin die nächste Fahrt gehen sollte. Wir stiegen ein: Minibus nach Serenkunda, eine Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern. Doch zuerst fuhren wir eine halbe Stunde durch die engen Gassen von Bakau. Leute stiegen ein, dann wieder aus. Laut hupend und schreiend war das klapprige Auto unterwegs.
|  |
|
Übervoll und schon selbst nach Luft ringend bog der Fahrer dann auf die Strasse nach Serenkunda ein. Einige Kilometer später: Endstation – Markt von Serenkunda, weit außerhalb der eigentlichen Stadt.
| |
 |
Wir fanden uns in einem Gewühl von Menschen wieder. Bunte Kleider, bunte Gerüche, unendlich viele Mücken. Allerhand Waren in allerlei Gefäßen. Viel Fisch, zum Teil auf dem sandigen Boden ausgebreitet. Überall lautes Rufen, langes Verhandeln und schnelles Kaufen. Wir jonglierten uns durch die engen staubigen Gassen.
Nach zwei Stunden in der Mittagshitze waren die Menschen nur noch eine bunte wabernde Masse, durch die ich mich hindurchkämpfte. All meine Sinne waren durchweg überreizt, selbst die Mücken störten nicht mehr.
Nur die grobe Himmelsrichtung im Kopf, wurden wir auf dem Rückweg in die Markthalle hineingedrängt.
| |
|
Ein undurchschaubares Chaos von voll gestopften Buden, die knapp ein Meter breite Gässchen bildeten. Ich kann mich an viel Fisch, haufenweise Schuhe und Taschen sowie unzählige Mücken erinnern. Wir orientierten uns an den Gebetsteppichen, die überall ausgebreitet waren. Die Männer und Frauen beteten nach Osten, wir mussten nach Norden. Verrücktes Labyrinth.
| |
|
Sylvester – Trommeln im Busch
Als wir nach einigen Tagen Gambia wieder verlassen hatten, war da dieses Gefühl, nach Hause zu fahren. Es überkam mich auf der holprigen Strasse kurz hinter der Grenze, als der Sand wieder rötlicher wurde. Europa, Deutschland, Berlin war lange her und weit, weit weg. Abené lag direkt am Ende der Strasse.
Backery gab wieder eine seiner viel bestaunten Unterrichtsstunden, als wir in Abené eintrafen. Wir mussten nur den Trommeln folgen und waren froh, wieder da zu sein. Über Generationen, Kulturen und Sprachen hinweg waren wir eine Familie geworden.
| |
|
Sylvester verging, ohne dass wir viel Notiz davon nahmen. Zwei Minuten lang lagen wir uns alle in den Armen, dann gab es Unmengen zu essen.
Die Trommeln hallten laut durchs Dorf, sie waren der Ersatz für die Sylvesterknaller. Den Generator und die Musik fanden wir auf einem Grundstück direkt am Strand. Dort wurde gefeiert und getanzt bis zum Morgen.
| |
 |
Früh, viel zu früh ging es am nächsten Tag pünktlicher als irgendwie vorgesehen im Minibus nach Dakar. Wir wetteten um die nächste Reifenpanne: vor oder hinter der Grenze zu Gambia? Im ersten, dritten oder siebten Auto auf diesen hunderten von Kilometern nach Norden?
An der Grenze nach Gambia mussten wir lange warten. Mittagspause.
Nach dem dritten Nachmittagstee-Aufguss bekamen wir unsere Stempel. Der Franzose, der mit im Bus nach Dakar fuhr, musste sich ein Visum kaufen. Auch in diesem Moment holte uns die Geschichte wieder ein. | |
|
Das Gepäck wurde vom Auto geholt, aufgemacht. Der Zöllner hatte nur Augen für mich. Er sagte, sie sollten mich hier lassen, dann kämen sie ohne Probleme rüber. Die Senegalesen, mit denen ich unterwegs war, lachten. Ich hatte nichts verstanden.
| |
|
Einige Kilometer weiter wieder anhalten, aussteigen, „Ca va? Oui ca va!“, stempeln, Taschen vom Autodach runterladen. Die Gambianer schauten ganz genau hin. Videokamera, Handy, Instrumente, alles wurde beiseite gelegt. Das Saxophon schien in der Mittagssonne aus purem Gold zu bestehen. Es wurde laut verhandelt, dann stellte sich Ibrahim auf die staubige Strasse und spielte laut. Wir lachten. Die Polizisten hatten ihm nicht geglaubt, dass dieses goldene Ding wirklich ein Instrument war.
Billig war es nie, über die Grenze zu kommen. Die Korruption war die gleiche, vor oder hinter dem Schlagbaum. Doch die Gambianer waren einfacher zu Handhaben. Sie sagten, was sie haben wollten. Die Senegalesen wollten Versicherungen und Papiere sehen, erfanden irgendwelche Ausreden, sagten aber nie was, sie wirklich mit einem vorhatten.
|  |
 |
Wir suchten im Gewimmel auf dem Busbahnhof nach einem halbwegs stabilen Auto, das uns bis nach Banjul zur Fähre bringen konnte, denn es führt keine Brücke über den Gambia-Fluss.
Stundenlang saß ich einfach auf unserem Berg von Gepäck und beobachtete das Gewühl an Fahrern, Passagieren, ankommenden, abreisenden, wartenden und wild verhandelnden Leuten.
Die Senegalesen, mit denen ich fuhr, standen dazwischen, schrieen, diskutierten, lachten und gestikulierten. Ich verstand nichts, fühlte mich wie bestellt und nicht abgeholt auf ihrem Gepäck. Kinder fragten mich nach Bonbons. Mein Magen knurrte als Antwort.
hr, musste sich ein Visum kaufen. Auch in diesem Moment holte uns die Geschichte wieder ein.
Es wurde still und Bewegung kam ins Spiel. Sie hatten sich auf einen Preis geeinigt. Das Gepäck wurde auf das Dach geschnallt und los ging es, quer durch Gambia. | |
|
Am Hafen in Banjul war alles in Bewegung, ich konnte kaum still stehen bleiben. Die Fähre hatte gerade angelegt und wurde ausgeladen: schmutzige Lastwagen, stinkende Autos, Herden von Ziegen und Hühnern wollten mit Kindern, Frauen und Männern gleichzeitig von Bord.
Wir hatten Glück, die Fähre war heute jedenfalls nicht kaputt. Sonst liegt sie manchmal stunden- oder sogar tagelang im Hafen und wird wieder neu zusammengeschraubt.
Den Senegal hatte vor drei Jahren ein schlimmes Unglück heimgesucht. Die Fähre nach Dakar, die „Diola“, war mit knapp 3000 Menschen an Bord gesunken. Es war die einzige Fähre nach Dakar gewesen, seitdem muss man den Landweg über Gambia benutzen. Ich dachte an dieses furchtbare Unglück, von dem ich so viel erzählt bekommen hatte, als wir die Mündung des Gambia-Flusses überquerten. Ich konnte mir förmlich vorstellen, wie in diesem dicht gedrängten Laderaum voller Menschen, Tieren und Waren das Wasser zu steigen beginnt, Panik ausbricht.
|  |
 |
Dann endlich erreichten wir nach einer Stunde die andere Seite.
Wieder fand ich mich in einem Gewühl von Leuten wieder, die alle in eine Richtung strömten. Erst kurz hinter dem Hafen konnte ich mich zum ersten Mal umsehen. Am Busbahnhof wurde ich erneut von all dem Durcheinander überrannt. Ich war froh, nicht alleine zu sein. Wir hatten schon Mühe genug, uns zu orientieren.
| |
|
Als wir die Grenze in den Senegal hinein passierten, stand die Sonne schon tief. Die Salzwüste nach der Gambianischen Grenze, einige hundert Kilometer vor Dakar, glitzerte in den letzten Sonnenstrahlen. Die Militär-Straßensperre war gerade so sichtbar. Irgendwo auf dieser einsamen Straße, mitten in der Salzwüste, hielten wir ein letztes Mal, um unser Gepäck durchsehen zu lassen. Dann wurde es in wenigen Minuten dunkel. In tiefer Nacht erreichten wir die hell erleuchtete Hauptstadt. Ich war fix und alle nach mehr als 16 Stunden Fahrt.
|  |
|
Über den Dächern von Dakar
Dakar hatte auf den ersten Blick etwas Heiteres und Modernes. Die Stadt erschien lebenswert. Es war sauber, viele neue Gebäude und Rohbauten. Man konnte förmlich sehen, wie dort alles in Bewegung war. Mich an die Zeit in Kinshasa zurückerinnernd, empfand ich Dakar als sauber, bunt und irgendwie schön.
Die Millionenstadt liegt auf einer Halbinsel. Der starke Meereswind schien von allen Seiten durch die Strassen zu pfeifen. Im Schatten war es kühl. Meine Lippen schmeckten salzig. Wir fuhren mit den Taxi Kilometer weit an der Strandpromenade entlang. Dort trafen sich tagsüber die Leute zum Sport und abends die Liebespaare und Jugendlichen.
|
 |
|
Wir hatten auf einem Militärcamp etwas außerhalb übernachtet. Pape’s Familie lebte dort, Mutter, Halbschwestern, Nichten und Neffen. Der Mann seiner Schwester war bei der Marine, deswegen hatten sie ein nettes großes Häuschen auf dem Militärgelände. Sie waren alle wunderbar freundlich, selbst als wir dort mitten in der Nacht total ausgehungert eintrafen.
| |
 |
Am nächsten Tag fuhren wir mit einer Fähre zur so genannten Sklaveninsel. Eine Inselfestung vor Dakar: klein, malerisch, traurig und überfüllt von Touristen. Jene Festung ist wohl der gnadenloseste aller Beweise für die grausame koloniale Vergangenheit Afrikas und stellt die ganze westliche Welt an den Pranger. In jenem Sklavenhaus direkt über den Klippen wurden über Jahrhunderte hinweg die Sklaven aus ganz Westafrika zusammengepfercht, bevor sie nach Amerika verschifft wurden. Von dort aus war es der kürzeste Weg über den Atlantik und die härteste aller Prüfungen. Nur wer die dunklen stickigen Kerker überlebte, egal ob Kinder, Männer oder Frauen, wurde mit dicken Eisenkugeln an den Füßen in den Bauch eines Schiffs gepackt. Die anderen fanden hinter der so genannten „never-come-back-Tür“ den Tod in der Brandung.
| |
|
Der Ort war so voller entsetzlicher Geschichten. Ich kann es nicht beschreiben und die Fotos können sie nicht zeigen. Um zu verstehen, muss man den Ort selbst gesehen haben.
| |
|
In jenen langen Tagen und Nächten in Dakar lernte ich viele Familien kennen: Verwandte, Freunde, Bekannte von all unseren neuen senegalesischen Freunden. Ich weiß schon die Namen nicht mehr, aber es war wundervoll, hinter jene Fassaden zu sehen, die man sonst als Tourist zu Gesicht bekommt.
Die Familien waren riesig: Tanten, Onkel, Schwestern, Cousins, Nichten, Neffen, Oma und Opa. Sie alle lebten in einem Haus, saßen in einem Wohnzimmer. Die Frauen kochten in der Küche Berge von Reis und Fisch. Die Kinder saßen vor dem Fernseher, der stets zu laut war.
| 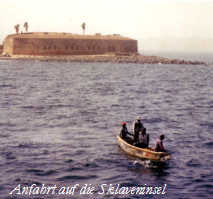 |
|
Die Männer diskutierten alles und nichts, während sie den ganzen Nachmittag Attaya-Tee aufgossen, aßen und wieder Tee tranken. Alle Türen waren stets offen, Nachbarn kamen vorbei, Freunde, Bekannte und noch mehr Verwandte. Es wurde gelacht und erzählt. Ich verlor den Überblick, hörte zu, genoss das bunte Treiben und all die lächelnden Gesichter, spielte mit den Kindern, hatte viel Spaß. Irgendwie fühlte ich mich wohl und sehr willkommen.
An all das Lachen werde ich mich wohl immer zurückerinnern und ich wusste, dass es mir in Deutschland fehlen würde. Es wurde unendlich viel gelacht, überall, selbst im voll gequetschten Minibus – kein müdes und verlegenes Aus-dem-Fenster-Schauen wie in der Berliner U-Bahn.
Gemeinsam saßen wir bei jeder Familie über einer großen Schale voll Reis und Fisch und aßen alle zusammen daraus. Die Senegalesen essen mit den Händen, selbst den Reis. Ich bekam einen Löffel in die Hand gedrückt, war aber schon satt. Es war nämlich nicht so, dass sie kein Besteck hatten, sondern weil selbst die Leute in der modernen Hauptstadt ihre Tischsitten als Tradition ansahen. Die Mutter oder Großmutter verteilte mit ihren Händen die besten Fisch- und Gemüsestücke an die Kinder. Die Söhne bekamen die größten Stücke, sie denn sie müssen für die Familie sorgen.
| |
 |
Erst als ich Cheikh so gemeinsam mit seiner Familie und so vielen Schwestern und Cousinen auf dem Boden sitzen sah und beobachtete, wie sie von allen Seiten den Fisch in seine Richtung schoben, konnte ich verstehen, wie er täglich solche Berge an Essen verschlingen konnte. Viele Wochen lang hatte ich über Cheikhs unendlichen Appetit gestaunt, an diesem Tag in Dakar war ich in seinem Leben angekommen und verstand.
Er war der einzige Sohn unter vielen Schwestern, er sorgte für sie alle, brachte das Geld mit nach Hause, das er sich als Elektriker irgendwo in einer Klinik verdiente.
| |
|
Er liebte sie und hatte sie täglich vermisst, als er in Abené gewesen war. Die Familie ist für die Senegalesen das höchste aller Dinge und wohl das Wesentliche, was uns Westeuropäer so sehr von vielen anderen Kulturen unterscheidet.
Cheikh hatte seinen Schwestern schon viel von mir erzählt, bevor ich bei ihnen ins Haus platzte. Kaum war er aus dem Raum, zwitscherten sie alle gleichzeitig los, lachten mich an und sprachen über mich. Die Mutter betrachtete meine Hände und urteilte dann, dass sie stark genug seien. Es war lustig und ich nahm es gelassen, dass sie uns am liebsten gleich verheiratet hätten. Sie stellten viele Fragen und vieles ließ ich unausgesprochen. Selbst mir erschien mein emanzipiertes Einsiedlerleben zwischen Studium und Karriere irgendwie seltsam weit weg. Es passte nicht zu diesem Moment an jenen Ort und besonders nicht zu jenen Frauen.
Nach dem dritten Teeaufguss zogen wir um die Häuser. Ich hatte Cheikh gebeten, mir einfach alles zu zeigen. Es interessierte mich wie es war, in Dakar aufzuwachsen und zu leben. Ich wollte die Stadt sehen und alle kennen lernen. Seine Freunde saßen an der nächsten Straßenecke im Schatten um ein Motorrad und schraubten daran herum.
In einem Atelier lernte ich einen Künstler kennen, der seine Bilder in New York und Paris ausgestellt hatte. Dann saßen wir im nächsten Hinterhof bei einem „Beifall“ und tranken Kaffee-Touba. Er schmeckte etwas herb und würzig, war stark wie Espresso und nach der dritten Tasse konnte ich nicht mehr still sitzen.
Die „Beifalls“ im Senegal sind Diener der „Marabous“, also der höchsten religiösen Führer. Sie sind alle Muslime, aber die „Beifalls“ haben es nicht mehr nötig, zu beten. Sie haben eine Freikarte für den Himmel, sobald sie ihren „Marabou“ zufrieden stellten. Wir redeten viel und ich versuchte zu verstehen. Für die senegalesischen Muslime sind das arabische Mekka und Medina nur eine Himmelsrichtung, um das Gebet auszurichten. Ihr religiöses Leben läuft jedoch entlang einer ganz anderen, eigenen Hierarchie. Alle „Marabous“ im heutigen Senegal stammen aus der alten Familie um den ersten Marabou, der vor vielen hundert Jahren lebten. Sie tragen seine religiösen Leeren fort, sind aber auch politisch und haben daher sehr viel Einfluss. Der „Marabou“ nämlich gibt vor, was und wen seine Anhänger gegebenenfalls zu wählen haben.
Über all diese Dinge gibt es noch viel mehr zu erzählen, denn die Religion ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens im Senegal. Ich hatte unzählige Marabou-Geschichten gehört und sie waren alle unterschiedlich, vielleicht belassen wir es einfach dabei…
Es war schon dunkel, wir zogen weiter, kauften Bier an der nächsten Bude. Dann kamen viele Stufen, kein Licht, nur die Sterne ganz oben. Treppen rauf und wieder hinab, ein einziges Häuser-Labyrinth. Und plötzlich standen wir auf den Flachdächern von Dakar, weit oben, direkt unter den Sternen. Das Meer glitzerte rundherum im Mondschein. Unbeschreiblich.
Wir wanderten über die Dächer, immer weiter, dann kamen noch mal Stufen und wir landeten auf einer Terrasse: Tische, Stühle, Wäscheleine, Trommeln, Wassereimer.
Hier lebte Cheikh, auf den Dächern von Dakar, in einem kleinen Zimmer von vielleicht drei auf drei Metern. Seine Freunde lebten auch dort oben, sie saßen auf der Terrasse zusammen und trommelten die ganze Nacht. Sie kannten sich alle vom Militär, waren gemeinsam im Krieg gewesen. Solche Freundschaften halten ewig, sagten sie. Wir tranken Bier, rauchten und redeten bis der Mond schon untergegangen war. Dann fing Cheikhs bester Freund Mohammed an, seine Wäsche zusammenzupacken, seine Fotos zu suchen. Er hatte sich freiwillig für den Krieg im Irak gemeldet, „die Al-Quaida zu bekämpfen“, wie er es selbst nannte. Es war seine letzte Nacht in Dakar. In den Morgenstunden ging sein Flug nach Saudi-Arabien, danach nach Falludscha. Die Stimmung war gedrückt. Manchmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, zu viele Fragen zu stellen, zu viel wissen zu wollen, aber ich konnte nicht anders.
Zum Militär zu gehen ist eine freiwillige Entscheidung im Senegal. Es gibt keine Wehrpflicht oder ähnliches. Die jungen Männer meldeten sich, weil sie keinen Job fanden oder die große weite Welt sehen wollten. So einfach ist das. Sie sind in vielen Kriegen gewesen und jeder von ihnen reihum hatte eine andere Geschichte zu erzählen.
Dann schauten sie mich an, die Reihe war an mir, von der Welt zu berichten. Ich erzählte nicht von Deutschland oder Europa, sondern vom Krieg im Ostkongo und in Zentralasien, wo ich ein Jahr zuvor gewesen war. Ich hätte auch vom all-inclusive-Urlaub an der türkischen Riviera oder vom Studentenaustausch in Russland erzählen können. Das hätten sie sich jedoch nie vorstellen können und wir hätten danach wohl nicht mehr auf Bruder- und Freundschaft getrunken.
Tief in der Nacht brachte mich Cheikh auf das Militärcamp zurück. Großer Abschied.
Wenige Stunden später saß ich auch schon wieder im Auto auf dem Weg nach Süden, Richtung Abené. Am nächsten Tag ging unser Flug zurück nach Deutschland. Ich hatte viele Erinnerungen gesammelt, sie alle schlängelten sich durch meine Gedanken, während ich stundenlang durch die Wüste gefahren wurde oder zwischen einer Herde stinkender und bockender Ziegen auf dem Fährdeck stand. Ich hatte mehr als 16 Stunden Zeit bis zur Ankunft in Abené, dies alles zu verarbeiten.
| |
|
Abschied von Abené
Irgendwann mitten in der Nacht, als ich schon wieder in Abené durch den dunklen Busch wanderte und mich von all den Leuten verabschiedete, stellte ich mir die Frage, in welches Leben ich eigentlich zurückkehren wollte.
Ich hatte so viele schöne neue Seiten der Welt kennen gelernt, so viele Menschen und Lebensgeschichten. Es fiel mir unendlich schwer, dies alles hinter mir zu lassen. Mir ist klar geworden, wie lebenswert Afrika eigentlich ist. Ich hatte bereits wieder Sehnsucht danach, noch bevor ich Abschied genommen hatte.
|
 |
|
Es war der letzte afrikanische Morgen, einige Stunden vor Abflug. Niemand hatte es eilig zum Flughafen zu kommen, wir fuhren erst los, als alle irgendwann im Auto saßen. Dann packte jemand seine lange vernachlässigte Armbanduhr aus und plötzlich waren wir wieder Deutsche. Oje, wir waren ja schon viel zu spät dran!
| |
 |
Es war schon Check-In-Time in Gambia am Flughafen, als wir noch unsere Taschen und Instrumente vom Autodach runterholten und den Grenzposten zum Kontrollieren hinstellten. Als wir endlich am Flughafen ankamen, war der Check-In-Schalter schon zu, die Passagiere schon an Bord. Während die anderen noch unser Gepäck abluden, rannte ich mit unseren Tickets und Pässen wedelnd durch den Flughafen und suchte nach irgendeiner Möglichkeit. Irgendwie klappte es mit viel Diskussion und Verhandlungen. Wir ließen die verärgerte Flughafenangestellte am Schalter zurück und stiegen in die wartende Maschine.
| |
|
Irgendwo, schon weit hinter der Sahara, als wir gerade Portugal überquerten, zog auch ich meine Armbanduhr wieder an und setzte die Batterie wieder ein. Sie fühlte sich schwer an, war kalt und irgendwie fremd. In Maastricht war Winter und es stürmte. Der Bus fuhr viel zu schnell, die Schlaglöcher fehlten. Beim Zähneputzen stand ich lange fasziniert vor dem Waschbecken und drehte immer wieder den Hahn auf und zu. Das Wasser war warm, fließend und trinkbar.
Es war nicht einfach, nach Hause zu kommen. Besonders deshalb nicht, weil ich nichts wirklich vermisst hatte. Am nächsten Tag fühlte ich mich elend und ging zum Arzt. Er gab mir Antibiotika gegen die afrikanischen Grippeerreger. Ich hatte eine Woche lang Fieber und lag im Bett, war ansteckend und durfte niemanden sehen. Dann erst fiel mir auf: Sal hatte so Recht. Der Fernseher kann einem Freunde und Familie wirklich nicht ersetzen. Und als ich so tagelang krank in meiner Wohnung lag, bekam ich Heimweh nach der großen weiten Welt.
| |
|

| |
Simone Schlindwein / Februar 2004
Die Autorin:
Simone Schlindwein, 24 Jahre
Studentin und Journalistin in Berlin
Studium der Geschichte und Internationalen Politik an der Humboldt Universität sowie der Osteuropastudien an der Freien Universität
Kontakt: Simone.Schlindwein@gmx.net
|  |
| |
|