 Wie die Hitze die Gehirne verbrennt
Wie die Hitze die Gehirne verbrennt
|
Der Theodor-Wolff-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen für Journalisten. Seine Juroren sind im Begriff, das Renommee zu verspielen.
Eine Kategorie, für die der Preis vergeben wird, ist das "Beste lokale Digitalprojekt". Seine diesjährige Entscheidung begründet der Veranstalter so:
"Erfolgreich in der Kategorie Bestes lokales Digitalprojekt sind Jan Georg Plavec und Simon Koenigsdorff mit ihrer 'Klimazentrale Stuttgart', Stuttgarter Zeitung/ Stuttgarter Nachrichten. Hier handele es sich um ein genuin digitales Angebot, das es so in Print nicht geben könne, heißt es dazu von der Jury. Die beiden Datenjournalisten hätten ein Projekt mit hohem Nutzwert für Stuttgart und Umgebung entwickelt, das jedem Interessierten Antwort auf die Frage gebe: ‚Ist das nur Wetter oder ist das schon Klima?"“
Das "Projekt mit hohem Nutzwert für Stuttgart und Umgebung" ist – sprechen wir es unverblümt aus – hochstaplerische Augenwischerei für von der Stuttgarter Zeitung/ Stuttgarter Nachrichten mittlerweile systematisch für blöd verkaufte Leser*innen, zu denen, wie man nun vermuten muss, auch jene gehören, die über die Zuteilung des Theodor-Wolff-Preises befinden.
Am 20. Juni 2023 stellte der Junior des Projekts Simon Koenigsdorff die "Klimazentrale" unter der Überschrift Der Klimawandel in Stuttgart – in einem Schaubild vor. Der Artikel präludiert vollmundig:
"Wie heiß war es vor 60 Jahren im Sommer? Wer damals schon bewusst gelebt hat, wird sich nur selten im Detail daran erinnern. Im Gedächtnis geblieben sind am ehesten Anekdoten: Hitzefrei in der Schule, sonnige Nachmittage am See. Heiß war es damals auch schon, zumindest nicht nennenswert kühler. Oder?
Die Geschichte, die die Daten unseres Projekts 'Klimazentrale Stuttgart' erzählen, ist eine andere. Es ist eine Geschichte von der messbaren Realität des Klimawandels, die nicht immer zur menschlichen Wahrnehmung passt – denn das, was als 'normales' Wetter gilt, hat sich im Laufe der Jahrzehnte verschoben, und zwar hin zu höheren Temperaturen, Tag für Tag.“
Die Klimazentralisten kommen zu der erstaunlichen Erkenntnis: "Heute sind die Sommer heißer, die Winter milder." Genau das aber entspricht der "menschlichen Wahrnehmung". Worin also besteht die Diskrepanz, die ein Projekt Klimazentrale, mehrere Artikel und einen Theodor-Wolff-Preis rechtfertigt? Für wie idiotisch halten die Autoren ihre Kundschaft, wenn sie annehmen, dass diese sich durch nichtssagende pseudowissenschaftliche Grafiken blenden lässt, die jeder Student der Statistik im ersten Semester wegen ihrer Unterkomplexheit gähnend überblättert?
"Auch vor Jahrzehnten schon sprach man von Hitze, meinte teils aber viel niedrigere Temperaturen als heute." Wer hätte das gedacht! Koenigsdorff zitiert eine Anika Heck mit der weltbewegenden Aussage: "Die Erkenntnis, dass wir uns in einem konstanten Anstieg der Temperatur befinden und nicht mehr nur einzelne Extreme erleben, überrascht immer noch viele Leute." Noch mehr dürfte es diese Leute überraschen, dass eine Erkenntnis, über die täglich gesprochen und geschrieben wird, überraschend sein soll.
Vielleicht kann die Psychologin Anika Heck erklären, was in Juroren vorgeht, die solch einem Quatsch einen Preis verleihen. Überraschend? Wohl nicht. Wir nehmen zu ihren Gunsten an, dass sie nie eine Zeile der Preisgekrönten gelesen haben. Dafür war es einfach zu heiß. Jedenfalls, messbar und wahrnehmbar, heißer als vor 60 Jahren. Diagramm wird in Bravo nachgeliefert.
|
Thomas Rothschild – 24. Juni 2023
2772
|
 Demokratie wagen
Demokratie wagen
|
Das Haus der Weimarer Republik hat über die Stadt, in der diese Republik gegründet wurde, Plakate und Transparente verteilt mit der Aufschrift: „Demokratie ist, wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst“. Ein bedenkenswerter Satz.
In Köln hat ein Gericht eine Ukrainerin zu einer Strafe von 900 Euro verurteilt, weil sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bei einer Demonstration „für andere wahrnehmbar gutgeheißen und befürwortet“ hat.
Mir gefällt die politische Einstellung dieser Frau nicht. Noch weniger aber gefällt mir, dass jemand dafür vor ein Gericht gestellt wird.
Ich verurteile ohne Wenn und Aber den Überfall Russlands auf die Ukraine. Nicht etwa, weil ich die Ukraine für den idealen Staat halte. Österreich war, als die deutschen Truppen 1938 einmarschierten, ein faschistischer Ständestaat, und auch die Sowjetunion konnte, als Hitler seinen Krieg gegen sie eröffnete, nicht als Musterdemokratie gelten. Nichts jedoch rechtfertigt einen militärischen Angriff auf ein anderes Land, und die unüberprüfbare Begründung, es handle sich um einen Präventionskrieg, öffnet der Aggression und der Willkür Tür und Tor. Das Recht auf Verteidigung – manche würden sagen: die Pflicht zur Verteidigung – muss auch jenen zugestanden werden, deren Regime und Politik abgelehnt werden. Hätten sich die Tschechen und Slowaken 1968 gegen die Panzer des Warschauer Pakts mit Waffen gewehrt, wäre sie zu Recht als Helden gefeiert worden. Trotz oder gerade wegen solcher tragischer Erfahrungen wie jener des Warschauer Aufstands im Jahr 1944. Man kann hoffen, dass das eigene Volk Missstände von Korruption bis zu totalitären Tendenzen bekämpft und beseitigt. Sie rechtfertigen aber, anders als die (militärische) Verteidigung, niemals einen Angriff von außen.
Dennoch gilt auch für eine Ukrainerin, die diese Meinung nicht teilt: „Demokratie ist, wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst“. Wenn das heutige Deutschland eine Demokratie ist, muss sie es aushalten, wenn eine Frau den russischen Angriffskrieg billigt. Dass ihr Bekenntnis eine ernsthafte Gefahr für unsere Gesellschaft bedeutet, wird wohl niemand glauben.
Sie muss es aus noch einem Grund aushalten. Mir ist kein Fall bekannt, dass irgendjemand in Deutschland dafür verurteilt wurde, dass er den Angriffskrieg der USA auf den Irak gebilligt hat. Im Gegenteil: die Vielen, darunter führende Politiker, konnten sich der medialen Zustimmung erfreuen. Einige von ihnen rechtfertigten nicht nur die Aggression der USA, sie erwogen sogar eine Beteiligung Deutschlands daran. Und blieben unbescholten.
Demokratie ist, wenn für eine russenfreundliche Ukrainerin die selben Regeln gelten wie, jedenfalls über längere Zeit hinweg, beispielsweise für Edmund Stoiber, Guido Westerwelle und – ja! – Angela Merkel. Wenn sich Politik und Justiz darüber hinwegsetzen, spielen sie jenen in die Hand, die behaupten, wir lebten in keiner Demokratie.
|
Thomas Rothschild - 6. Juni 2023
2771
|
 Politkitsch
Politkitsch
|
"Aber als ich an diesem Tag in Kiew in seine Augen blickte, war ich zutiefst berührt von der unerschütterlichen Standhaftigkeit, die er ausstrahlte." (Ursula von der Leyen bei der Verleihung des Internationalen Karlspreises an Wolodymyr Selenskyj am 14. Mai 2023 in Aachen)
"Dann hat er mi ang'schaut, der Führer … mit seine blauen Augen… i hab eahm angschaut … dann hat er g'sagt: 'Jaja'. Da hab i alles g'wußt. Wir haben uns verstanden." (Carl Merz und Helmut Qualtinger, Der Herr Karl)
Es gibt eine Polit-Rhetorik, die macht jede Aussage, so redlich sie gemeint sein mag, unglaubwürdig und vernichtet die beste Absicht. Da wäre es doch besser gewesen, man hätte Selenskyj den Preis in die Hand gedrückt und auf Reden verzichtet. Aber die Hoffnung bleibt wohl unerfüllt. Zu sehr sind Politiker*innen in ihre eigenen Reden verliebt. Mit und ohne Blick in die Augen.
|
Thomas Rothschild - 15. Mai 2023 (2)
2769
|
 Hitlers Sieg
Hitlers Sieg
|
Wenn ich es recht sehe, laden die meisten Grundschulen zum Schulbeginn, unabhängig von der konfessionellen Zusammensetzung der Schulanfänger*innen, zu einem christlichen Gottesdienst ein. Damit werden Kinder nicht-christlichen Glaubens oder ohne religiöses Bekenntnis – nach den jüngsten Statistiken die Mehrheit – stigmatisiert und ausgegrenzt, also ungleich behandelt, ehe sie noch den ersten Buchstaben gelernt haben. Dass der Gottesdienst nicht verpflichtend ist, ignoriert die Tatsache, dass soziale Normen, zumal bei Sechsjährigen, auch ohne Verpflichtung prägend sind. Ich kenne Mütter und Väter, die an das Jesuskind nicht mehr glauben als an Allah, Buddha oder Zeus, die aber unter dem gesellschaftlichen Druck mit den Schulanfängern den Gottesdienst besuchen. Wer will schon, dass seine Kinder bei den Lehrern als Außenseiter abgestempelt sind. Gibt es für diese Zustände eine juristisch plausible Begründung? Wenn nicht: hat irgendeine staatliche Institution etwas dagegen unternommen? Ich habe bis heute, Jahrzehnte nach meiner Schulzeit, den (katholischen) Religionslehrer nicht vergessen, der mich einst fragte, was mich davon abhalten solle, meine Eltern umzubringen, wenn ich nicht an die Hölle glaube.
Mit guten Gründen häufen sich die Artikel und die Podiumsdiskussionen über die Frage, ob man Frauen dazu zwingen dürfe, ein Kopftuch zu tragen. Die Antwort ist meist eindeutig. Man darf es nicht. Und wer es dennoch tut, ist hassenswert. Das sagt sich leicht, wenn die Verfechter des Kopftuchgebots im Iran oder in Afghanistan sitzen. Wo bleibt der Mut vor Kaiserthronen oder vielmehr vor Pfarreien, wenn sich die religiöse Gewalt gegen Kinder im eigenen Land richtet? Dafür bedarf es keiner Gesetze und keiner Strafandrohungen. Die Berufung auf die Tradition reicht aus. Diese Tradition hat freilich, was die katholische Kirche angeht, einen Namen. Er lautet Reichskonkordat, wurde 1933 zwischen Hitler und Papst Pius XI., zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan geschlossen und gilt, nur wenig modifiziert, weiterhin. Hindenburgstraßen werden, wenn auch zögerlich, umbenannt. Schulgottesdienste, also die Verhöhnung der Trennung von Kirche und Staat, wie das Reichskonkordat sie fordert, bleiben bestehen.
Wer ein Kopftuch trägt, muss auch im liberalen Deutschland mit Sanktionen rechnen. Wer dem Gottesdienst zum Schulbeginn fernbleibt, wird nicht bestraft. Er oder sie muss lediglich damit rechnen, behandelt zu werden, als trüge er oder sie eine unerlaubte Kopfbedeckung. Darüber werden keine Artikel geschrieben und keine Podiumsdiskussionen geführt. Hitler und der Vatikan haben gesiegt.
|
Thomas Rothschild - 6. Oktober 2022
2753
|
 Unbehütet
Unbehütet
|
Der Rasen auf dem Platz hinter dem Haus, in dem ich wohne, ist verdorrt. Ich will nicht behaupten, dass ich die Grünfläche normalerweise besonders beachte. Aber die Steppe, die sich da nun mitten in der Stadt braungelb erstreckt, konnte meinem Blick doch nicht entgehen. Schön ist sie nicht. Und ökologisch sinnvoll erst recht nicht.
Ein paar Straßen weiter, immer noch im Zentrum der mittelgroßen Stadt, befand sich seit jeher an einer Ecke ein gar nicht so kleiner Laden, in dessen Schaufenstern Hüte zu sehen waren und nichts sonst. Beim Vorbeigehen fragte ich mich stets, wie man vom Verkauf von Hüten leben kann. In der Regel sind es die Eigentümer, die bis ins hohe Alter und ohne Angestellte solche Geschäfte betreiben. Mir fällt ein Bäcker ein, dessen Kekse sich von Bahlsen unterschieden wie der Tag von der Nacht; ein Metzger, der noch wusste, wie man Rindfleisch tranchiert; und ein Knopfhändler, bei dem man Knöpfe jeder Form und jeder Farbe fand. Heute bin ich an dem Laden vorbeigegangen. Wo bislang die Kopfbedeckungen jeder Fasson lockten, waren die Fensterscheiben verklebt, und die Schilder von Handwerksbetrieben wiesen darauf hin, dass die Lokalität für einen neuen Mieter renoviert wurde.
Die Innenstädte versteppen wie der Platz hinter meinem Wohnhaus. Ja, was mich betrifft, kann ich gut ohne Hutgeschäfte leben. Ich trage keinen Hut. Aber es sind die vielen kleinen Läden, die noch vor gar nicht so langer Zeit die Städte heimelig machten, was ihnen Urbanität verlieh. Wer einmal durch die Außenbezirke von Paris oder Rom flaniert, weiß, was ich meine. Inzwischen sehen in Deutschland alle Stadtzentren und Fußgängerzonen gleich aus, weil die Politik den Begehrlichkeiten der Handelsketten bedingungslos nachgibt, statt mittelständische Kleinunternehmen wie ein Hutgeschäft in einer Weise zu fördern, dass sie ohne Selbstausbeutung überleben und Nachfolger für alte Geschäftsleute finden können. Sie passen nicht in eine Welt, in der nur nach dem materiellen Nutzen gefragt wird. Sie folgen der längst verschwundenen Kinos und Cafés in den Hades.
Man kann auch in der Steppe leben. Gemütlich ist es nicht.
|
Thomas Rothschild - 17. August 2022
2752
|
 Start-up
Start-up
|
Das Zauberwort heißt Start-up. Es bezeichnet eine Nebenlinie der Ideologie von der Überlegenheit des freien Unternehmertums und des ungefilterten Kapitalismus. Es verlängert die Legende vom Tellerwäscher, der es zum Millionär bringen kann, in die Gegenwart. Die Propagierung von Start-up-Unternehmen nimmt den Staat aus der Verantwortung. Nicht die Politik hat sich um den Abbau von Arbeitslosigkeit zu kümmern – jeder einzelne ist selbst dafür zuständig. Wenn er oder sie nur eine Idee habe und genug Fleiß und Initiative aufbringe, sei sein Glück garantiert und seine Zukunft gesichert.
Das Bild von der Start-up-Konjunktur ist in der Öffentlichkeit geprägt durch die Strategie der Politik und der ihr hörigen Medien, fast ausschließlich von den Erfolgen zu berichten, von einigen wenigen spektakulären Aufstiegsgeschichten. Die Pleiten und Tragödien sind, wenn überhaupt, allenfalls eine Fußnote im Lokalteil wert. Wer sich vorurteilsfrei ein wenig umsieht, begegnet an jeder Ecke jungen, wirtschaftlich unerfahrenen Menschen, die den Versprechen vertraut und sich Illusionen hingegeben haben. Viele von ihnen müssen oft schon nach Monaten resignieren, enttäuscht und nicht selten auf Jahre hinaus, manchmal sogar lebenslang verschuldet. Sie sind der Propaganda auf den Leim gegangen und müssen den Schaden allein ausbaden. Im Stich gelassen. Mit Hilfe können die armen Schlucker nicht rechnen. Sie sind ja keine milliardenschwere Bank und keine Luftfahrtgesellschaft. Warum haben sie sich auf Almosen unter dem Decknamen „Förderung“ verlassen? Wieso ist es ihnen nicht gelungen, Sponsoren zu finden. Selber schuld.
Der Traum vom schnellen Geld und vom Weg dorthin, der jeden offen stehe, ist nicht nur Betrug. Er ist Teil eines Systems, das die angeblichen Chancen des Individuums litaneiartig anpreist und dem der einzelne Mensch in Wahrheit egal ist. Darin besteht seine Unmenschlichkeit. Neu ist diese Erkenntnis nicht. Sie wird durch die aktuelle Start-up-Idealisierung lediglich in neuem Gewand bestätigt.
Ob die Menschen das begreifen, ehe sich die Tragödien vervielfachen? Es gibt wenig Hoffnung. Und derweil verkauft ein junger Mann neben überteuerten Schokoriegeln Briefmarken, weil die Post ihre Filialen schließt. Ob er damit genug verdient, um seine Miete zu bezahlen? Und wie lange? In der Statistik verbirgt sich sein Geschäft als Start-up. Ob ihn das satt macht?
|
Thomas Rothschild - 6. August 2022
2751
|
 Der Unterschied zwischen Müller und Müller
Der Unterschied zwischen Müller und Müller
|
Ich bin beeindruckt. Gerd Müller, der am Sonntag gestorben ist, hat in der Bundesliga 365 Treffer gelandet, so viele, wie das Jahr Tage hat. Für die DFB-Auswahl erzielte er in 62 Spielen 68 Tore. Wuschi!
Übertroffen wird er allerdings von Werner Müller, der am gleichen Tag das Zeitliche gesegnet hat, wie man den Tod so schön umschreibt. Er hat als Müllmann in seinen 51 Arbeitsjahren etwas mehr als 6 Millionen Mülltonnen geleert. Irgendwie wurde vergessen, das in den Schlagzeilen der Zeitungen und den Meldungen der Rundfunkanstalten zu erwähnen. Sein Rekord ist unkommentiert geblieben, jedenfalls jenseits der Stammkneipe, in der er und seine Kollegen sich zum abendlichen Bier trafen. Dabei könnte man ja zur Not ohne Gerd Müllers Tore leben. Ungeleerte Mülltonnen vor dem Haus hingegen würden einem sehr schnell stinken, im wörtlichen Sinne.
Unsere Welt ist ungerecht. Es gibt so viele Müllers, aber nur wenige werden beachtet. Weil sie Tore schießen, beispielsweise, statt Mülltonnen zu leeren, Kanäle zu reinigen oder Lebensmittel über den Scanner im Supermarkt zu ziehen – wie oft, wer zählt schon mit?
Fußball ist, je nach Quelle, die schönste oder die wichtigste Nebensache der Welt. Der Satz wird viel zitiert. Für eine Nebensache freilich, ob schön oder wichtig, wird ihm erstaunlich viel Aufmerksamkeit zuteil. Deutlich mehr als den Mülleimern von Werner Müller.
Es gibt außer dem Spruch von der Nebensache unzählige Aphorismen über den Fußball, zumindest ebenso viele, wie Gerd Müller Tore geschossen hat. Einer lautet: „Der Fußball ist einer der am weitesten verbreiteten religiösen Aberglauben unserer Zeit. Er ist heute das wirkliche Opium des Volkes.“ Er stammt von Umberto Eco. Und Dieter Hildebrandt, dieses Schandmaul, lästerte gar: „Der Fußballfanatismus ist eine europäische und sogar weltumspannende Geisteskrankheit.“ Da freilich verbietet sich jeder Vergleich. Einen Mülltonnenfanatismus gibt es nicht.
|
Thomas Rothschild - 17. August 2021
2735
|
 Was gar nicht geht
Was gar nicht geht
|
Es wird zwar in Deutschland noch nicht per Gesetz gefordert, aber immer mehr Stellenausschreibungen geben bei der Spezifizierung der gesuchten Bewerber m/w/d an. Wer „Diverse“ gegenüber Männern und Frauen, wie früher die Frauen gegenüber den Männern, diskriminiert, setzt sich der Gefahr eines Shitstorms oder noch empfindlicherer Sanktionen aus. Das kann man als Fortschritt im Kampf für mehr Gleichberechtigung ansehen. Aber. Aber?
Alexandra Dörrie, Geschäftsführerin der PR-Agentur Another Dimension, gibt auf Anfrage folgende Bewerbungstipps:
„Wir bevorzugen klassische Bewerbungen: ein richtiges Anschreiben, ein gut sortierter Lebenslauf und ein Passfoto, das sich sehen lassen kann. Natürlich hilft eine persönliche Empfehlung auch weiter.
Umgangssprache im Anschreiben oder Privatfotos in den Bewerbungen haben bei uns keine Chance. Wir hatten schon des Öfteren den Fall, dass Leute uns per E-Mail kontaktieren und dann kein richtiges Anschreiben oder ein Foto mitliefern. So etwas geht gar nicht.“
Was sagt ein Foto aus, das für die Besetzung einer Stelle von Belang wäre? Wenn es keine Relevanz besitzt – wofür wird es erwartet? Mit welcher Begründung will man rechtfertigen, dass der Verzicht auf einen Kontakt ohne Foto „gar nicht geht“? Wenn aus dem Foto keine für die Bewerbung maßgebliche Information abgeleitet wird, ist es überflüssig. Wenn es aber für die Entscheidung Bedeutung hat, kommt das einer Diskriminierung derer, m, w oder d, gleich, deren Aussehen nicht den Schönheitsvorstellungen des Personalchefs oder der Personalchefin entspricht. Was, wenn nicht dies, wäre Diskriminierung?
Artikel 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland besagt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Der Begriff „Rasse“ wird wohl demnächst aus dem Grundgesetz gestrichen. Ansonsten haben die Experten offenbar an der Formulierung nichts auszusetzen. Wahrscheinlich sind sie der Ansicht, dass es, da sich im Alltag kaum jemand um den Artikel schert und seine Verletzung eh nicht geahndet wird, nicht darauf ankommt. Oder will jemand allen Ernstes behaupten, dass in Deutschland niemand wegen seiner politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt wird?
Der Versuchung, den Artikel 3 beim Wort zu nehmen, beugt unter anderem schon der so genannte Tendenzschutz vor. Er erlaubt es den Medien, Journalisten, deren politische Anschauungen nicht mit der Blattlinie übereinstimmen, zu benachteiligen, genauer: sie zu entlassen oder gar nicht erst zu beschäftigen. Man muss schon sehr naiv sein, wenn man dieser Alltagswirklichkeit mit dem Scheinargument begegnet, die Betroffenen könnten ja nach einer Alternative suchen, und daran glaubt, dass die Möglichkeiten für die öffentliche Verbreitung von politischen Anschauungen gerecht verteilt sei. Wie bemerkte doch Paul Sethe? „Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“
Nun erfahren wir, dass nicht nur die Weltanschauung, sondern auch die im Foto dokumentierte Physiognomie darüber entscheidet, ob jemand eine Stelle bekommt oder nicht. Denn ohne Foto geht es gar nicht.
|
Thomas Rothschild - 8. August 2021
2733
|
 Kannitverstan
Kannitverstan
|
Hotelportale sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Da beklagt sich ein Tourist aus Freiburg über „Seminargäste (das Haus bezeichnet sich ausdrücklich auch als Tagungshotel), die auch im Muscle-Shirt, kurzen Cargo-Hosen und Birkenstocksandalen die Scene beim Abendessen zusätzlich bereichern.“ Ein Leipziger beschwert sich, dass sich das Personal in einem tschechischen Hotel nicht in englisch verständlich machen kann. Ein Gast ist verstimmt, weil er nicht gefragt wurde, ob das Essen geschmeckt hat, ein anderer empört sich darüber, dass ihm der Wein nicht nachgeschenkt wurde, einem dritten wurde der Aufenthalt vermiest, weil der Kellner zu wenig devot war.
Was mich betrifft, möchte ich nicht in einer Unterkunft bleiben, in der „bessere Leut'“ oder solche, die wenigstens im Urlaub als solche gelten wollen, logieren, die sich an Birkenstocksandalen, der Zumutung, dass sie ihr Weinglas selber füllen oder einem Kellner, der auch einmal schlechte Laune haben darf, stören. Das Nörgeln scheint zum Ausweis von Vornehmheit geworden zu sein. Die selben Leute, die immer, aber wirklich immer etwas auszusetzen haben und ihre Distinktion durch Sonderwünsche dokumentieren, mit denen sie das Personal quälen, sind außerstande, Gespräche in einer Lautstärke zu führen, die den Nebentisch von der Teilhabe befreit, oder die Liegen am Swimmingpool als Angebot nicht für sie allein zu betrachten. Der Urlaub dient als Freiraum, in dem man Verhaltensweisen an den Tag legt, für die man daheim mit sozialer Ächtung rechnen müsste. Und weil der Urlaub zu ende geht, verlängert man sein Selbstgefühl der Überlegenheit, das ausschließlich auf Selbstüberschätzung beruht, in den Bewertungen der Hotelportale. Gewiss: es gäbe einiges zu kritisieren an der Geschäftspraxis der Tourismusindustrie. Das fehlende Amuse Gueule ist es nicht. Johann Peter Hebels Kannitverstan gelangt durch Missverständnisse zu einer richtigen Erkenntnis. Die Mäkeleien in den Hotelportalen sind ebenso wenig Gründe für die richtige Erkenntnis, dass Hotels verbesserungsbedürftig sind, wie das dämliche Lachen eines Armin Laschet ein Beleg ist für die zutreffende Erkenntnis, dass dieser Mann ungeeignet ist für den Job des Bundeskanzlers.
|
Thomas Rothschild - 21. Juli 2021
2732
|
 Wohin ist der Klassenkampf verschwunden?
Wohin ist der Klassenkampf verschwunden?
|
Heute lese ich in den Stuttgarter Nachrichten: „Darum brauchen wir eine neue Nomenklatur, wenn wir unsere sexuelle Orientierung treffend beschreiben wollen. Das ist kein Selbstzweck, sondern kann dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden und einen besseren Umgang miteinander zu pflegen.“
Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Artikel erscheint, eine Talkshow stattfindet, in der über Sprachregelungen zur sexuellen Orientierung, über Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, die Plausibilität der Unterscheidung von Geschlecht und Gender reflektiert wird. Wann haben Sie zuletzt etwas über den verschleiernden Begriff „Arbeitnehmer“ gelesen? Wo findet sich ein Hashtag mit dem Outing von Menschen, die in die Arbeitslosigkeit gedrängt wurden, weil ihre „Arbeitgeber“ Misswirtschaft betrieben haben? Wo ist die Liste derer, die Werte produzieren, aber im Jahr dramatisch weniger verdienen als ihre vorgesetzten Manager im Monat? Wo stehen die Klagen von Sekretärinnen, die weitaus weniger Gehalt bekommen als Professoren und Professorinnen, die ohne sie aufgeschmissen wären, deren Abwesenheit beträchtlich drastischere Folgen hat als eine „Dienstreise“ ihrer Chef*innen und die nicht selten deutlich intelligenter sind als diese? Wo ist die Rede davon, dass die einen sich die bessere Krankenversorgung und die gediegenere Ausbildung leisten können als die anderen? Wer spricht noch von überhöhten Mieten, die ein Großteil der Bevölkerung nicht bezahlen kann? Wer zählt nach, wie viele Abgeordnete in den Parlamenten, von der CDU, von der FDP, von den Grünen und von einem maßgeblichen Teil der SPD, die Interessen der Unternehmer und wie viele die Interessen ihrer Angestellten verteten? Warum sind Begriffe wie „Ausbeuter“ und „Ausgebeutete“ aus dem Vokabular der veröffentlichten Meinung verschwunden, jedenfalls wenn es um Klassenzugehörigkeit geht?
Es ist nicht abwegig, wenn man zwischen der florierenden Geschlechterdebatte und der Eskamotierung des Klassenkampfes einen Zusammenhang sieht. Die Beliebtheit des Gender-Themas selbst bei jenen, die von ihm wenig zu gewinnen scheinen, verdankt sich genau dieser Tatsache: Es sollte die Wahrnehmung des Unterschieds von Arm und Reich, von Privilegiert und Benachteiligt, von Mächtig und Machtlos zum Verschwinden bringen, und es war und ist damit erfolgreich.
In der Sowjetunion gab es den Witz von dem amerikanischen Besucher, der sich über mangelnde Pünktlichkeit bei der Moskauer Metro beschwerte, worauf ihm sein sowjetischer Begleiter entgegnete: „Und bei euch werden die Neger verfolgt.“
Der Konflikt zwischen der herrschenden Klasse, die die Produktionsmittel kontrolliert, und der Arbeitsklasse, die durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft diese Produktionsmittel bedient, hat sich seit Marx nicht verändert. Die Expropriation der Expropriateure ist eine gerechte, aber bis heute unerfüllte Forderung geblieben. Sie wird im öffentlichen Diskurs nicht mehr erhoben. Warum? Weil es Wichtigeres gibt. Weil wir eine neue Nomenklatur brauchen, wenn wir unsere sexuelle Orientierung treffend beschreiben wollen.
|
Thomas Rothschild - 18. Juli 2021
2731
|
 Coach
Coach
|
Alle paar Jahre kommt ein Begriff in Umlauf und mit ihm ein Beruf. Seit ein paar Jahren gehören der Begriff des „Coaching“ dazu und mit ihm der Beruf des „Coaches“. Er hat den Platz des Psychotherapeuten eingenommen, mit dem nicht unwesentlichen Unterschied, dass die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. Jeder Scharlatan, jeder Hochstapler, jeder Betrüger kann sich Coach nennen. Trotzdem haben die Coaches in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens rasanten Zulauf. Vor einem Jahrhundert hat man sich über die Amerikaner mokiert, die wegen jedes Wehwehchens zum Psychiater oder zum Psychoanalytiker liefen wie einst brave Katholiken zur Beichte, die in Panik verfielen, wenn „ihr“ Analytiker mal indisponiert war. Heute erhoffen sich mitten in Europa immer mehr physisch und psychisch Überforderte von einem Coach jene Hilfe, die man in früheren Zeiten von der Oma oder einem guten Freund bekam, kostenlos. Die Coaches lachen sich ins Fäustchen. Ohne eine nennenswerte Ausbildung, für die Erteilung von meist lächerlichen Ratschlägen, die hinter jenen der lange Zeit aufgesuchten und verfolgten Kräuterhexen weit zurückbleiben, kassieren sie bis zu 1.000 Euro für die Stunde. Auch das im Grunde triviale englische Wort „Coach“ soll dem Pseudoberuf eine Aura verleihen, den das deutsche Wort „Begleiter“ nicht besitzt.
Man könnte darüber lachen. Ganz so unbedenklich freilich ist diese Entwicklung nicht. Da ist zunächst der ökonomische Faktor. Die Kosten für das Coaching werden weitergegeben, mit den Preisen für die Produkte und die Leistungen, die die gecoachten Frauen und Männer feilbieten. Wir alle bezahlen den Bluff. Schlimmer aber noch ist die Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung. Da Coaching und Coaches existieren, glauben viele, es müsse etwas dran sein an diesem Voodoo, wie sie einst (und zum Teil heute noch) an Teufelsaustreiber glaubten, an Wünschelrutengänger, an Schuldnerberater und an Kulturmanager.
Wir leben in einer Zeit der abnehmenden Vernunft, des zunehmenden Aberglaubens, von dem die Hochstapler auf Kosten der Leichtgläubigen profitieren. Man könnte das Coaching ja unter der Kategorie harmloser Eulenspiegeleien abbuchen. Aber so harmlos ist es nicht. So lange irgendwer das Coaching als willkommene Leistung akzeptiert und direkt oder indirekt dafür bezahlt – indem er selbst einen Coach in Anspruch nimmt oder jemandem Kredit gewährt, weil er einen Coach vorweisen kann –, gehört das Coaching in die gleiche Kategorie wie eine medizinische Behandlung ohne medizinische Ausbildung oder das Eheversprechen einer verheirateten Person. Im letzten Fall spricht man von einem Heiratsschwindler. Vielleicht wäre die angemessene Bezeichnung für einen Coach: Beratungsschwindler. Und seine Opfer? Es drängt sich der Verdacht auf, dass die zunehmende Inanspruchnahme des Coaching beweist, was es angeblich bekämpfen will: dass unsere Gesellschaft immer meschuggener wird.
Treffen sich zwei Psychoanalytiker. Klagt der eine auf die Frage, wie es ihm gehe: „Ach, unser Beruf ist so deprimierend. Ständig hört man traurige Geschichten. Der eine Klient hat Minderwertigkeitskomplexe, der andere kommt mit seiner Familie nicht zurecht, der dritte will sich umbringen.“ Darauf der andere: „Wer hört schon zu, wer hört schon zu…“
Und was sagt ein Coach zum anderen?
|
Thomas Rothschild - 28. April 2021
2724
|
 Sprachlich ausgeschlossen
Sprachlich ausgeschlossen
|
Die Stuttgarter Nachrichten titeln mit einer Behauptung, die eine Antwort auf eine nie gestellte Frage suggeriert: Warum wir das Stuttgarter Frühlingsfest vermissen.
„Eigentlich würde an diesem Samstag das Stuttgarter Frühlingsfest beginnen. Wegen der Coronapandemie fällt es zum zweiten Mal aus. Warum wir es vermissen.
Tausende Menschen aus aller Herren Länder tanzen eng nebeneinander auf Bierbänken, das viel zu teure Bier fließt in Strömen und auf der Bühne wird der neuste Partyschlager gespielt, von dem man auch noch nach drei Maß Bier den Text im Kopf hat – das alles sind Szenen, die wir uns heute nur noch schwer vorstellen können. Zum zweiten Mal in Folge musste das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen abgesagt werden und wir müssen zugeben: Es fehlt uns.
Wir vermissen den Geruch von frischen Crêpes und Zuckerwatte, die Fahrt mit dem Riesenrad und auch ein bisschen die leidige Diskussion über Trachten, die so gar nichts mit der Tradition des Wasens zu tun haben. In unserer Bildergalerie haben wir ein paar Dinge zusammengefasst, die uns in den kommenden Wochen fehlen werden.“
Spricht hier das majestätische Wir des Autors Johannes Volz? Wohl nicht. Er meint uns alle, sich selbst an erster Stelle und dann alle Leser. Ich komme ins Grübeln. Weder vermisse ich das Stuttgarter Frühlingsfest, noch muss ich irgendetwas, geschweige denn, dass mir das Frühlingsfest fehle, zugeben. Weder vermisse ich den neusten Partyschlager, von dem man auch noch nach drei Maß Bier den Text im Kopf hat, noch den Geruch von frischen Crêpes und Zuckerwatte.
Einmal mehr fühle ich mich sprachlich ausgeschlossen wie bei dem Titel Deutschland trauert, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft ein WM-Spiel verliert, und ich kann beschwören, dass ich jede Menge Menschen kenne, die sich weder mit einem Wir identifizieren, das das Stuttgarter Frühlingsfest vermisst, noch mit einem Deutschland, das trauert, wenn Italiener besser Fußball spielen als Deutsche. Sie werden von den Stuttgarter Nachrichten in Geiselhaft genommen. Es ereilt uns allen, denen das Stuttgarter Frühlingsfest mitsamt dem Geruch von Zuckerwatte nicht mehr bedeutet als ein zugesperrtes Gasthaus an der nächsten Ecke, das Schicksal, das Feministinnen den Opfern des generischen Maskulinums zuschreibt: dass es all jene „unsichtbar macht“, die nicht zu der prädestinierten Gruppe – den Männern, den Frühlingsfestimmunen – gehören. Nur: warum ist das so? Warum wird diese Tatsache nicht kommentiert und skandalisiert wie ein „man“, bei dem auch Frauen „mitgemeint“ sind?
Weil das „Wir“ der Stuttgarter Nachrichten kein Versehen ist, sondern ein Ausdruck eines zunehmenden Populismus. Die Zeitung und ihr Autor rechnen mit einer Mehrheit, die tatsächlich das Frühlingsfest vermisst, wie sie ein verlorenes Fußballspiel betrauert. Sie biedern sich an und beschwören eine geschlossene Volks-, Frühlingsfest-und-Zuckerwatte-Begeisterten- oder Fußballfangemeinschaft. Wer nicht dazu gehört, existiert nicht, weder grammatisch, noch in der Berichterstattung. Oder dürfen wir demnächst mit dem Titel rechnen: "Warum wir weder den Lärm, noch das Verkehrschaos am Cannstatter Wasen vermissen“?
|
Thomas Rothschild – 17. April 2021
2722
|
 Jenseits des Genderns
Jenseits des Genderns
|
Was Angela Merkel und Olaf Scholz zum Weltfrauentag zu sagen vergessen haben:
„Soll die Frau volle gesellschaftliche Gleichberechtigung mit dem Manne erhalten - in Wahrheit und in der Tat und nicht bloß mit toten Gesetzestexten auf geduldigem Papier -, soll sie wie der Manne freie Entwicklungs- und Auswirkungsmöglichkeit für ganzes Menschentum gewinnen, so müssen zwei Hauptbedingungen erfüllt werden: Das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist aufzuheben und durch das Gesellschaftseigentum zu ersetzen; die Tätigkeit der Frau ist der gesellschaftlichen Gütererzeugung in einer ausbeutungs- und knechtschaftslosen Ordnung einzugliedern. Nur die Verwirklichung dieser beiden Bedingungen schließt es aus, dass die Frau entweder als Weib und Mutter in der Familie in wirtschaftliche Abhängigkeit vom Manne gerät oder aber infolge des Klassengegensatzes zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten als Proletarierin und Berufstätige im Betrieb unter die wirtschaftliche Knechtschaft und Ausbeutung durch den Kapitalisten fällt, dass durch einseitige, übersteigerte Anforderungen, sei es der Hauswirtschaft und Mutterschaft, sei es der Berufstätigkeit, wertvollste Kräfte und Gaben verkümmern und eine harmonische Vereinigung beider Pflichtkreise unmöglich gemacht wird. Nur die Verwirklichung dieser beiden Bedingungen verbürgt es, dass die Frau mit allseitig entwickelten Fähigkeiten und Kräften als gleichverpflichtet und gleichberechtigt Arbeitende, Schaffende in einer Gemeinschaft gleichverpflichtet und gleichberechtigt Arbeitender und Schaffender wirkt und dass Berufstätigkeit und Mutterschaft sich zum Ringe vollen Auslebens zusammenschließen.
Die Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung erweisen sich als ohnmächtig, der Gesamtheit der Frauen volles Recht und volles Menschentum zu gewährleisten. Gewiss kommt ihrer Durchsetzung die nicht zu unterschätzende grundsätzliche Bedeutung zu, dass die bürgerliche Gesellschaft und ihr Staat das alte Vorurteil von der Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechtes offiziell auslöschen und mit der Gleichberechtigung des Weibes seine soziale Gleichwertigkeit anerkennen. Allein, in der Praxis läuft die Verwirklichung frauenrechtlerischer Forderungen in der Hauptsache darauf hinaus, die kapitalistische Ordnung zugunsten der Frauen und Töchter der besitzenden Klasse zu reformieren, während die ungeheure Mehrzahl der Proletarierinnen, die Frauen des schaffenden Volkes, nach wie vor als Unfreie und Ausgebeutete der Verkümmerung und der Missachtung ihres Menschentums, ihrer Rechte und Interessen preisgegeben sind.
Solange der Kapitalismus fortbesteht, bedeutet das Recht der Frau auf freie Verfügung über ihr Vermögen und ihre Person die letzte Stufe der Emanzipation des Besitzes und erweiterte Ausbeutungsmöglichkeiten der Proletarierinnen durch die Kapitalisten. Das Recht der Frau auf gleiche Bildung und Berufstätigkeit mit dem Manne läuft darauf hinaus, den Frauen der Besitzenden die so genannten höheren Berufsgebiete zu erschließen, damit den Grundsatz der kapitalistischen Konkurrenz auch hier zu unbeschränkten Geltung zu bringen und den wirtschaftlichen wie sozialen Gegensatz zwischen den Geschlechtern zu verschärfen. Sogar die wichtigste und weit tragendste der frauenrechtlerischen Forderungen - die der vollen politischen Gleichberechtigung der Geschlechter, insbesondere die der Zuerkennung des aktiven und passiven Wahlrechts - ist durchaus unzulänglich, den Frauen der Nichts- und Wenigbesitzenden in Wirklichkeit ganzes Recht und volle Freiheit sicherzustellen.
Denn bei dem Fortbestand des Kapitalismus ist das Wahlrecht nur zur Verwirklichung der lediglich formalen politischen, bürgerlichen Demokratie da, es besagt keineswegs tatsächliche wirtschaftliche, proletarische Demokratie. Das allgemeine, gleiche, geheime, direkte, aktive und passive Wahlrecht für alle Erwachsenen bedeutet nur die letzte Entwicklungsstufe der bürgerlichen Demokratie und wird zur Grundlage und zum Deckmantel für die vollkommenste politische Form der Klassenherrschaft der Besitzenden und Ausbeutenden. Diese Klassenherrschaft verschärft sich aber in der jetzigen Periode des Imperialismus, der revolutionären gesellschaftlichen Entwicklung - dem demokratischen Wahlrecht zum Trotz - zur gewaltigsten, brutalsten Klassendiktatur gegen die Besitzlosen und Ausgebeuteten. Dieses Wahlrecht hebt nicht das Privateigentum an den Produktionsmitteln auf und damit auch nicht den Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat, es beseitigt mithin auch nicht die Ursache der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Ausbeutung der ungeheuren Mehrzahl von Frauen und Männern durch die Minderheit der besitzenden Frauen und Männer. Es verhüllt nur diese Abhängigkeit und Ausbeutung durch den trügerischen Schleier der politischen Gleichberechtigung. Auch die volle politische Gleichberechtigung kann daher für die Proletarierinnen nicht etwa das Endziel ihrer Bewegung, ihres Kampfes sein. Für sie kommt der Besitz des Wahlrechtes und der Wählbarkeit nur als ein Mittel unter anderen Mitteln in Betracht, sich zu sammeln und zu schulen für Arbeit und Kampf zur Aufrichtung einer Gesellschaftsordnung, die erlöst ist von der Herrschaft des Privateigentums über die Menschen und die daher nach der Aufhebung des Klassengegensatzes zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten die Gesellschaftsordnung freier, gleichberechtigter und gleichverpflichteter Arbeitender sein kann.“
(Quelle: Auszug aus einem Artikel von Clara Zetkin in Die Kommunistische Internationale, 1920/21, Nr. 15, S. 530-555)
Clara Zetkin, Kommunistin und Initiatorin des Weltfrauentags, 1920.
|
Thomas Rothschild – 8. März 2021
2718
|
 Der Normalfall
Der Normalfall
|
Der Spiegel gibt sich empört:
„Weltweit warten Menschen auf ihre Impfungen. Wer zuerst drankommt, entscheidet sich in der Regel danach, wie alt oder krank man ist, welchem Infektionsrisiko man ausgesetzt ist, ob man im Medizinbereich arbeitet oder nicht. Wie viel Geld jemand auf den Tisch legen kann für eine Impfung, ist – bisher – kein Kriterium.
Doch schon länger wird vor einem sogenannten Impftourismus und erkauften Sonderregeln für Superreiche gewarnt. Der Gefahr also, dass sich Leute den Zugang zu Impfdosen erkaufen und so die Warteschlange überholen. Dass nicht die zuerst drankommen, für die eine Coronainfektion besonders gefährlich wäre, sondern die mit den dicksten Brieftaschen.“
Ist es Heuchelei oder gar der dreiste Versuch einer Ablenkung von der Realität? Was das Nachrichtenmagazin da meldet, ist in der Tat schamlos. Nur eins ist es nicht: eine Nachricht. Es ist die Normalität.
Auf kaum einem Gebiet, vielleicht das Bildungswesen ausgenommen, ist die Ungleichheit so eklatant, die Brieftasche so ausschlaggebend wie auf dem der medizinischen Versorgung. Eine Mehrheit der Menschen auf dieser Erde hat gar keine Chance, die Hilfe eines Arztes und erforderlicher Medikamente zu bekommen, die für Reiche in den reichen Ländern selbstverständlich sind. Selbst in den reichsten Ländern dieser Welt, etwa in den USA, können sich große Teile der Bevölkerung die allernötigste medizinische Versorgung nicht leisten, während die Wohlhabenden mit einer geradezu luxuriösen Behandlung rechnen (!) dürfen.
Und bei uns, in Deutschland? Wer nicht das nötige Kleingeld hat – und das sind nicht wenige –, muss mit einem bescheidenen Zahnersatz ebenso auskommen wie ohne Brille oder Kontaktlinsen. Wer Geld hat, wird vom Chefarzt behandelt und im Krankenhaus in Einzelzimmern untergebracht. Viele Leistungen, etwa für Kuren, sind stark eingeschränkt im Vergleich zu den Angeboten für die Patienten mit den dicken Brieftaschen. Die dürfen Jahr für Jahr in Luxussanatorien Urlaub machen. Ob sie wirklich krank sind oder nicht. Schon Gstanzln aus dem alten Wien resignierten: „Wer a Geld hat, der reist ins Bad in Summa, / Und wer kans hat, schwimmt im Waschtrog uma; / Mir is’s alles ans, mir is’s alles ans, ob i a Geld hab’ oder kans.“
Wie so oft tut Der Spiegel in einem wahrscheinlich statistisch nicht relevanten Fall, eben des Impftourismus, als wäre er ein Robin Hood der Benachteiligten. Nur um darüber hinweg zu täuschen, was man jeden Tag beobachten und im globalen Maßstab wissen kann: dass die Ungleichheit die Grundlage unserer Gesellschaft ist. Das ist kein Unfall. Es ist gewollt wie der Profit von Reiseveranstaltern, die einen inkludierten Impftermin außer der Reihe anbieten. Für jene, die bezahlen können.
Und Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Großbritannien hatte einst mit seinem National Health Service ein vorbildliches und erstaunlich soziales Gesundheitssystem. Margret Thatcher begann damit, es abzubauen, und andere Staaten haben es ihr nachgemacht. Unter dem Damoklesschwert eines angeblichen Sozialismus siegen Sozialdarwinismus und das Recht des (finanziell) Stärkeren. Nicht erst seit Corona.
|
Thomas Rothschild - 13. Februar 2021
2715
|
 Die Ewigheutigen
Die Ewigheutigen
|
Man nennt sie, je nach Standpunkt, Konvertiten, Renegaten oder Häretiker. Die einst, während der 68er-Revolte, oder, schlimmer noch, im Glauben an den Kommunismus zu jenen gehörte, die den Mund am weitesten aufrissen und zu den dogmatischsten Vertretern der reinen Lehre gehörten, werden nicht müde, Reue zu bekennen, ihrer biographischen Vergangenheit abzuschwören und sich jenen anzubiedern, die sie einst bekämpft haben, in der Hoffnung auf den Lohn, der manchmal eintrifft, manchmal auch ausbleibt. Jene aber, denen sie mangelnde Lernfähigkeit attestieren, weil sie, durchaus selbstkritisch, weiterhin der Ansicht sind, dass die bestehende nicht die beste aller denkbaren Welten ist, die den Kapitalismus nach wie vor für inhuman und die Sozialdemokratie eines Schröder, eines Blair, eines Mitterand und ihrer Nachfolger für keine taugliche Alternative halten, denunzieren sie als Ewiggestrige.
Das böse Wort macht die Runde. Mit diesem Begriff, mit dem man lange Zeit jene bezeichnete, die nach 1945 dem Nationalsozialismus nachtrauerten, werden nun gleich doppelt jene diffamiert, die sich nicht der verordneten Ansicht anschließen, dass der Sozialismus ein für alle Mal ausgespielt habe.
Sehen wir einmal davon ab, dass der Sozialismus noch nirgends wirklich ausprobiert worden ist. Da, was jeder Sozialist wissen konnte, die Sowjetunion und ihre Kolonialstaaten niemals sozialistisch waren, können sie jetzt nicht "postsozialistisch", sondern allenfalls präsozialistisch sein. Sehen wir einmal ab von dem Etikettenschwindel, der mit dem Wort Sozialismus betrieben wurde – von den Mächtigen in den angeblich sozialistischen Ländern ebenso wie von deren dezidiertesten Gegnern. Selbst wenn man der Meinung war, die DDR und andere Staaten des Warschauer Pakts seien sozialistisch gewesen, so kann doch die Zulässigkeit einer sozialistischen Utopie nicht abhängig sein von der Existenz eines sozialistischen Staates. Ist derjenige ewiggestrig, der sein Denken nicht der Macht des Faktischen unterordnet? Ist derjenige ewiggestrig, für den die DDR (etwa) über den Tag hinaus, an dem sie zu existieren aufhörte, als sozialistisch – oder eben als nicht sozialistisch – einzuschätzen war und ist? Darf für Sozialisten nicht gelten, was man Christen trotz Kreuzzügen und Inquisition, was man Sozialdemokraten trotz der Zustimmung der SPD zu den Kriegsanleihen im Jahr 1914, die maßgeblich für den Ersten Weltkrieg mitverantwortlich waren, trotz dem „freudigen Ja“ des späteren Bundespräsidenten Karl Renner zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, was man Grünen trotz halsbrecherischen Kompromissen mit umweltfeindlichen Projekten zum Erwerb und zur Erhaltung von politischer Macht zubilligt?
Zum Kotzen sind doch in Wahrheit die Ewigheutigen, die Konjunkturisten, die ihre Ansichten nach der Tagesmode ausrichten. Zum Kotzen sind die Ewigheutigen, für die der Sozialismus denkbar (sei es begrüßenswert, sei es bekämpfenswert) war, bloß weil es eine DDR gab, und die flugs in die Sprachregelung einstimmten, wonach die Freie Marktwirtschaft die konkurrenzlose Herrschaft nicht nur auf den Märkten, sondern auch in unseren Köpfen anzutreten habe.
Dabei schrecken die Ewigheutigen vor den merkwürdigsten Volten nicht zurück. Mit dem Eifer von Gesinnungspolizisten schnüffeln sie hinter der angeblich mangelnden Gesinnung von Schriftstellern und Künstlern her, die in der DDR ihre Überlebenskompromisse gemacht haben, um zugleich zu postulieren, Gesinnung habe in der Kunst nichts zu suchen. Sie sind so heutig, dass sie sich in ihrer gerade aktuellen Meinung selbst nicht zurechtfinden. Aber auf Meinungen kommt es auch gar nicht an. Denn das ist die höhere Weisheit des Lobs auf die Gesinnungslosigkeit: dass man ewig heutig ist, wenn man sich auf die Seite der Sieger stellt. Da, in trauter wärmender Nähe zur herrschenden Macht fühlt sich neuer dings wohl, was die deutsche Intelligenz repräsentieren möchte. Auch eine Möglichkeit. Eine heutige.
|
Thomas Rothschild - 26. Januar 2021
2714
|
 Internationale Küche
Internationale Küche
|
In Restaurantführern trifft man oft auf eine Kategorie „Internationale Küche“. Das kann nicht mehr sein als ein Verlegenheitsbegriff für all jene Restaurants, die sich in spezifischere Abteilungen – schwäbische, italienische, chinesische, makrobiotische Küche etc. – nicht einordnen lassen. Er kann zweierlei meinen: jene überall in der Welt anzutreffende Einheitsküche, der nationale und regionale Besonderheiten abhanden gekommen sind – also etwa Hamburger, Kebab oder Spaghetti Bolognese –, oder er kann als Oberbegriff die diversen nationalen Küchen (in der Regel: ohne die eigene, hier also ohne die deutsche Küche, wenn es denn eine gibt) vereinen.
In beiden Bedeutungen gehört die internationale Küche längst zum gastronomischen Alltag. Es bedurfte nicht der Globalisierung, um den Big Mac zum Vergleichsmaßstab der Lebenshaltungskosten zu machen. Es gibt ihn eben überall, und er hat überall seine Klientel. Andererseits gehören die Zeiten der Vergangenheit an, als Deutsche, wo sie auch hinkamen, nach Bratwurst und Sauerkraut Ausschau hielten. Mit italienischen, jugoslawischen und chinesischen Restaurants fing es an – vorausgegangen waren Szegediner Gulasch, Serbisches Reisfleisch oder Palatschinken aus der benachbarten österreichischen Monarchie –, und heute ist die Schwellenangst vor fremdartigen Genüssen weitgehend verschwunden. Reisen tun das Ihre, das Angebot an Zutaten und Gewürzen in Spezialläden und auf Märkten ermöglicht auch daheim den Umgang mit exotischen Rezepten. Die Wiedervereinigung hat den alten Bundesländern auf dem Umweg über die DDR die russische Soljanka eingebracht, und die Karriere der Sushi-Lokale, wo noch vor gar nicht langer Zeit roher Fisch als eklig galt, grenzt an ein Wunder.
Wir wollen noch gar nicht so weit gehen zu behaupten, dass die Bekanntschaft mit fremden Küchen die Völkerfreundschaft und damit den Frieden fördere. Man kann auch jemandem auf den Schädel schlagen, dessen Brühe man genießt. Aber sie schmecken einfach gut, die Gerichte, die nach und nach auf deutschem Boden heimisch wurden, die scharfen thailändischen Suppen, die diversen Varianten des Borschtsch aus Russland, Polen und Rumänien, die spanische Paella und das kreolische Jambalaya, die indischen Tandoori-Gerichte, die Somloer Nockerln aus Ungarn und die vorderasiatisch-osteuropäische Halva. Mousaka und Dolmades, Käsefondue und Nasi Goreng stehen schon länger auf dem Speiseplan der Deutschen. Es müssen nicht immer Maultaschen und Linsen mit Saiten und Spätzle sein.
Vielleicht aber bedarf es der heimischen Küche, damit das, was wir nun internationale Küche genannt haben, seinen besonderen Reiz entwickelt. Seinerzeit war schon eine Pizza etwas Besonderes. Heute, da jede Hausfrau mit Balsamico und mit Curry umgeht, als wären es Rapsöl und Salz, sind Gerichte aus fernen und nicht so fernen Ländern nicht exotischer als Sirtaki oder Reggae.
Als sich in den siebziger Jahren auch in Deutschland herumgesprochen hatte, dass Essen mehr sein könne als Sättigung, da war für die deutschen Spitzenköche die französische Küche das Vorbild, die, im Gegensatz etwa zur bäuerlichen, vom Nährwert bestimmten italienischen Küche, dem aristokratischen Genuss raffinierten Geschmacks dient. Es waren dann wiederum die Franzosen oder auch André Jaeger von der Fischerzunft in Schaffhausen, die Einflüsse der fernöstlichen Küche aufnahmen und kreativ weiterentwickelt haben. Der Begriff „Crossover“ ist auch bei uns längst in der Gastronomie ebenso gebräuchlich wie in der Musik.
Heute reicht der verführerische Geruch von Ćevapčići auf dem Holzkohlengrill oder das im Wok geschüttelte süßsaure Schweinefleisch nicht mehr aus, um die Gelüste nach internationaler Küche zu befriedigen. Da sie omnipräsent ist, fällt sie kaum noch auf. Dass zahlreiche preiswerte Restaurants und die Mehrheit der „Ausspeisungen“ in Sportvereinen oder Waldheimen mittlerweile von Immigranten betrieben werden, verdankt sich weniger der Aufgeschlossenheit bei den Essgewohnheiten als der ökonomischen Lage. Diese Betriebe können nur noch unter den Bedingungen der Selbstausbeutung überleben. Allmählich bekommt deutsche Küche oder was man dafür hält Seltenheitswert, weil sich kaum jemand den anstrengenden und riskanten Verhältnissen in der Gastronomie aussetzen möchte, wenn er nicht unbedingt muss.
„International“ ist kein Qualitätsbegriff. Aber internationale Küche gibt es mittlerweile in exquisiter, den Ansprüchen hoher Kochkunst entsprechender und in miserabler Ausführung. Von Konstanz bis Binz gibt es Restaurants der besten Sorte, die man nicht nur wegen der Atmosphäre besucht (die man freilich wiederum nicht verachten sollte: manche Lokale sind gerade deshalb beliebt und verströmen internationalen Flair nicht allein vom Herd aus).
All dies mag in Zeiten der pandemisch gesperrten Restaurants wie eine Reminiszenz an eine bessere Vergangenheit klingen. Sie wird wiederkehren. Vorläufig aber möchte ich die geschätzte Leserin und den geschätzten Leser nicht ohne eine Kostprobe der delikaten Gault & Millau-Prosa entlassen:
„Die Gerichte im Astra haben schon fast einen asketischen Charakter, sind linear und puristisch. Das Gebotene erinnert an Kompositionen, die man sonst in prämierten Restaurants europäischer Hauptstädte zu finden weiß. Die Menüs tragen eine klare Handschrift und sind Zeugen souveräner Aromen und Lektionen wohl durchdachter kulinarischer Arrangements. Die am Punkt gebratenen Jakobsmuscheln wurden begleitet von leicht gerösteten Romanasalat und Blaubeeren. Verschiedene Texturen von Mais kommen als Gemüse, Chip, gebraten und als Creme auf den Tisch, begleitet von gebratenem Steinbutt. Spätsommer ist Wildzeit und dies wird auch im Astra beherzigt mit Hirschfleisch und – sehr ungewöhnlich – einem eingelegten Eigelb samt Wildkräutern. Einer französischen Tradition entsprechend wird auch eine obligatorische kleine Käsevariation eingeschoben.“ Diese stilistischen Eskapaden sind zwar nicht so linear wie die Gerichte im Astra, aber sie sind, einer Gault Millau-Tradition entsprechend, Zeugen souveräner Gehirnerweichung.
|
Thomas Rothschild - 15. Januar 2021
2712
|
 Die Qual der Wahl
Die Qual der Wahl
|
"Die Südwest-Grünen küren Winfried Kretschmann mit 91,5 Prozent zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021. Sollte er erneut gewählt werden, will der Regierungschef den Klimaschutz, die Sicherung des Wohlstands sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt ins Zentrum seiner Arbeit stellen." (StN.de v. 12.12.2020, 11:04)
"Scholz schlug schon einmal seine Eckpfeiler für den Wahlkampf ein: gute Arbeitsplätze, der Kampf gegen den Klimawandel und mehr Respekt in der Gesellschaft. Als weitere Kernthemen nannte er auch die Digitalisierung, die Gleichstellung von Mann und Frau sowie ein einiges Europa." (tagesschau.de v. 12.12.2020, 14:00)
"Bundeskanzlerin Merkel sichert ärmeren Ländern weitere finanzielle Unterstützung für den Kampf gegen den Klimawandel zu. Alle Staaten müssten notwendige Klimaschutz-Investitionen finanzieren können, sagte die CDU-Politikerin in einer Video-Botschaft für den digitalen UNO-Klimagipfel. Der eigentliche Weltklimagipfel fällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus."(deutschlandfunk.de v. 12.12.2020)
"Die Einigung der Europäischen Union auf ein gemeinsames Klimaziel für 2030 begrüße ich ausdrücklich, denn Klimaschutz gelingt nur gemeinsam. Um das Ziel zu erreichen, den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken, müssen nun alle Mitgliedsstaaten an einem Strang ziehen. Die EU sollte gemeinsam einen Fahrplan vorgeben, wie wir dieses Ziel erreichen. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Wirtschaft nicht überfordert wird, sondern ihren Beitrag leisten kann. Baden-Württemberg hat dabei die Stärke einen globalen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten." (Daniel Karrais, der energiepolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Europa und Internationales; auf fdp-dvp-fraktion.de v. 11.12.2020)
Warum die Grünen die Wahl des Stuttgarter Oberbürgermeisters spektakulär verloren haben? Deshalb. An der Kandidatin hat es nicht gelegen. Und wenn nicht einmal 10 Prozent der Parteitagsdelegierten Einwände haben gegen einen Spitzenkandidaten, dem neben dem Klimaschutz, der einst die exklusive Domäne der Grünen war, nur Sicherung des Wohlstands und gesellschaftlicher Zusammenhalt einfallen, gibt es eigentlich keinen Grund, diese Partei zu wählen. Das können alle Parteien rechts der Mitte – siehe oben – eben so gut.
|
Thomas Rothschild - 12. Dezember 2020
2709
|
 Der Schmied statt dem Schmiedl
Der Schmied statt dem Schmiedl
|
Als die Sowjetunion noch existierte, erzählte man sich einen Witz. Als die Partei mit den ökonomischen Problemen des Landes nicht zurecht kam, empfahl jemand, einen berühmten Rabbiner aufzusuchen und um Rat zu fragen. Also ging eine Delegation des Zentralkomitees zu dem Mann und sagte: „Rebbe, es steht schlecht um unsere Wirtschaft, was sollen wir tun?“ Der Rabbiner antwortete: „Es gibt zwei Lösungen für das Problem, eine natürliche und ein Wunder.“ Da sagten die Genossen: „Wir sind eine atheistische Partei, da kommt nur eine natürliche Lösung in Frage. Wie wäre die?“ „Die sähe so aus“, sagte der Rabbiner. „Das Zentralkomitee setzt sich zusammen, ein Engel steigt vom Himmel herab und erleuchtet die Versammelten.“ „Das ist die natürliche Lösung?“, wunderten sich die Gäste. „Und wie wäre das Wunder?“ „Das Wunder“, sagte der Rebbe, „wäre, wenn das Zentralkomitee selbst eine Lösung fände.“
An diesen Witz musste ich denken, als die Grünen nun beschlossen haben, für die zweite Runde im Wahlgang für den Stuttgarter Oberbürgermeister nach dem Rückzug ihrer Kandidatin Veronika Kienzle keine Empfehlung für den gegen den Willen seiner eigenen Partei angetretenen Sozialdemokraten Marian Schreier abzugeben, der gegen den CDU-Kandidaten Frank Nopper antritt. Nopper hatte im ersten Wahlgang deutlich mehr Stimmen erhalten als alle seine Kontrahenten. Eine Chance hätte einer von ihnen, wenn überhaupt, allenfalls, wenn sich die Gegenstimmen auf einen Alternativkandidaten bündeln ließen. Nun gibt es aber noch Hannes Rockenbauch von der Wählergruppe Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS). Rockenbauch hat sich als Aktivist von Stuttgart 21 einen Namen gemacht und beharrt als einziger der OB-Kandidaten nach wie vor auf der Opposition gegen dieses Mammutvorhaben. Rockenbauch sitzt als Sprecher des Fraktionszusammenschlusses von SÖS, Linken, Piraten und Tierschutzpartei im Stuttgarter Gemeinderat. Er vertritt in fast allen politischen Fragen eine Position, die noch vor wenigen Jahren die Position der Grünen war. Die hätten nun Gelegenheit gehabt, da keine grüne Kandidatin mehr zur Wahl steht, seine Kandidatur zu unterstützen. Das freilich wäre ein Wunder.
Indem Veronika Kienzle und ihre Partei auf eine Empfehlung verzichten, steht so gut wie fest, dass Stuttgart einen CDU-OB bekommt. Dass die Grünen dafür wesentlich die Verantwortung tragen, ist wiederum kein Wunder. Die CDU ist ihnen längst näher als die ökologisch-soziale Gesinnung, die einmal die ihre war. Man muss schon sehr genau hinschauen, um politische Standpunkte zu entdecken, die den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann und den grünen Noch-OB von Stuttgart Fritz Kuhn von ihren CDU-Vorgängern unterscheiden. Kretschmann rühmt seine Partei schon seit Jahren dafür, dass sie in der Mitte angekommen sei, und plädiert für einen „neuen Konservatismus“, und das eben beschlossene neue Grundsatzprogramm der Grünen weist darauf hin, dass die Partei entschlossen ist, diesen Weg in verstärktem Maß weiter zu gehen. Was also sollte sie, wenn sie schon selbst keine Chancen hat, davon abhalten, einem CDU-Oberbürgermeister gegenüber einem Hannes Rockenbauch den Vorzug zu geben, der sie nur ständig daran erinnern würde, was sie einmal repräsentiert haben, als sie noch wehrlos, aber nicht ehrlos waren?
Die Grünen sind angekommen. Der Igel CDU ist allerdings schon da. Warum sollten die Stuttgarter im ersten Wahlgang den Schmiedl wählen, wenn sie den Schmied haben können? Es wäre ein Wunder.
|
Thomas Rothschild - 23. November 2020
2705
|
 Schmeißt sie raus!
Schmeißt sie raus!
|
Eine Freundin hat mir den Link zu einem Video zugeschickt, das ich nicht für mich behalten möchte.
Man könnte das ja für eine gelungene Satire halten, wenn es sich nicht um eine Realität handelte, deren Folgen mehr bedeuten als ein unterhaltsames Video. Dass Abgeordnete im Bundestag dem Einsatz der Bundeswehr in einem Kriegsgebiet zustimmen, ohne die geringste Ahnung von der Lage zu haben, ist, um ein mildes Wort zu gebrauchen, erschreckend. Fast schlimmer noch ist die Tatsache, dass solche Zustände das verbliebene Vertrauen in den Parlamentarismus und die Demokratie nachhaltig beschädigen, und zwar in Belangen, die eine größere Tragweite haben als die Frage, ob man nach 23 Uhr ein Bier trinken oder ohne Mund-Nasen-Maske durch die Fußgängerzone spazieren darf. Soll man sie deshalb verschweigen? Abgesehen davon, dass die Verheimlichung von Fakten aus den Parlamenten, von den Voraussetzungen für Entscheidungen, die nicht weniger als Krieg und Frieden betreffen, kaum mit demokratischen Prinzipien vereinbar wäre, ist solch ein Versuch ohnedies vergeblich. Das Video ist nun einmal in der Welt, konkret: im Internet und für jeden abrufbar.
Daraus ergeben sich zwei logische Folgerungen, eine, die sich nicht in eine Tat umsetzen lässt, und eine, die sich verwirklichen lässt. Die erste lautet: Schmeißt Abgeordnete, die derart uninformiert (nicht nur) über die Beteiligung an militärischen Einsätzen abstimmen wie die Exemplare in diesem Video, aus dem Bundestag. Die zweite lautet: Wählt nie wieder eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die oder der so blamabel kenntnislos unser und anderer politisches Schicksal bestimmt, im Extremfall über Tod oder Leben entscheidet. Lasst nicht zu, dass die deutschen Parlamente sich auf das Niveau von Donald Trump begeben. Die Verantwortung liegt auch bei den Wählern. Also bei Ihnen. Man sage nicht im Nachhinein: Das haben wir nicht gewusst. Das haben wir nicht gewollt. Sonst unterscheidet man sich um keinen Deut von jener Bundestagsabgeordneten, die auf die Frage, was „gemäßigte Rebellen“ seien, nur feixend, als ginge es um die Beurteilung von Red Bull, zu antworten weiß: „Rebellen sind manchmal auch nur Rebellen um des Rebellen-Seins willen“. Und für oder gegen die – wer weiß das so genau – setzen wir unsere Soldaten der Todesgefahr aus? Nein, für eine Satire ist das alles viel zu ernst.
|
Thomas Rothschild - 16. Oktober 2020
2700
|
 Fragen, die ich mich nicht zu stellen traue
Fragen, die ich mich nicht zu stellen traue
|
Sie sind doch ein schöner Mensch – Warum verunstalten Sie Ihren Körper durch Tätowierungen?
Sie sind doch ein intelligenter Mensch – Warum wählen Sie Politiker, die weniger intelligent sind als Sie?
Sie sind doch ein Arzt – Warum beten Sie zu Gott um Gesundheit?
Sie sind doch tolerant – Warum finden Sie es erwähnenswert, dass jemand homosexuell ist?
Sie finden doch viele Menschen unausstehlich – Warum glauben Sie, dass ausgerechnet Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Tochter, Ihr Sohn liebenswert sind?
Sie sind doch kein Nationalist – Warum bejubeln Sie jeden Sieg einer deutschen Fußballmannschaft und nicht ein schönes Spiel, in dem die Deutschen besiegt werden?
Sie wollen doch, dass Ihre Privatsphäre respektiert wird – Warum nötigen Sie in der S-Bahn alle Mitreisenden zur Wahrnehmung Ihrer Telefonate?
Sie können doch rechnen – Warum kaufen Sie sich einen Lottoschein?
Sie sind doch Christ – Warum lieben Sie Ihren muslimischen Nächsten weniger als sich selbst?
Sie wollen doch für Ihre Arbeit gerecht bezahlt und nicht durch ein Trinkgeld gedemütigt werden – Warum setzen Sie sich nicht dafür ein, dass das auch für andere gilt?
Sie lieben doch die Freiheit – Warum dulden Sie, dass andere in ihrer Freiheit eingeschränkt werden?
Sie wollen doch nicht ausgenutzt werden – Warum machen Sie sich zum unbezahlten Werbe-Träger, indem sie T-Shirts und Plastikbeutel mit Firmenaufdrucken herumtragen?
Sie wollen doch nicht belogen werden – Warum lügen Sie?
Sie sind doch um die Umwelt besorgt – Warum lassen Sie den Motor Ihres parkenden Autos laufen?
Sie mögen doch Licht und Sonne – Warum nehmen Sie es widerspruchslos hin, dass Ihnen Hochhäuser vor das Fenster gebaut werden?
Sie wünschen sich doch gesunde Kinder – Warum gehen Sie mit ihnen zu McDonald‘s?
|
Thomas Rothschild - 5. September 2020
2697
|
 Nicht geklappt
Nicht geklappt
|
Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann wollte, als er noch nicht Ministerpräsident war, Stuttgart 21 verhindern. Inzwischen beteiligt er sich an der Ausführung von Stuttgart 21, unbeeindruckt von Skandalen und steigenden Kosten. Immerhin kann er sich auf eine Volksabstimmung berufen, in der sich eine knappe Mehrheit für Stuttgart 21 entschieden hat.
Die grüne Bezirksvorsteherin von Stuttgart Mitte und Kandidatin für die Nachfolge des grünen Oberbürgermeisters Fritz Kuhn Veronika Kienzle beklagt, dass ein 60 Meter hoher Hotelturm vor die für ihre originelle Architektur vielfach gelobte Stadtbibliothek gebaut wird und die Sicht auf diese verstellt. Auch das Versprechen, dass der Neubau begrünt werde, wird nun nicht eingehalten.
Darüber hat es keine Volksabstimmung gegeben. Veronika Kienzle und ihre Parteifreunde haben keine Ausrede. Der Staatsbürger aber muss sich fragen, welchen Sinn eine repräsentative Demokratie haben soll, wenn die gewählten Vertreter nicht in der Lage sind, menschen- und umweltfeindliche Bauvorhaben zu verhindern und die Einhaltung von Versprechen durchzusetzen. Einmal mehr wird deutlich, dass nicht die Politik, sondern die Wirtschaft beschließt, was zu geschehen hat, und die gewählten Volksvertreter, egal von welcher Fraktion, jammern ein wenig, ehe sie auch dies abnicken.
Die Stuttgarter Nachrichten melden: „Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) macht aus ihrem Herzen dagegen keine Mördergrube: ‚Es ist einfach schade, dass man ein weltweit bekanntes Stadt- und Kulturgebäude nun nicht mehr sieht und das nun an Strahlkraft verloren hat.‘ Weiter meint die OB-Kandidatin: ‚Noch bedauerlicher ist es aus städtebaulicher Sicht, dass es mit der Begrünung des Gebäudes nicht geklappt hat.‘“
„Schade“ und „nicht geklappt“ sind, sorry, keine politischen Kategorien.
Bezirksvorsteherinnen und Oberbürgermeisterinnen werden gewählt, damit sie gegen Profitinteressen abwehren, was schade ist, und dafür sorgen, dass klappt, was im Vorfeld zur Genehmigung der Baupläne versprochen wurde. Ansonsten kann man auf Wahlen verzichten. Wem gehört die Stadt? hieß ein Film aus dem Jahr 1936. Ja, wem gehört sie? Hände über der Stadt hieß ein weiterer Film von 1963. Man sollte ihn vor den nächsten Wahlen ansehen. Damit man sich nicht dumm stellen kann, wenn jene an das Ruder kommen, die im Nachhinein bedauern, was schade ist und nicht geklappt hat.
|
Thomas Rothschild - 29. August 2020 (2)
2696
|
 Schuldzuweisungen
Schuldzuweisungen
|
In der Stuttgarter Innenstadt haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis zu 500 Jugendliche randaliert, Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert. Die Polizei hat dafür die „Party- und Eventszene“ verantwortlich gemacht. Dagegen haben Clubbetreiber nun protestiert. Die verallgemeinernde Schuldzuweisung, die eine komplette Branche in ein schlechtes Licht rücke, sei verantwortungslos.
Unmittelbar nach den Ereignissen meldete dpa und zitierten zahllose Medien: „Vor einigen Tagen hatte die Stuttgarter Polizei nach Vorfällen am Rande einer Demonstration von Grenzüberschreitungen gesprochen. 'Teile der linken Szene überschreiten hier gerade Linien, was wir für Stuttgart bisher so nicht gekannt haben', sagte damals ein Polizeisprecher.“ Dagegen hatten die Sprecher der Partyszene nichts einzuwenden. So aber schafft man Stimmung und steckt den politischen Rahmen ab. Das hat Tradition in der deutschen Geschichte. Und niemand zieht die zündelnden oder zumindest fahrlässigen Journalisten zur Verantwortung.
Offenbar hat man gegen falsche oder pauschalisierende Schuldzuweisungen nur etwas einzuwenden, wenn sie die eigene Klientel betreffen. Ansonsten nimmt man sie gleichgültig oder sogar billigend hin. So kommen wir nicht weiter. Weder in der Partyszene, die mit Nachdruck betont, dass sie „ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“ sei, noch unter Linken, die dieses schlagende Argument nicht für sich in Anspruch nehmen können. So oder so sollte man aufhorchen, wenn jemand allzu schnell zu wissen vorgibt, wer welche Schandtaten verübt hat. Wie war das doch damals? Wer hat den Reichstag angezündet? Und welchen Preis mussten die angeblich Schuldigen bezahlen? Das ist keine hundert Jahre her.
|
Thomas Rothschild - 22. Juni 2020
2686
|
 Für dumm verkauft
Für dumm verkauft
|
Das macht Schlagzeilen: „Bahnfahren wird noch günstiger“. Und: „Bahn senkt Preise für Fernverkehr". Die Bahn gibt die gesenkte Mehrwertsteuer an die Kunden weiter. Das bedeutet: ein Ticket, das bisher 50 Euro gekostet hat, kostet ab 1. Juli nur noch 49,05 Euro. Die Preissenkung, die die Bahn nichts kostet, ist materiell kaum spürbar. Sie ist bloß psychologisch – für die Mehrzahl der Menschen, die Schlagzeilen vom Rechnen abhalten. Von einer Weitergabe der aktuellen Preissenkungen für Energie an die Bahnfahrer ist nicht die Rede.
Die Benzinpreise sind in den vergangenen Wochen um rund 20 Prozent gefallen. Das bedeutet: eine Tankfüllung, für die man bisher 50 Euro bezahlt hat, kostet nur noch 40 Euro. 20 Euro Ersparnis an der Tankstelle gegenüber 95 Cent beim Bahnticket. Mit anderen Worten: die Bahn ist noch weniger konkurrenzfähig gegenüber dem Individualverkehr als sie es bisher schon war. Das gilt umso mehr, wenn mehrere Personen gemeinsam ein Auto benutzen. Statt 200 Euro für 4 Personen – geschätzte 40 Euro. Und sage da nun keiner, man müsse die Festkosten für das Auto hinzurechnen. Wenn man nicht ganz aufs Auto verzichten möchte und dann erheblich mehr fürs Taxi berappen will, wo und wenn es keine Bahnverbindung gibt, muss man die Versicherung und die KFZ-Steuer bezahlen, ob man nun das Auto bewegt oder am Straßenrand stehen lässt. Und auch der Wiederverkaufswert sinkt bei einer höheren Kilometerzahl nicht annähern um die Summe, die man für Bahnfahrten, selbst bei gesenkter Mehrwertsteuer, bezahlen müsste.
Die Verlagerung des Güterverkehrs und des Personenverkehrs von der Straße auf die Schiene wäre unter umweltpolitischen Gesichtspunkten ein dringendes Desiderat. Mit der Weitergabe einer Steuersenkung von 1,9 Prozent an die Kunden ist das nicht getan. Dafür müssen sich die zuständigen Politiker und die Bahn schon mehr einfallen lassen. Die Jubelschreie willfähriger Journalisten werden nicht reichen. Und so dumm sind die Leser auch nicht, dass sie auf jede Augenwischerei hereinfallen. Spätesten am Monatsende, wenn die Geldbörse leer ist, entdecken sie, was für ein Spiel da getrieben wird.
|
Thomas Rothschild - 9. Juni 2020
2684
|
 Legale Segregation
Legale Segregation
|
Im April 1989, Tage vor seinem vermutlichen Selbstmord, sagte Abbie Hoffman, der Kopf der amerikanischen Yippies, einer der Angeklagten im skandalösen Prozess gegen die „Chicago 7“ und ein Kronzeuge für die Erkenntnis, dass die Rebellen gegen die eigene Regierung manchmal die wahren Patrioten sind, in seiner letzten Rede an der Vanderbilt University: „In the nineteen-sixties, apartheid was driven out of America. Legal segregation – Jim Crow – ended. We didn’t end racism, but we ended legal segregation. We ended the idea that you can send a million soldiers ten thousand miles away to fight in a war that people do not support. We ended the idea that women are second-class citizens. We made the environment an issue that couldn’t be avoided. Now, it doesn’t matter who sits in the Oval Office. But the big battles that were won in that period of civil war and strife you cannot reverse. We were young, we were reckless, arrogant, silly, headstrong and scared half to death. And we were right! I regret nothing!“
Bemerkenswert an dieser Rede ist für uns Heutige, dass sie daran erinnert, wo die Themen, die uns in der Gegenwart, und nicht nur in den USA, bewegen, ihre Geburtsstunde haben: In der antiautoritären Bewegung der sechziger Jahre. Sie liegt also nur wenig mehr als 50 Jahre zurück. Man sollte aber ein Attribut nicht übersehen. Hoffman spricht vom Ende der „legal segregation“, also der „gesetzlichen Segregation“. Die soziale Segregation, die Rassentrennung – Hoffman spricht von „Rassismus“ – besteht weiterhin. Der aktuelle Skandal um den Tod von George Floyd ist nur die Spitze des Eisbergs. Die in den sechziger und den darauffolgenden Jahren erlassenen Gesetze zur Desegregation entsprechen dem Toleranzpatent Kaiser Josephs II. von 1782, mit dem den Juden Österreichs einige bis dahin vorenthaltene Rechte zugesprochen wurden. Am Antisemitismus und an der Benachteiligung von Juden in vielen Bereichen hat das nichts geändert. Das Frauenwahlrecht ist heute ebenso unumstritten wie die Einsicht, dass die Umwelt geschützt werden müsse. Die Ungleichbehandlung von Frauen in mancherlei Hinsicht wurde dadurch ebenso wenig beseitigt wie die verantwortungslose Ausbeutung und Schädigung der Umwelt.
Gesetze können eine Voraussetzung schaffen für mehr Gerechtigkeit. Aber sie reichen nicht aus. Soziale Mechanismen der Diskriminierung sind hartnäckig, und leider irrte Abbie Hoffman, wenn er meinte, die gewonnenen Schlachten könnten nicht rückgängig gemacht werden. Wir erleben, im Gegenteil, dass sich viele Siege der sechziger Jahre, die 1989 noch gesichert scheinen mochten, in Niederlagen wandeln, wie Vorurteile und Unterdrückungsmaßnahmen zu neuem Leben erwachen, von denen man gemeint hatte, sie würden unwiederbringlich der Vergangenheit angehören. Welche Studierenden unserer Tage können sich noch vorstellen, dass es Betriebe mit echter Mitbestimmung und an den Hochschulen eine Drittelparität gab, die es den Studenten zusammen mit dem Mittelbau zumindest im Prinzip ermöglichte, die Machtausübung der Professoren zu kontrollieren und einzuschränken. Heute setzen sich diese längst wieder über Verpflichtungen und Dienstvorschriften hinweg, ohne dass das irgendwelche Folgen hätte. Und keiner fährt ihnen in die Parade, wenn sie ihren Hauptwohnsitz 200 Kilometer von der Arbeitsstelle entfernt wählen oder Lehrveranstaltungen und Sprechstunden einfach ausfallen lassen. Die korrumpierende Funktion von Abhängigkeiten beschränkt sich nicht auf sexuellen Missbrauch, der zudem nicht immer unterscheidbar ist von Vorteilsannahme auf Kosten derer, die sich diesen Spielregeln verweigern. Die Grenze zwischen Erpressung und Bestechung ist fließend. Aber ein #Me Too der durch Prüfungen oder Karrierebedenken konstituierten Abhängigkeitsverhältnisse im Hochschul- oder Arbeitsalltag verfügte über kein Erregungspotential. Sie werden hingenommen und gelten heute wieder wie einst als Normalität. Zur neuen Normalität feudaler Selbstherrlichkeit gehört, dass nicht die Qualifikation zu Lehre und Forschung einen Ruf einbringt, sondern der Erfolg beim Eintreiben von Drittmitteln. Und wenn die Berufenen beiderlei Geschlechts danach doch „forschen“, dann mit Sicherheit nicht gegen die Interessen der Drittmittel-Spender. Die „legale“ Aushöhlung der Hochschulautonomie wurde nach den sechziger Jahren erst so richtig eingeführt.
Der Fortschritt ist nicht garantiert. Die Geschichte läuft nicht teleologisch ab. Entgegen einer Volksweisheit, kann sie sich durchaus wiederholen, ja noch hinter ein früheres Stadium zurückfallen. In manchen Ländern werden Gesetze (wieder) erlassen, von denen man geglaubt hatte, sie seien ebenso obsolet wie die legale Segregation. Aber auch ohne solche Gesetze gilt nach wie vor: „We didn’t end racism, but we ended legal segregation.“ Ein schwacher Trost für die Opfer des Rassismus. Und auch der nächste Satz Hoffmans war leider zu optimistisch: „We ended the idea that you can send a million soldiers ten thousand miles away to fight in a war that people do not support.“ Ein Jahr nachdem er gesprochen und sein Autor gestorben war, begann der Erste Irakkrieg.
Zu den Forderungen, die der ernste Spaßmacher Abbie Hoffman, das amerikanische Gegenstück zu Fritz Teufel, in einem Manifest formuliert hat, gehört auch diese: „The abolition of money, the abolition of pay housing, pay media, pay transportation, pay food, pay education, pay clothing, pay medical health, and pay toilets.“ Davon sind wir heute weiter entfernt als je. Es werden Kriege geführt, das Geld herrscht nicht nur über die Toiletten, und die Segregation kümmert sich einen Dreck (Hoffman hätte dafür einen anderen Ausdruck) um Gesetze. Es gibt zwar nichts, was Abbie Hoffman und seine Mitstreiter bereuen müssten. Aber ihre Siege waren, genau besehen, von begrenzter Haltbarkeit. Es hat eine vertrackte Logik, dass einer von Hoffmans Genossen, Tom Hayden, 1992 kalifornischer Senator wurde. Für die Demokraten. Immerhin. 1968 hatte er noch zusammen mit Abbie Hoffman vor deren Parteitag gegen den Vietnamkrieg protestiert.
|
Thomas Rothschild - 3. Juni 2020
2683
|
 Krisengewinnler
Krisengewinnler
|
„Die Aktionäre profitieren davon, dass die Solidargemeinschaft mit ihrem Geld letztlich auch den Unternehmenswert erhält. Wenn sie obendrauf noch eine Dividende bekommen, dann ist das unfair gegenüber den Steuerzahlern und auch gegenüber den Mitarbeitern.“ Das sagt nicht ein Politiker der Linken oder ein dogmatischer Kapitalismuskritiker, sondern der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Ralph Brinkhaus.
Der Begriff des Kriegsgewinnlers ist bekannt. Analog dazu kann man in der gegenwärtigen Situation vom Krisengewinnler sprechen. Kein Tag vergeht, an dem nicht heftige Klagen über die dramatischen Folgen der Coronakrise verlautbart werden. Da diese Klagen in vielen Einzelfällen begründet sind, begegnet man ihnen eher mit Empathie als mit Skepsis. Umso empörender ist es, dass sich Menschen und Unternehmen mit krimineller Energie beeilen, von der Notlage anderer zu profitieren, sich an deren misslichen Situation zu bereichern. Die Schamlosigkeit, mit der die Krise von manchen zum eigenen Nutzen ausgebeutet wird, kann einen an der Menschheit verzweifeln lassen und verweist die Behauptung, die Krise hätte das Gute im Menschen zum Vorschein gebracht, in die Sphäre des Märchens.
Im Drogeriemarkt versperren riesige Klopapierberge die Durchgänge. Nachdem es in den ersten Tagen der Krise eine Knappheit an Klopapier gegeben hatte, wird die Angst vor dem feuchten Arsch jetzt weidlich ausgenützt. Die Hersteller von überteuerten Gesichtsmasken und von Anschlägen mit Verhaltensregeln im öffentlichen Bereich dürften nicht zu den Verlierern der Krise gehören. Kaum wurden die ersten Zuschüsse für notleidende oder von der Insolvenz bedrohte Unternehmen angekündigt, überboten sich auch jene in der alarmierenden Darstellung ihrer Lage, die es versäumt hatten, in Zeiten der üppigen Umsätze vorzusorgen. Auf einmal meldeten alle gewaltige Verluste, obwohl die Gewinne zuvor entweder nicht so hoch waren, wie sie jetzt vorgeben, oder aber vor dem Finanzamt verheimlicht wurden.
Die Aktienkurse sprechen in zahlreichen Fällen eine andere Sprache als die Katastrophenberichte. Die vom CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden getadelten Dividenden haben schon ihre Richtigkeit. Für die Krisengewinnler. Die Stützen der Gesellschaft.
|
Thomas Rothschild - 24. Mai 2020
2682
|
 Verschwörungstheorien
Verschwörungstheorien
|
Dass hinter der Verbreitung des Coronavirus eine Verschwörung stecke, ist natürlich Unsinn. Es ist ebenso unsinnig wie die Annahme einer jungfräulichen Geburt oder des Lebens nach dem Tod. Nein, es ist nicht ganz so unsinnig. Immerhin hat es in der Geschichte Verschwörungen gegeben, von dem Komplott gegen Julius Caesar bis zum Attentat der Gruppe um Stauffenberg gegen Hitler. Gäbe es keine Verschwörungen, wären sie nichts als ein Hirngespinst, bedürfte es keiner Geheimdienste und die Staaten könnten sich viel Geld sparen. Und dass sie schwer nachzuweisen sind, dass sie sich im Verborgenen abspielen, gehört ja gerade zu ihren Wesensmerkmalen. Verschwörungstheorien also haben immerhin eine empirische Grundlage. In Abwandlung eines bekannten Aphorismus ließe sich sagen: „Nur weil du dir Verschwörungen einbildest, heißt das nicht, dass es keine Verschwörungen gibt.“ Für eine jungfräuliche Geburt oder für ein Leben nach dem Tod existiert kein einziger objektiv überprüfbarer Beleg.
Verschwörungstheorien haben deshalb einen so großen Erfolg, weil Menschen dankbar sind für jede Erklärung von scheinbar unerklärlichen Phänomenen. Dass irgendwo im Geheimen Böses geplant und ausgeführt wird, scheint solch eine Erklärung für Schreckensszenarien zu liefern, und die Künste haben dazu jede Menge Anregungen bereit gestellt. Dr. Mabuse oder Goldfinger dienen als Modell. Als man noch nichts von der elektrischen Aufladung von Wolken wusste, erfand man Blitze schleudernde Götter und dazu gleich die Ursachen für deren Taten. Selbst wo es wissenschaftliche Erklärungen gibt, wie etwa mit der Evolutionstheorie für die Entstehung des Lebens und des Menschen, halten sich mythische Vorstellungen wie die Schöpfungstheorie beharrlich und politisch gewollt, wenn diese Erklärungen das Vorstellungsvermögen vieler übersteigen.
Wer also will, dass unsinnige und letzten Endes gefährliche Verschwörungstheorien durchschaut und zurückgewiesen werden, muss sich aktiv gegen den allgemeinen Irrationalismus wenden. Er muss dazu beitragen, dass Menschen das noch Unerklärte oder vielleicht sogar Unerklärliche ebenso aushalten wie das Unangenehme – den Gedanken an den Tod etwa –, und all jene, nicht nur die Demagogen politischer Interessensgruppen, bekämpft werden, die unwissenschaftliche Antworten auf offene Fragen anbieten. Der Kampf gegen Irrationalismus beginnt, wo Menschen an die Existenz von Hexen, an Geisterbeschwörung oder an Wunder glauben, die sonntags in der Predigt als Tatsachen verkündet werden. So lange dieser Irrationalismus als gesellschaftsfähig gilt, werden auch Verschwörungstheorien Nahrung erhalten. Wer oder was sollte deren Unglaubwürdigkeit glaubwürdig nachweisen, wo die unbefleckte Empfängnis als Dogma akzeptiert wird? Und schließlich: was, wenn nicht der Glaube an den Teufel, der seine Hand bei mancherlei Übel im Spiel habe, wäre eine Verschwörungstheorie? „Wenn du ein Gespräch mit dem Teufel anfängst, hast du schon verloren, er ist intelligenter als wir und stößt dich um und verdreht dir den Kopf.“ (Papst Franziskus) Sowohl für Kritik an der Kirche wie für sexuellen Missbrauch durch deren Repräsentanten macht der Papst den Teufel verantwortlich. „Wir sollten den Teufel allerdings nicht als einen Mythos, eine Darstellung, ein Symbol, eine Redewendung oder eine Idee betrachten.“ (derselbe) 26 Prozent der Deutschen glauben an die Existenz des Teufels, für dessen Austreibung die katholische Kirche bis heute Exorzisten bereit hält. Na bitte.
|
Thomas Rothschild - 22. Mai 2020
2680
|
 Prioritäten
Prioritäten
|
Die Stuttgarter Nachrichten melden, womit sich der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn Tadel eingeheimst hat. Er hat aus den bekannten Gründen für dieses Jahr das beliebte Cannstatter Volksfest abgesagt. Der CDU-Fraktionschef im Gemeinderat Alexander Kotz ätzte daraufhin: „Es ist kein Geheimnis, dass der OB nie eine große Leidenschaft oder gar Herzblut für das größte Fest der Schwaben entwickelt hat.“
In der selben Meldung verkündet das Forum der Kulturen das Aus für das vom 14. bis 19. Juli geplante Festival der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz. Über Herrn Kotz‘ Leidenschaft und Herzblut für diese Veranstaltung ist nichts zu erfahren.
Das ist Populismus pur. Auch noch bei sinnvollen Maßnahmen gegen die Verbreitung einer Krankheit schmeißt sich die CDU an die potentiellen Volksfestbesucher ran und macht für die gewiss in mancherlei Hinsicht bedauerliche Absage des „größten Fests der Schwaben“ den politischen Gegner verantwortlich. Man muss nicht der Ansicht sein, dass die Grünen eine Politik machen, die sich grundsätzlich von der ihrer Koalitionspartner im Land unterscheidet. Aber diese Art von Polemik ist widerwärtig.
In diesen Rahmen passt auch die Replik auf einen Vorschlag der Bezirksvorsteherin im Bezirk Stuttgart Mitte und Kandidatin der Grünen für die Nachfolge von Fritz Kuhn als Oberbürgermeisterin Veronika Kienzle. Sie hatte eine zeitweilige Erweiterung der Außengastronomie zur Kompensation der aktuellen wirtschaftlichen Einbußen ohne Gemeinderatsbeschluss und nur mit dem Plazet von Bezirksbeiräten, Polizei, Feuerwehr und Amt für öffentliche Ordnung ins Gespräch gebracht. Darauf konterte besagter Alexander Kotz mit schwerem rhetorischem Geschütz. Dass ausgerechnet Kienzle diesen Vorschlag unterbreitet habe, sei „an Absurdität kaum zu überbieten“. Insbesondere Gastronomen, Barbesitzer und Club-Betreiber seien bisher vor Konflikte mit der Bezirksvorsteherin gestellt worden, „gerade die Außengastronomie musste mit zentimeterscharfen Einwänden und zeitlichen Begrenzungen durch Kienzle kämpfen“. Da tut eine Grüne genau das, was bei der CDU gemeinhin oberste Priorität hat – sie kommt den wirtschaftlichen Interessen einer bestimmten Klientel entgegen –, und die CDU-Fraktion, statt sich darüber zu freuen, schießt sich in vorausschauendem Bammel vor der nächsten Wahl auf sie ein. Was sie wohlwissend verschweigt, was aber jeder Schüler im Volksschulalter begreift, ist dies: dass unterschiedliche Situationen unterschiedliche Reaktionen erfordern. Man kann sehr wohl gegen die ungebremste Ausbreitung von gastronomischen Angeboten und Events in den Innenstädten sein und ihnen in der besonderen Lage nach einer erzwungenen Schließung Kompromisse anbieten.
Da wir nicht unterstellen wollen, dass Alexander Kotz dumm ist, müssen wir davon ausgehen, dass er sich dumm stellt. Darüber könnte man mit einem Schulterzucken hinweg gehen, wenn die Folgen nicht so verheerend wären. Es kann einem nur angst und bang werden angesichts einer Politik, die keine Probleme lösen und keine Entscheidungen fällen will, die der Allgemeinheit nützen, sondern der es nur um die Vernichtung des politischen Gegners und um die Macht geht. Die CDU hat auf diese Verfahrensweise kein Monopol. Aber sie und ihr Kotz haben sich im aktuellen Fall unrühmlich hervorgetan. Mit Leidenschaft und Herzblut.
|
Thomas Rothschild - 1. Mai 2020
2676
|
 Auf Leben und Tod
Auf Leben und Tod
|
Auf ZEIT ONLINE hat Luisa Jacobs von einem Rumänen berichtet, der zusammen mit 80.000 Landsleuten nach Deutschland eingeflogen worden war, um bei der Spargelernte auszuhelfen, an Covid-19 erkrankt und am Osterwochenende verstorben ist. Und sie resümiert über die zuständigen Politiker: „Sie haben in Kauf genommen, dass eine große Menge an Menschen zusammenkommt, zu einem Zeitpunkt, wo das aus gutem Grund überall verboten ist. Sie haben in Kauf genommen, dass sich das Virus verbreitet unter Menschen, von denen zwar nicht alle, aber doch viele zur Risikogruppe gehören. Der verstorbene Erntehelfer aus Rumänien war 57 Jahre alt.“
Unter den Kommentaren zu dem Artikel gibt es eine ganze Reihe, die ihm zustimmen. Es gibt auch, erwartungsgemäß, jede Menge Widerspruch. Schließlich will man sich die Freude am Spargel nicht durch solche Hiobsbotschaften verderben lassen. Ein „Argument“, das in unterschiedlicher Formulierung auftaucht, lautet: „Die Erntehelfer aus Osteuropa wollen die Arbeit tun. Der Lohn ist für diese sehr attraktiv. Wollen wir denen diese Erwerbsquelle nehmen?“ Es ist das uralte Kolonialherrenargument. Die Arbeitssklaven sollen dafür dankbar sein, dass sie skandalös bezahlt werden und im Grenzfall sogar ihr Leben riskieren. Die Ausbeuter als Wohltäter.
Dass diese Sekundärrationalisierung bei jenen funktioniert, die vom traditionellen und vom modernen Kolonialismus profitieren, ist nicht weiter verwunderlich. Erstaunlicher und auch deprimierender ist die Tatsache, dass viele Menschen solchen Vorwänden glauben, deren Interessen durch sie nicht berührt werden. Sie mögen mehr verdienen als die Erntehelfer aus Osteuropa oder auch aus Afrika, sie mögen es sogar schätzen, wenn sie sich das einstige Luxusprodukt Spargel leisten können, aber wenn sie nur einen Augenblick nachdächten und sich jener Werte besännen, die einst als Grundlage der Moral galten, an Gewissen, Menschlichkeit und Nächstenliebe, dann gälte ihre Solidarität den eingeflogenen Saisonarbeitern und nicht jenen Großunternehmen, die ihnen leutselig eine „Erwerbsquelle“ bieten. Auf Leben und Tod.
|
Thomas Rothschild – 19. April 2020
2674
|
 Social Anbiederung
Social Anbiederung
|
Zu den Kollateralschäden der Coronakrise gehört die Verkitschung des Alltags. Begonnen hat sie schon lange zuvor. Man kann ihren Ausbruch datieren mit Margarethe von Trottas Film Das zweite Erwachen der Christa Klages. Er zeigte, nicht etwa kritisch oder satirisch, sondern in höchstem Maße affirmativ und sentimental, eine Orgie der Umarmungen. Was bis dahin den Damen der besseren Gesellschaft vorbehalten geblieben war und von jedem halbwegs vernünftigen Menschen als affig belächelt wurde, das scheinheilige Bussi-Bussi, zog alsbald in den Alltag ein. Ich erinnere mich noch sehr genau: Das erste Mal fiel mir der befremdliche demonstrative Akt – ich war gerade von Wien nach Stuttgart übersiedelt – bei den Vernissagen in der Galerie am Universitätsinstitut von Max Bense auf. Der Körperkontakt als Ausweis von Sympathie und Solidarität wurde zum Ritual, das freilich nicht mehr bedeutet als der Handschlag, mit dem man symbolisch offenbart, dass man keine Waffe trägt.
Die Corona-Regeln haben der Umarmung Grenzen gesetzt. Das könnte man auf die Seite der positiven Folgen der Epidemie verbuchen. Aber die Not macht erfinderisch. Und so hat sich das Kitschbedürfnis in gesteigerter Form vom Körperlichen in die Sprache verlagert. Mit der so genannten „sozialen Distanzierung“, die genauer eine „räumliche Distanzierung“ ist, ist die Anbiederung mit der exponentiellen Verbreitung des Coronavirus in die sprachliche Kommunikation eingebrochen. Man redet mit einander, als habe man es mit dementen Trotteln zu tun, mit lauter Protagonisten der Risikogruppe, die man vor Witz, Ironie und auch Sarkasmus zu schützen habe und denen man nur die Begrifflichkeit eines Kleinkindes zutrauen kann. Unaufhaltsam werden sprachliche Streicheleinheiten verteilt, die leider nicht mehr sind als Floskeln, gedankenlos ausgeschiedene Leerformeln wie das Amen im Gebet. Dazu zählt auch die Aufforderung, die Quarantäne zu nutzen, indem man sich mehr mit sich selbst beschäftigt. Als ob es daran mangelte!
Derlei spendet nicht wirklich Trost. Aber es schadet der sozialen Hygiene. Und es bleibt zu fürchten, dass es die Coronakrise überleben wird, wie die Umarmungen der Christa Klages den Einzug des modernen Feminismus ins Kino und in die Gesellschaft überlebt haben.
Cecilia Bartoli, die Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele, teilt den „lieben Freunden“ via Website mit: „Ich hatte mich so darauf gefreut, die Proben mit dem fantastischen Salzburger Team und meinen Künstlerkollegen aufzunehmen und unser treues Publikum und Freunde zu treffen, die jedes Jahr nach Salzburg kommen – genau wie die, die dieses Jahr zum ersten Mal dabei sein wollten! Diese Entscheidung bricht mir das Herz, aber eines ist klar – Gesundheit geht vor! Es ist außer Frage, dass wir, unsere gesamte Gesellschaft, zusammenhalten müssen, um uns und unsere Lieben zu schützen. Es sind schwierige Zeiten für uns alle, aber ich bin sicher, dass die Kraft der Musik uns helfen wird, dies zu überstehen.“ Kitsch pur. Unverdünnter verbaler Sirup, der zumindest eine Magenverstimmung verursacht. Ach würde die große Bartoli doch singen anstatt zu dichten!
Hand in Hand mit der Verkitschung geht das Geplapper, die Äußerung von Meinungen, für die Widerspruchsfreiheit ein unmoralisches Ansinnen ist. In einem einzigen Interview sagt ein Medienwissenschaftler: „Und schließlich war die Diskursverweigerung von der Prämisse geprägt: Debatten verstören, sie verunsichern.“ „Und man sieht: Mehr Information macht uns nicht automatisch mündiger, sondern erhöht die Chancen effektiver Desinformation, zumal und besonders im Moment der gefühlten und der tatsächlichen Gefahr.“ „Denn wir sind im Moment nicht nur mit der Gefahr einer Virusinfektion konfrontiert, sondern erfahren auch, was es heißt, eine Infodemie zu erleben: Gerüchte und Spekulationen erreichen viele Menschen in nie gekannter Direktheit auf privaten Kommunikationskanälen und führen zur emotionalen Infektion, zu einer Gefühlsansteckung, die verunsichert und verstört.“ „Es gilt also, Abschied zu nehmen vom kommentierenden Sofortismus, der nur zur weiteren Überhitzung des Kommunikationsklimas beiträgt.“ Diskursverweigerung und Infodemie? Debatten verunsichern: falsch. Gefühlsansteckung verunsichert: richtig. Wie geht das zusammen? Egal. Bla bla bla. Pseudowissenschaftlicher Kitsch. Die Devise unseres Bescheidwissers lautet: „Medienwissenschaftler sollten daran arbeiten, sich selbst überflüssig zu machen.“ Sie sind es schon. Jedenfalls in Gestalt solcher Common-sense-Schwätzer. Einige Medienwissenschaftler, die diesen Namen verdienen, machen sich durch eine „medienmündige Gesellschaft“ ebenso wenig überflüssig wie Mathematiker, wenn die Bürger ihre Restaurantrechnung überprüfen können. Die Nachricht von der eigenen Überflüssigkeit hat den Träumer nur noch nicht erreicht.
Zur Verkitschung des Alltags gehört auch die Behauptung, die Coronakrise habe Mitmenschlichkeit und Solidarität produziert. Wenn es sie denn überhaupt in nennenswertem Ausmaß gegeben hat, so waren sie nicht von langer Dauer. Die Kriminalität hat sich in Windeseile an die neuen Verhältnisse angepasst. Statt Taschendiebstahl – Telefon- und Internetbetrug. Und der Bruder der Kriminalität, das Kapital – eine Verwandtschaft, die Brecht in seiner Dreigroschenoper auf die gültige Formel gebracht hat –, benötigte keinen Monat, um herauszufinden, wie man aus der Not der Mitmenschen Profit schlagen und sich bereichern könne. Die Bundesregierung hat eine Vorlage formuliert, wonach Fluglinien, die einen bei der Buchung sofort bezahlten Flug annulliert, also die gekaufte Ware nicht geliefert haben, anstelle einer Erstattung der geleisteten Zahlung Gutscheine ausgeben dürfen. Im Klartext: sie dürfen die Kunden nötigen, ihnen einen zinsfreien Kredit, ein Zwangsdarlehen zu gewähren. Dass die gleichen Kunden ihre Brötchen bei Aldi mit einem Gutschein, einzulösen bis zum 31.12.2021, anstatt mit Bargeld bezahlen dürften, wurde bisher nicht verlautet.
Auch in der Politik triumphiert die Kriminalität. In Ungarn nützt Viktor Orbán, unterstützt von der Mehrheit der demokratisch gewählten Parlamentarier, die Krise zur endgültigen Errichtung eines autoritären Regimes. Er führt uns vor, dass es keines Putsches bedarf und keiner militärischen Aktionen, um eine Diktatur zu etablieren. Das sollte all jenen zu denken geben, die den Willen zur Demokratie für eine gesicherte Gegebenheit halten. „Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber.“ Das mag ja so sein, aber leider bilden diese Kälber manchmal eine Mehrheit. Das Coronavirus macht sie nicht klüger. Wo bleiben da die „guten Seiten“ der Krise? Die so reden, haben den Kitsch bis zur Verblödung internalisiert.
Apropos Verblödung: Als Nachtrag zu Wenn sich Euthanasie rechnet hier eine aktuelle Kolumne von Christian Ortner aus der von der Bundesregierung der Republik Österreich herausgegebenen Wiener Zeitung. Der auch auf der Achse des Guten präsente Autor liefert auch zur Coronakrise zuverlässig den vorhersehbar menschenfeindlichsten Kommentar. Ortner nennt das neoliberal, aber das ist für den Reaktionär vom Dienst aus der österreichischen Provinz offenbar dasselbe. Hier steht er. Er kann nicht anders. Amen.
|
Thomas Rothschild - 14. April 2020
2673
|
 Fake News
Fake News
|
Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte im Spiegel Bußgelder und Strafandrohungen gegen jene, die Fake News veröffentlichen. Es müsse verboten werden, öffentlich unwahre Behauptungen über die Versorgungslage der Bevölkerung, die medizinische Versorgung oder Ursache, Ansteckungswege, Diagnose und Therapie der Erkrankung COVID-19 zu verbreiten, denn die Lügen könnten Panik auslösen.
Die Polizei in Kaiserslautern ist schon vor dem Vorschlag von Pistorius tätig geworden. Ein junger Mann hatte eine Internetseite der Tagesschau nachgebaut und mit der Falschmeldung einer Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz versehen. Die Meldung hat er dann einem Freund gezeigt. Dieser wiederum hat die Fake News abfotografiert und über soziale Medien verbreitet. Gegen den Mann und seinen Freund wurde wegen Vortäuschens einer gemeinen Gefahr ein Strafverfahren eingeleitet.
So weit, so unfake.
Und wie verhält es sich mit der Falschmeldung, dass Beten gegen COVID-19 helfe?
Wie verhält es sich mit der vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in alle Haushalte übertragenen Fake News aus dem Stephansdom:
„Mit der Grablegung Jesu scheint alles zu Ende zu sein. Alle Hoffnung begraben. Doch noch einmal kommt es ganz anders. Frühmorgens finden die Frauen das Grab leer. Und bald begegnen sie ihm selber. Er lebt, nicht wie bisher, sondern in der neuen Wirklichkeit eines Lebens, das kein Tod mehr zerstören kann. Auch für uns kommt heuer alles anders. Corona ist aber nicht das Ende, auch wenn es eine schwere Prüfung ist. Auch uns führt Gott heuer durch diese lange Karwoche zum Ostermorgen!“
Diese Botschaft kommt nicht etwa als Glaubensbekenntnis daher mit dem gleichen Wahrheitsgehalt wie die Annahme, das Durchstechen einer Puppe mit Nadeln könne einen missliebigen Feind außer Gefecht setzen, sondern im Indikativ, als Tatsachenbehauptung. Sie kann zwar wohl keine Panik auslösen und täuscht auch keine gemeine Gefahr vor, aber auch eine tröstliche Fake News bleibt eine Fake News wie die Propagierung eines unwirksamen Medikaments. Ihr Status unterscheidet sich nur durch eine selbst in einer Welt von schwindenden Gläubigen größere Akzeptanz vom Glauben an den Osterhasen, der Eier versteckt. Fake News bleiben beide.
Dass derlei Einsicht bei ARD und ZDF zwischen den Gottesdiensten der diversen Religionen keinen Platz hat, ist inzwischen so selbstverständlich, dass es nicht auffällt.
|
Thomas Rothschild – 11. April 2020
2672
|
 Wenn sich Euthanasie rechnet
Wenn sich Euthanasie rechnet
|
Die Stuttgarter Zeitung titelt: In Straßburg lässt man die Alten sterben. Man mag sich fragen, ob solch eine Überschrift, bei aller Liebe zur Pressefreiheit, zielführend ist. Für die Alten in den nahe gelegenen deutschen Städten dürfte sie jedenfalls wenig beruhigend sein. Es könnte ihnen schon den Schlaf rauben, wenn sie überlegen müssen, wann sie an der Reihe sind.
In dem Artikel wird ein Papier von Mitarbeitern des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin in Tübingen zitiert. Darin wird berichtet: „Zudem würden über 80-jährige Patienten nicht mehr beatmet. Stattdessen erfolge ‚Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln‘.“ Verantwortlich für die Misere ist ein Mangel an Beatmungsgeräten. (Nebenbei: hat man alle Beatmungsgeräte beschlagnahmt, die in den Firmen, die sie herstellen, herumstehen?)
Man versetze sich in die Lage der Straßburger Ärzte, die darüber zu entscheiden haben, wer von den Infizierten beatmet werden soll und wer nicht. Eine Entscheidung über Leben und Tod. Sollen sie jüngere Patienten sterben lassen? Sollen sie auslosen, wer in den Genuss eines Beatmungsgeräts kommt? Wer darauf keine einleuchtende Antwort weiß, sollte sich seine wohlfeile Empörung für andere Anlässe aufbewahren.
Die engagierte Medizinjournalistin Renate Jäckle hat schon vor vielen Jahren auf einen Aufsatz in einem deutschen (!) Ärzteblatt hingewiesen, in dem empfohlen wurde, bei Patienten in Intensivstationen nachzurechnen, wie viel sie nach ihrer Genesung noch an Einkommen zu erwarten hätten. Wenn das weniger sei als ihre Behandlung koste, solle man alle lebensverlängernden Maßnahmen einstellen. Im Klartext: Euthanasie unter volkswirtschaftlichem Gesichtspunkt. Jäckles Aufdeckung hat nach meiner Erinnerung keine Zeitung erregt. Eine Schlagzeile des folgenden Wortlauts blieb aus: "In Deutschland lässt man die Armen sterben“.
Der Alltag fand schon vor dem Coronavirus statt. Die Straßburger Ärzte trifft keine Schuld.
|
Thomas Rothschild – 27. März 2020
2669
|
 Staatshilfe
Staatshilfe
|
Jetzt schreien auf einmal alle nach dem Staat. Der Staat soll aushelfen, wo das Coronavirus mit ungeahnter Schnelligkeit die Einkünfte zusammenbrechen lässt. Woher aber hat der Staat das Geld, von dem nun alle ihren Anteil haben wollen? Richtig: aus den Steuern. Da wäre es doch nur logisch und gerecht, wenn jene, die ständig gegen Steuern polemisieren und den Staat beschimpfen, wenn er diese eintreibt, jetzt auch keine staatliche Hilfe forderten und erst recht keine Steuergelder erhielten. Die Privatisierung der Gewinne und die Vergesellschaftung der Verluste – das ist ihr Rezept.
Diese Erfahrung gehört zum Alltag. Dennoch schimpft man vom Stammtisch bis zu den Kommentaren in den Zeitungen über zu hohe Steuern und nimmt es widerspruchslos hin, dass einem Waren und Leistungen zu schamlos überteuerten Preisen verkauft werden. Dennoch wird als Dogma verkündet, private Initiativen seien in jedem Fall effizienter als verstaatlichte Unternehmen, und als Verfassungsfeind diffamiert, wer – übrigens: in Übereinstimmung mit der Verfassung – die Möglichkeit von Verstaatlichung reflektiert, wer die Verantwortung für das Gemeinwohl höher veranschlagt als das Profitinteresse, wer Fürsorgepflicht als zumindest ebenso verbindlich betrachtet wie Loyalität, und wer sich gegen die Asymmetrie einer Ordnung ausspricht, die Gewinne eben privatisiert und Verluste vergesellschaftet. Wenn mal wieder die Risikobereitschaft von Unternehmern gepriesen wird, lasse man sich jenen Unternehmer zeigen, der nach dem Bankrott in ähnlich armseligen Verhältnissen lebt wie die Arbeitnehmer, die durch seine Schuld ihre Arbeit verloren haben, denen also der „Arbeitgeber“, im genauen Gegenteil zur irreführenden Terminologie, erst die Arbeit und dann den Arbeitsplatz genommen hat. Wohnen die Hochstapler, die für Millionenpleiten im öffentlichen Bereich, für die Fehlkalkulationen bei der Elbphilharmonie, beim Berliner Flughafen, von Stuttgart 21 verantwortlich sind, für die in der Tat der Steuerzahler aufkommen muss, jetzt unter der Brücke? Hat man ihren Perserteppich gepfändet?
Niemand gibt gern von seinem Bruttolohn oder -gehalt mehr ab, als nötig. Aber die eingezogenen Steuern werden immerhin in die Gesellschaft zurückgeführt. Dass sie sinnvoll verwendet werden, kann der Staatsbürger über Wahlen beeinflussen, und dass diese Einflussmöglichkeiten erweitert und demokratisiert werden, kann ein politisches Programm sein. Aber was Großunternehmen mit den Milliardengewinnen aus überteuerten Preisen und Gebühren machen, bleibt grundsätzlich außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Staatsbürger. Es gibt keinen hinreichenden Grund, diese überbezahlten Beträge stillschweigend als Preis der Marktwirtschaft hinzunehmen und dafür auf den Staat zu schimpfen. Wo bleibt der Aufschrei, wenn Banken, die jeden kleinen Lohnempfänger, der sein Konto überzieht, kräftig zur Kasse bitten, Großkunden, wenn die sich, nach jahrelangen Profiten, gründlich verrechnet haben, die Schulden erlassen (oder anders ausgedrückt: ihnen großzügig schenken, was der kleine Sparer und Kreditnehmer eingezahlt hat)?
Es entspricht dieser Logik, dass es als wesentlich verzeihlicher gilt, Steuern zu hinterziehen, also die Allgemeinheit zu bestehlen, als im Kaufhaus zu klauen, also Aktionäre zu schädigen. Im übrigen holt sich das Kaufhaus jede gestohlene Krawatte, das Hotel jedes gestohlene Handtuch wieder zurück über die überhöhten Preise, die wiederum der ehrliche „kleine Mann“ blechen muss, der weder geklaut noch Steuern hinterzogen hat.
Es gibt viele Gründe, kritisch, ja ablehnend zu reagieren auf staatliche Missstände, auf die Bürokratie, auf die Selbstherrlichkeit der Politiker. Aber der mittlerweile durchgesetzte kapitalistische Konsens, dass es der Staat, nicht das Kapital sei, von dem der Bürger geschröpft werde, ist gefährlich, weil eminent antidemokratisch. Allen Totalitarismustheorien zum Trotz: der Nationalsozialismus, der zwar nationalistisch, aber nichts weniger als sozialistisch war, hat mit größter Eile die Parlamente, nicht das Kapital entmachtet. Die Polemik gegen zu hohe Steuern und die Bestärkung von antistaatlichen und antiparlamentarischen Ressentiments gehört zum stets wirkungsvollen Repertoire der Populisten. Gerne hörte man von ihnen, wer ihrer Meinung nach Schulen und Kindergärten, Krankenhäuser und Theater, meinetwegen auch Autobahnen und Vollzugsanstalten bezahlen soll. Die Telekom? Lufthansa? Daimler?
Klar ist die Unverfrorenheit skandalös, mit der sich Parlamentarier regelmäßig die Diäten erhöhen, die der Steuerzahler, dessen Realeinkommen sinkt, finanzieren muss. Aber wer protestiert gegen die ebenfalls vom Konsumenten bezahlten Gehälter, die sich Generaldirektoren bewilligen und im Vergleich zu denen Abgeordnetengehälter ein Klacks sind?
Die Privatisierung der Gewinne und die Vergesellschaftung der Verluste – diese Regel sollte sich der Staat nicht zueigen machen.
Staatshilfe: ja. Aber zuerst für die Kleinen, für die Selbständigen, die Künstler, die mittelständischen Betriebe, deren Existenz in der Tat gefährdet ist. Bei den Großunternehmen und Konzernen aber, die jetzt riesige Verluste melden, sollte man genau überprüfen, wie hoch die Gewinne waren, die sie in ihrer Steuererklärung angegeben haben. Sie sollten nicht auch noch für die entgangenen Einnahmen ersetzt bekommen, was sie dem Staat zuvor unterschlagen haben. Denn die Kassen des Staats wieder auffüllen müssen die vielen kleinen Arbeitnehmer, die ihre Steuern brav und widerspruchslos bezahlen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig.
|
Thomas Rothschild – 18. März 2020
2666
|
 Corona-Notizen
Corona-Notizen
|
1. Es gibt viele Gründe, an Politikern, ihrer Qualifikation und ihren Entscheidungen zu zweifeln. In der gegenwärtigen Situation aber, die durch das Coronavirus entstanden ist, sind sie nicht zu beneiden. Was immer sie tun – sie können es nur falsch machen. Wenn sie Maßnahmen treffen, die mit Einschränkungen verbunden sind, wirft man ihnen diktatorische Ambitionen vor. Wenn sie darauf verzichten, macht man sie für die Folgen verantwortlich, die sich durch solche Maßnahmen hätten vermeiden lassen.
2. Mit einer Bedrohung der Demokratie haben Einschränkungen der Bewegungs- und Reisefreiheit unter den gegebenen Umständen nichts zu tun. Es gibt kein demokratisches Recht auf Gefährdung von Menschenleben oder auch nur der Gesundheit anderer Menschen. Wenn auch nur ein Leben dadurch gerettet wird, dass die Bevölkerung für eine bestimmte Frist daheim bleibt, dann ist es richtig und demokratisch, dies zu verordnen. Die National Rifle Association of America hält es für ein demokratisches Grundrecht, Waffen zu besitzen, auch wenn das nachweislich zu zahlreichen Tötungen führt. Wir sind klüger. Sind wir es auch, wenn es um die Reisefreiheit geht?
3. Zur Erinnerung: Das Coronavirus ist Natur, der Impfstoff, an dem man jetzt mit Druck arbeitet, Antinatur.
4. Zugegeben: es ist unerfreulich, wenn man auf Theater-, Kino- oder Kneipenbesuche verzichten muss. Es ist unbequem, wenn man etwas länger suchen muss, um in einem Supermarkt Klopapier zu finden. Aber das lautstarke Gejammere beweist nur, wie wenig Fantasie die meisten für die Lebensumstände in ferneren Regionen aufgewandt haben. Verglichen mit der Situation derer, die die Straße nicht ohne das Risiko überqueren können, von einem Scharfschützen erschossen zu werden, oder die täglich und nächtlich mit der Möglichkeit rechnen müssen, von marodierenden Banden überfallen, gefoltert und getötet zu werden, ist die Lage im Zeichen des Coronavirus mehr als nur erträglich. Wo der Ausfall eines Fußballspiels als tragischer empfunden wird als die unterlassene Rettung von Menschenleben, und sei es nur ein einziges, ist Hopfen und Malz verloren.
5. Bei allen Unterschieden, ja Gegensätzen, haben Sozialisten und religiöse Menschen vom Anspruch her eins gemeinsam: Menschenleben haben für sie vor Gelderwerb und finanziellem Wohlstand oberste Priorität. Wenn man die Kommentare zur Corona-Krise liest, könnte man zu dem Schluss kommen, dass das in Vergessenheit geraten ist. Wirtschaftliche Einbußen bereiten vielen offenbar ein größeres Kopfzerbrechen als die bedingungslose Bewahrung von Menschenleben. Angesichts des Feilschens etwa um Impfstoffe muss man überprüfen, ob der Kapitalismus wirklich das beste aller Systeme ist, wie manche behaupten.
6. Katastrophen sind in der Menschheitsgeschichte immer wieder aufgetreten. Anders aber als bei Kriegen oder Attentaten, anders als bei Tschernobyl, anders sogar als bei Hochwasser, das sich unverantwortbaren Flussregulierungen verdankt, oder bei Waldbränden, die auf das Konto von exzessiven Rodungen gehen, anders als bei den Klima-Folgen einer auf Profit ausgerichteten Wirtschafts- und Umweltpolitik, verbietet sich bei Seuchen und Epidemien eine Schuldzuweisung. Das erzeugt einerseits das Gefühl der Hilflosigkeit. Wo kein Schuldiger zu benennen ist, fällt eine bekämpfbare Ursache weg. Religiöse Fanatiker nehmen, wie im Fall der Sintflut, die Menschheit und ihre Sünden in Haftung. Für aufgeklärte Menschen ist das keine Option. Die gute Seite dieses Umstands ist, dass Epidemien eher nicht zur Entsolidarisierung führen, dass sie es Demagogen erschweren, sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Jedenfalls in unserer Gegenwart hat sich noch keine nennenswerte Gruppe angeschickt, die „Brunnenvergifter“-Legende aufleben zu lassen.
7. In der Schule und in den Medien haben wir von den großen Epidemien gehört, von der Pest, der Cholera, dem Ebolafieber. Aber sie blieben stets abstrakt, zeitlich oder räumlich weit entfernt. Das Coronavirus, wenngleich (noch) nicht so gefährlich wie die genannten Krankheiten, vermittelt uns eine sinnliche Erfahrung über die Ängste und die Sorgen der Menschen, die mit diesen Epidemien leben mussten. So gesehen ist, was wir zurzeit durchlaufen, ein Stück anschaulichen Geschichtsunterrichts. Das ist zwar kein Trost, aber man könnte daraus immerhin mehr lernen als in der Schule.
8. Alle Verlautbarungen zum Coronavirus weisen darauf hin, dass ältere Menschen besonders gefährdet seien und die Wahrscheinlichkeit eines schweren oder gar tödlichen Verlaufs bei ihnen signifikant höher sei als bei jungen Menschen. Man sollte sich aber nicht verrückt machen lassen. Bagatellisierung der Krankheit ist eine Sache. Eine realistische Einschätzung eine andere. Ältere Menschen haben auch ohne Coronavirus eine höhere Chance zu sterben als junge. Immer noch ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs oder Herzversagen zu sterben, um ein Vielfaches höher als der Tod durch das Coronavirus. Selbst in Verkehrsunfällen – und die ließen sich vermeiden – sterben mehr Menschen als bislang am Coronavirus. Bis zum 16. März gab es in Deutschland 13 Todesfälle wegen des Coronavirus. Die Grippewelle 2017/18 hat in Deutschland 25.100 Menschen das Leben gekostet. Diese Dimensionen sollte man sich vor Augen halten, ehe man in Alarmstimmung verfällt. Wer weiß: vielleicht macht die Angst mehr Menschen krank als das Virus.
9. Wofür ich plädiere, ist nicht die Verharmlosung des Coronavirus. Es erscheint mir nur wenig produktiv, wenn man sich angesichts vergleichsweise geringer Wahrscheinlichkeiten in lähmende Ängste hinein suggerieren und damit von jenen Tätigkeiten ablenken lässt, die allerdings von größter Dringlichkeit wären: nämlich einerseits der politische Kampf für die Zukunft, andererseits die Beachtung von gegenwärtigen Katastrophen, die kaum je in unser Gesichtsfeld geraten. Was in unserem Eurozentrismus vergessen wird, ist die Tatsache, dass die Dritte Welt die Katastrophe nicht erst zu imaginieren braucht: für sie ist sie ständige gegenwärtige Realität. Wem es nicht nur darum geht, sich narzisstisch in seinen Ängsten zu baden, sondern Katastrophen tatsächlich zu beseitigen, der muss verstärkt für einen Ausgleich zwischen den hochentwickelten Industriestaaten und der Dritten Welt kämpfen. Das bedeutet konkret: eine radikale Senkung des Lebensstandards in Europa und Nordamerika zugunsten von Afrika, Lateinamerika und Teilen Asiens. Dieser Eingriff wird und muss unser Leben stärker verändern als das Coronavirus, aber wir müssen ihn vornehmen. Die Alternative ist eine Fortdauer der permanenten Katastrophe in der Dritten Welt, die ständig weit mehr Opfer fordert als das Virus, die Alternative ist die Wiederholung der Fehler Europas und Nordamerikas in der Dritten Welt, die ohne Hilfe von außen gar nicht auf Industrialisierung und wohl auch Kernkraft verzichten kann, die Alternative ist schließlich ein Blutbad, mit dem Europa und Nordamerika eines Tages ihre historische Schuld zu begleichen haben werden. Eine militante Antwort der Mehrheit der Weltbevölkerung auf ihre Jahrhunderte währende Unterdrückung und Ausbeutung erscheint mir jedenfalls wesentlich wahrscheinlicher als die Dezimierung durch ein Virus, und wir werden uns nicht einmal beklagen dürfen. Schon aus Egoismus hätten wir die ständig vorhandene Katastrophe in der Dritten Welt zu bekämpfen.
10. Aber auch unsere hausgemachten Probleme erfordern eine andere Reaktion, als das ständige ängstliche Starren auf die Möglichkeit eines Massensterbens durch das Coronavirus. Wahrscheinlicher und vielleicht schrecklicher als der kollektive Tod erscheint mir die Möglichkeit eines Lebens, das nicht mehr lebenswert ist. Gerade die verbreiteten und geförderten individuellen Ängste aber erleichtern jenen, die unsere ohnedies wenig stabile Demokratie abbauen wollen, die Arbeit.
|
Thomas Rothschild – 17. März 2020
2665
|
 Sieg der Vernunft
Sieg der Vernunft
|
Kongress der Hellseher. Drei Tage Vorträge und Diskussionen. Am Schluss sagt der Präsident: „Und nun bitte ich Sie um eine kleine Spende für schlechtere Zeiten. Man weiß ja nie, was kommt.“
Der Landesbischof Frank Otfried July von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hat die Gemeinden aufgefordert: „Angesichts der dynamischen Entwicklung und zunehmender Veranstaltungsverbote in Kommunen und Landkreisen aufgrund der Corona-Krise empfehlen wir dringend, ab sofort und bis auf weiteres auf Gottesdienste zu verzichten.“
Man ist geneigt, diese Entscheidung als Sieg der Vernunft über das Gottvertrauen zu werten. Jedenfalls sollte man darüber keine Witze reißen. Eins aber darf man erwarten: dass die Kirchen, möglicherweise sogar die katholische, künftig Phrasen unterlassen, die Verantwortung an Gott delegieren, statt auf die Einsicht der Menschen zu bauen, wie „Der HERR hat's gegeben, der HERR hat's genommen“ oder „Gesegnet ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist“.
Als Martin Luther 1527, nicht zum ersten Mal, von einer Pest-Epidemie bedroht war, erwog er, ob er, wie viele andere, flüchten sollte, kam jedoch, wie er in einem Brief an Georg Spalatin schrieb, zu dem Schluss: „Christus aber ist da, damit wir nicht allein sind. Er wird auch in uns triumphieren über die alte Schlange, den Mörder und Urheber der Sünde, wie sehr er auch immer seine Ferse stechen mag (1. Mose 3, 15). Betet für uns und gehabt Euch wohl.“
Heute gebietet es die Vernunft, eher Ratgebern wie Frank Otfried July zu folgen als Luther, und lieber auf den Gottesdienst zu verzichten als auf die Macht des Gebets zu vertrauen. Es kann nicht schaden, wenn man sich an diese Erfahrung erinnert, nachdem das Virus besiegt wurde. Es könnte ja zurückkehren. Und es muss nicht Corona heißen.
|
Thomas Rothschild - 15. März 2020
2664
|
 Lob der Demokratie
Lob der Demokratie
|
In einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 28. Februar 2020 erklärte Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München, warum die Streichung Paul von Hindenburgs aus der Berliner Ehrenbürgerliste ein demokratischer Akt sei. Nichts, was sie über Hindenburg zu sagen wusste, ist neu. Wenn also eine Selbstverständlichkeit als Sieg der Demokratie gefeiert werden soll, muss man sich fragen, wie es in den fast 75 Jahren um die Demokratie bestellt war, in denen Hindenburg Ehrenbürger (nicht nur) Berlins und Namensgeber zahlloser deutscher Straßen und Städte geblieben ist. Die Bundesrepublik Deutschland (alt) und ihre Parteien müssen sich fragen lassen, was sie bewogen hat, so lange an der Ehrung jenes Mannes festzuhalten, der Hitler zur Macht verholfen hat.
75 Jahre lang also wurden Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht mit einem positiven Bild jenes Mannes ausgestattet, der die Demokratie nicht etwa gefördert, sondern abgeschafft hat. 75 Jahre lang wurden sie angehalten, ihn als den Mann zu achten, den die Stadt Berlin und unzählige öffentliche Einrichtungen ehren. Man hat seit 1990 viel Mühe darauf verwandt, das Geschichtsbild anzuklagen und zu korrigieren, das in der DDR vermittelt wurde. Eine Korrektur der Einschätzung von Hindenburg blieb die Angelegenheit einiger weniger echter Demokraten, die dafür beschimpft und diskreditiert wurden. Was, wenn nicht dies, beweist, in welcher Tradition sich die Bundesrepublik Deutschland gesehen hat und für viele nach wie vor sieht? Im Spiegel – wo sonst? – schrieb ein Hubertus Knabe vor 14 Jahren: „Es stimmt etwas nicht in Deutschland, wenn wir im siebzehnten Jahr der Einheit noch immer in jedem Dorf die kommunistische Diktatur verherrlichen, die Opfer und den Widerstand jedoch vergessen.“ Dass man in Deutschland nicht nur in jedem Dorf, sondern auch in der Hauptstadt im fünfundsiebzigsten Jahr der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime dessen Steigbügelhalter verherrlicht, die meisten Opfer und den Widerstand jedoch vergessen hat, irritiert ihn nicht. In Deutschland gibt es mehr als 400 Hindenburgstraßen und -plätze. 32 Straßen und 2 Plätze sind nach Erich Mühsam benannt, der im KZ Oranienburg ermordet wurde. So viel zur Demokratie, die ihre Bewährungsprobe bestanden hat, indem sie Paul von Hindenburg die Berliner Ehrenbürgerwürde aberkannte. Im Jahr des Herren 2020.
|
Thomas Rothschild - 28. Februar 2020
2661
|
 Wien-Schwechat
Wien-Schwechat
|
Würden Sie einem Flugunternehmen vertrauen, das die elementarsten mathematischen Regeln nicht kennt? Schon auf dem Weg zum Flughafen Wien-Schwechat und im Flughafengebäude selbst prahlen riesige Anzeigetafeln mit einer angeblichen Errungenschaft: „CO2 um 70%* reduziert“. Und eine Fußnote erläutert, was der Asterisk bedeutet: „*pro Passagier“. Das ist natürlich Nonsens. Denn wenn der Kohlenstoffoxyd-Ausstoß des Flughafens um 70 Prozent reduziert wurde, dann wurde er auch pro Passagier um 70 Prozent reduziert und umgekehrt. Was für absolute Beträge gilt, gilt nicht für Prozentzahlen. Eine Käsesorte, die 20 Gramm leichter ist als eine andere, ist das pro Menge, die angegeben werden muss, also zum Beispiel pro Packung. Eine Käsesorte aber, die um 20 Prozent weniger Fett enthält als eine andere, ist immer, in der Einzelpackung und in ihrer Gesamtheit 20 Prozent fettärmer.
Sollte sie jedenfalls sein. Beim Flughafen Wien-Schwechat kann man sich nicht so sicher sein. Der hält es mit der Ehrlichkeit nicht so genau. Wer dort ankommt, wird penetrant mit dem Hinweis bombardiert, dass er mit dem CAT, dem City Airport Train, vom Flughafen ins Stadtzentrum fahren solle. Dieser Transfer kostet 11 Euro, hin und zurück 19 Euro. Was verschwiegen wird, ist dies: Die S-Bahn S7 fährt ebenso oft wie der CAT, nämlich alle halben Stunden, vom Flughafen nach Wien Mitte. Sie benötigt für die Strecke 23 Minuten, sieben Minuten mehr als der CAT, und kostet, wie auch der Railjet zum Hauptbahnhof, gerade 4,20 Euro. Mehr noch: mit diesem Ticket kann man, anders als mit dem Ticket des CAT, zu jedem beliebigen Punkt im Wiener Stadtgebiet weiterfahren.
All das soll der Gast nicht erfahren. Um ihn irrezuführen, locken die Wegweiser auch in Wien Mitte mit dem CAT-Zeichen, das dem Flughafenzeichen zum Verwechseln ähnelt, auf die falsche, nämlich die Abzocker-Fährte. Wer nicht ortskundig ist, kommt nicht auf die Idee, dass er die S-Bahn Richtung Meidling – und nicht Floridsdorf – nehmen muss. Der Flughafen als Fahrtziel ist so versteckt, dass man ihn nicht finden kann.
So ist das, wo 80%* mehr vom Tarockieren verstehen als von Verkehrsplanung. *jedes zuständigen Beamten.
|
Thomas Rothschild - 26. Februar 2020
2660
|
 Gute Nachrichten
Gute Nachrichten
|
Man muss kein unverbesserlicher Pessimist sein, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass die schlechten Nachrichten gegenüber den guten überwiegen. Es macht uns keine besondere Freude, sie zu verbreiten. Aber die Schuldigkeit gegenüber der Wahrheit zwingt uns dazu. „Auch der Haß gegen die Niedrigkeit/ Verzerrt die Züge./ Auch der Zorn über das Unrecht/ Macht die Stimme heiser. Ach, wir/ Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit/ Konnten selber nicht freundlich sein.“ (Bertolt Brecht)
Umso beglückender, wenn es Erfreuliches zu berichten gibt. Wir haben Anlass, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das uns so viel Missvergnügen und Ärger bereitet, zu loben. Selten hat es so viel Rückgrat, so viel Entschiedenheit bewiesen wie in der Reaktion auf die Vorgänge in Thüringen. Fast ausnahmslos haben die Moderatoren der Nachrichtensendungen, der Magazine und der Talkshows zu erkennen gegeben, dass eine Kungelei mit der AfD, wie man heute sagt, „gar nicht geht“. Sie haben erkannt, dass das Prinzip der Ausgewogenheit seine Grenzen hat. Jean-Luc Godard hat dieses Prinzip einmal so kommentiert: „Die Objektivität? Das ist fünf Minuten für Hitler und fünf Minuten für die Juden.“ Wohl wahr. Auch in der Weimarer Republik gab es Aufrechte, die sich verhalten haben wie heute die Redakteure und Sprecher von ARD und ZDF. Sie konnten Hitler nicht aufhalten, und so manche, so mancher von ihnen ist bald nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten „umgefallen“. Wir wollen den Pessimisten in uns beurlauben und hoffen, dass es diesmal so nicht sein wird.
Die zweite gute Nachricht kommt ausgerechnet aus der Türkei. Ein Gericht in Istanbul hat Aslı Erdoğan vom Vorwurf des Terrorismus freigesprochen. Die Schriftstellerin, die seit zweieinhalb Jahren im deutschen Exil lebt, sah sich nach ihrer Verhaftung im August 2016 mit der staatsanwaltlichen Forderung einer Haftstrafe von insgesamt neun Jahren und vier Monaten konfrontiert. Jetzt wurde die Anklage wegen „Mitgliedschaft bei einer illegalen Organisation“ und „Volksverhetzung“ fallen gelassen. Es gibt also noch unabhängige Richter in der Türkei. Auch in diesem Fall ist es für Jubel zu früh. Die Türkei bleibt erst einmal, was findige Politiker bezüglich der DDR aus dem Munde von Bodo Ramelow hören wollen: ein Unrechtsstaat. Was Deutschland nicht daran hindert, der wichtigste Handelspartner der Türkei zu sein. Aber heute freuen wir uns mit und für Aslı Erdoğan. Heute freuen wir uns, dass wir gute Nachrichten verbreiten dürfen.
|
Thomas Rothschild - 14. Februar 2020 (3)
2659
|
 Vom Wert der Gesten
Vom Wert der Gesten
|
Diverse Kommentatoren haben der Vorsitzenden der Linksfraktion im Thüringer Landtag Susanne Hennig-Wellsow Vorhaltungen gemacht, weil sie dem eben mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählten Kandidaten der FDP Thomas Kemmerich die Blumen vor die Füße geworfen hat. Es war eine Geste, nicht mehr und nicht weniger. Gesten ändern nicht viel, aber sie können eine symbolische Kraft entwickeln. Man denke an den Kniefall Willy Brandts am Ehrenmahl für die Toten des Warschauer Ghettos. So gesehen verdient Hennig-Wellsows Geste eher Bewunderung als Vorwürfe. Sie war ein Lichtblick der Aufrichtigkeit in der Politik.
Kann man es anders denn als Heuchelei bezeichnen, wenn Politiker jemandem mit oder ohne Blumenstrauß zu einer Wahl gratulieren, die die Bundeskanzlerin kurz darauf „unverzeihlich“ nennt und die Parteien der Gratulanten als großen Fehler bezeichnen? Was sollen die Wähler, nicht nur in Thüringen, von Parlamentariern halten, die vorgeben, bestimmte Ziele zu verfolgen, und auf Fotos in besoffener Eintracht mit jenen zu sehen sind, die genau diese Ziele bekämpfen? Machen die Gesten nicht sämtliche Worte und Versicherungen unglaubwürdig? Sind die Blumensträuße und die Umarmungen Ausdruck demokratischer Toleranz, oder zeigen sie nicht vielmehr der Bevölkerung die lange Nase: Ist doch alles nicht so gemeint, ist bloß ein Spiel, für das wir satte Tantiemen beziehen. Tags fürs Fernsehen: verbale Schlachten im Plenarsaal. Abends in der Kantine: Kumpanei beim Fassbier. Kemmerich mag mit den Stimmen von Faschisten gewählt worden sein – wir gratulieren.
„Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft“ dichtete einst Kurt Tucholsky. Die Geschichte wiederholt sich nicht? So?
|
Thomas Rothschild - 11. Februar 2020
2658
|
 Brexit
Brexit
|
Selten war die ideologische Aufladung der veröffentlichten Meinung so deutlich erkennbar wie in diesen Tagen. Die Medien berichten über den Austritt Großbritanniens aus der EU, als hätte ein Politbüro die Marschrichtung vorgegeben. Wir sind angehalten, den Brexit für eine Tragödie zu halten, die uns zumindest so berühren müsse wie der Tod eines oder einer nahen Verwandten. Dass immerhin eine, wenn auch knappe Mehrheit der Briten diesen Austritt ihres Landes aus der EU wollte, kümmert niemand. Die Bekenntnisse zu demokratischen Spielregeln erweisen sich als Lippenbekenntnisse. Und wer genau hinhört, erfährt auch, wessen Interessen diese Stimmungsmache dient: jenen der Wirtschaftsunternehmen, die von den Abmachungen der EU profitieren.
Die Wahrheit ist doch: Die (west)europäischen Staaten haben auch vor der Gründung der EU, deren Vorläufer unmissverständlich EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hieß, recht gut zusammengelebt. Dass das Vereinigte Königreich jetzt einen Krieg gegen Deutschland oder Frankreich beginnen werde, scheint wenig wahrscheinlich. Touristen haben es auch vor fünfzig Jahren nicht für ein unzumutbares Malheur gehalten, dass sie an der Grenze genauer kontrolliert wurden als in den Jahren der britischen EU-Mitgliedschaft, ohne Schengener Abkommen übrigens. Und auch jene europäischen und außereuropäischen Staaten, die nicht zur EU gehören, sind uns ja nicht unzugänglich oder gar feindselig gesinnt. Eine Reise in die Ukraine oder nach Kanada ist nicht wirklich umständlicher als eine Reise nach Frankreich oder, noch, nach England.
Die Wahrheit ist: Die Medien fürchten, dass das britische Beispiel Schule machen könnte. Denn die Geschichte hat genügend Beispiele dafür vorzuweisen, dass auch scheinbar stabile Staaten und Staatenbünde zerfallen können. Wenn in den aktuellen Nachrichten unisono von einem „historischen Tag“ die Rede ist, muss daran erinnert werden: Der Zerfall des Habsburger-Imperiums, der Sowjetunion, Jugoslawiens waren allesamt weit eher historische Ereignisse als der Austritt Großbritanniens aus der EU. Wir haben sie überlebt. Auch die EU muss nicht für alle Ewigkeit geschaffen sein. Das Politbüro könnte sich irren. Bis sich das herumgesprochen hat, werden die Medien stramm die Order befolgen. So ist das in der freien Welt.
|
Thomas Rothschild - 1. Februar 2020
2657
|
 Der edle Ritter
Der edle Ritter
|
Es vergeht keine Woche, in der nicht ein neuer Hinweis darauf an die Öffentlichkeit gelangte, dass S21 [Stuttgart 21, lt. Wikipedia das "Verkehrs- und Städtebauprojekt zur Neuordnung des Eisenbahnknotens Stuttgart"] eine kriminelle, von Anfang an mit Lügen und Betrug eingeleitete Aktion ist, deren von der Allgemeinheit zu bezahlende Kosten die schlimmsten Befürchtungen seiner Kritiker bei weitem übersteigt. Cem Özdemir, der einst zu den Kritikern gehört hat, qualifiziert sich nach dem Vorbild des baden-württembergischen Ministerpräsidenten für höhere Ämter, indem er Resignation als politische Vernunft ausgibt. In einem Untersuchungsausschuss, dessen Vorsitzender er war, erklärte er: „Jetz' isch die Katz dr Baum nauf.“
Wenn's nur die Katzen und die Bäume wären. Der edle Ritter Özdemir forderte auch von den S21-Befürwortern eine Entschuldigung: „Es würde den Projekttreibern von damals gut zu Gesicht stehen, wenn von ihnen jetzt ein 'mea culpa' käme.“ Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ladendiebe, haltet euch an Özdemir. Wenn ihr erwischt werdet, entschuldigt euch. Das stünde euch gut zu Gesicht. Die gestohlene Ware könnt ihr behalten. Özdemirs Parteifreund Winfried Hermann ergänzte: „Wir geben einen Haufen Geld aus und versenken einen Bahnhof und haben dadurch keinen Vorteil.“ Er hat vergessen, zu erwähnen, wer „wir“ ist, nämlich der Steuerzahler, also ich und du. Die Forderung, die Politiker mit mehr Sinn für Gerechtigkeit als für die Satisfaktionsfähigkeit von Betrügern erheben müssten, lautet: Pfändet die Verantwortlichen und lasst ihnen gerade so viel, wie der Ärmste unter diesen Steuerzahlern besitzt. Wenn sie ihre BMWs und ihre Villen behalten dürfen, erkläre man dem Ladendieb, warum er, „mea culpa“ hin oder her, die geklaute Zahnpaste zurückgeben muss. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Außer den Katzen auf dem Baum.
Winfried Kretschmann, der Lehnsherr des edlen Ritters, hat Cem Özdemir als möglichen Kanzlerkandidat der Grünen ins Gespräch gebracht. Das sollte nicht überraschen. Özdemir passt exakt in eine politische Landschaft, in der sein österreichischer Kollege eine Regierungskoalition eingeht mit jenem weit rechts stehenden Bundeskanzler, der eben noch schwadroniert hat, wie gut er mit der FPÖ und deren Ex-Chef Strache, der nicht weniger kriminell ist als S21, was aber niemanden zu scheren scheint, zusammengearbeitet hat. Gibt es noch irgendetwas, was die Grünen von der Versuchung, an der Macht Anteil zu haben, zurückhalten könnte? Gibt es noch irgendeinen Grundsatz, den preiszugeben sie sich weigern würden? Na ja, vielleicht so lange die Katze noch nicht auf dem Baum ist.
|
Thomas Rothschild - 6. Januar 2020
2653
|
 Anerkannt
Anerkannt
|
Lautstark haben Politiker und ihre Gefolgschaft einer bestimmten Couleur gefordert, dass Asylsuchende Deutschkurse zu besuchen und eine Prüfung ihrer Sprachkenntnisse zu bestehen hätten. Vielleicht wäre es sinnvoll, solch eine Prüfung erst einmal für deutsche Journalisten einzuführen. Der Deutschlandfunk meldete am 18. Dezember: „Die Verleihung des Sacharow-Preises an den chinesisch-uigurischen Regierungskritiker Ilham Tohti sei ein starkes Zeichen, dass die Menschenrechtsverletzungen anerkannt würden.“
Deutschland hat Kroatien 1992 (als unabhängigen Staat) anerkannt, die DDR hingegen wurde zunächst von vielen Staaten nicht anerkannt. Aber Menschenrechtsverletzungen? Wir wissen schon, was gemeint ist: nämlich dass die Repressionen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren durch China als Menschenrechtsverletzung anerkannt würde. Warum sagt man es dann nicht so? Dass die Frage von juristischer und politischer Bedeutung ist, erkennt man an den Debatten über die „Anerkennung“ des Begriffs „Genozid“ für diverse historische oder auch künftige Massentötungen. Die Sprach- und Sinnverletzungen durch den von Medienkritikern anerkannten Deutschlandfunk sollten nicht anerkannt werden. Dass man sie als solche kennzeichnet, verdiente Anerkennung.
|
Thomas Rothschild - 18. Dezember 2019
2652
|
 Achtung Schwule
Achtung Schwule
|
Im Prospekt einer kalifornischen Kleinstadt inserieren 62 Hotels. Bildzeichen geben Auskunft über deren Ausstattung. 13 Hotels führen das Symbol an, das „gay clientele“ signalisiert.
Was soll das nun besagen? Dass Schwule geduldet werden? (Und in den Hotels ohne dieses Symbol somit nicht?) Dass Schwule bevorzugt werden? Dass das Haus meiden soll, wer es nicht mit der „gay clientele“ teilen möchte?
Was hier als emanzipatorischer Fortschritt daherkommt, ist in Wahrheit eine zeitgenössische Form der Diskriminierung. Kein Hotel dieser Stadt würde es wagen, zu betonen, dass es farbige Kundschaft beherberge. Zu deutlich würde dies die Normalität des Rassismus kennzeichnen. Warum eigentlich gibt es kein Piktogramm für „heterosexual clientele“? Ja warum wohl.
|
Thomas Rothschild - 4. Dezember 2019
2649
|
 Im Auge des Betrachters
Im Auge des Betrachters
|
Wenn jemand die Ansicht äußert, dass die Hungernden aus der Dritten Welt nach Europa kommen werden, um sich zu holen, was ihnen seit Jahrhunderten vorenthalten wird, und dass das nicht ohne Gewalt abgehen wird – sagt er dann, dass man diese Menschen bekämpfen, sie gar ausrotten muss? Wenn jemand behauptet, Intelligenz sei nicht nur durch das Milieu, sondern auch durch die Geburt determiniert, sie sei nicht allein ein soziales, sondern auch ein genetisches Produkt – sagt er dann, Begabte müssten belohnt und gefördert werden? Nichts dergleichen sagt er. Aber es wird ihm von rechtschaffenen Kritikern unterstellt. Man verdächtigt mit jenen, die dazu Anlass geben, gleich auch die Unschuldigen mit. Wer vor der voraussehbaren Gewalt angesichts der globalen Ungerechtigkeit warnt, könnte ja ebenso gut dazu auffordern wollen, den Unterprivilegierten zu helfen, um der Gewalt zuvorzukommen. Wer die Ungleichheit der Erbanlagen betont, könnte ja wünschen, dass man gerade jenen, die von Geburt aus benachteiligt sind, ausgleichende Unterstützung gewährt. Zu einer Zeit, als dafür mehr Sensibilität vorhanden war, nannte man das „kompensatorische Erziehung“.
Wenn den Prognostikern einer bevorstehenden Völkerwanderung reflexartig die Befürwortung von Abwehrgewalt, wenn den Vertretern der Ansicht, die Gene seien mächtiger, als gemeinhin angenommen, bedingungslos Sozialdarwinismus angelastet wird, dann liegt das nicht an deren Äußerungen, sondern im Auge des Betrachters. Er projiziert seine Befürchtungen, die durchaus ihre Gründe haben, in sein Gegenüber und vernimmt Schlussfolgerungen, die nicht notwendig impliziert sind.
Ideologieverdacht ist berechtigt und notwendig. Aber man sollte schon genau hinhören und, ehe man Böses vermutet, nachfragen, wenn jemand eine These oder eine Diagnose aufstellt. Was ergibt sich daraus? „Wie handelt man/ Wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Vor allem: Wie handelt man?“, heißt es im Gedicht Der Zweifler von Bertolt Brecht.
|
Thomas Rothschild - 19. November 2019 (2)
2647
|
 Klimakrise
Klimakrise
|
Alle reden von der Klimakrise. Das Wort führt in die Irre. Eine Krise geht vorüber. Sie kann überwunden werden oder wird, jedenfalls nach Ansicht einflussreicher Theoretiker, automatisch abgelöst von einem Aufschwung und einer neuen Konjunktur. Das Klima auf unserer Erde aber befindet sich nicht in einer vorübergehenden Krise, sondern in einem irreversiblen Prozess. Die Katastrophe ist bereits eingetreten, und sie kann allenfalls gebremst werden. Für eine Krise ist das zu wenig.
Genau das will das Wort „Klimakrise“ verschleiern. Es sind insbesondere die Politiker, die diese Verschleierung betreiben. Indem sie tun, als handle es sich bei der Erderwärmung, beim Abschmelzen der Gletscher, beim Anstieg des Meeresspiegels, beim Aussterben von Tierarten, bei der Austrocknung von Landstrichen, bei der Zunahme von Unwetterkatastrophen, Hochwasser, Waldbränden und Orkanen um eine überwindbare Krise, bieten sie sich selbst als Retter in der Not an. Was sie Klimakrise nennen statt korrekt Klimakatastrophe, dient ihnen lediglich zur Wahlwerbung. Wer ihnen mit seiner Stimme Macht verleiht, soll sich in der Illusion wiegen, er hätte das Ende der Krise beschleunigt.
Die Propheten der „Klimakrise“ fügen daher stets an, was „wir“ tun müssen, um sie zu beenden. Was sie verschweigen, ist der wahre Grund für die Verhinderung längst fälliger Gegenmaßnahmen: dass es nämlich mächtige Institutionen gibt, deren Interessen den erforderlichen Schritten entgegenstehen. Was man heute Klimakrise nennt, ist ja keine neue Entdeckung. Robert Jungk und andere haben schon vor einem halben Jahrhundert davor gewarnt. Damals wollte man nicht auf sie hören, hat sie eher als Spinner abgetan. Und diese Einstellung wurde massiv gefördert von jenen, die an der Entwicklung, deren Folgen wir heute drastisch zu spüren bekommen, in ungeheurem Ausmaß verdient haben und weiterhin verdienen. Optimisten sagen, auch sie würden zu einer besseren Einsicht gelangen, wenn ihnen klar würde, dass sie die Zukunft ihrer Kinder und Enkel aufs Spiel setzen. Weit gefehlt. Die Geld- und Machtgier kennt keine Skrupel. Sie opfert auch die eigenen Nachkommen. Zur Not hilft dabei die Verdrängung. Man nimmt die Folgen einfach nicht zur Kenntnis, wenn die Aktienkurse steigen.
Die Klimakatastrophe ist nicht nur eingetreten, sie ist bereits weit fortgeschritten. Sie wird nicht durch guten Willen zu verzögern sein. Dafür ist eine Veränderung der Machtverhältnisse nötig. Wer behauptet, er wolle die „Klimakrise“ bekämpfen, aber nicht jene beim Namen nennt, deren Interessen diesem Kampf entgegenstehen, nicht selten sogar, egal ob Konservativer, Liberaler, Sozialdemokrat oder Grüner, deren Geschäft betreibt, ist ein Betrüger. Sie sind, wie bei Ray Bradbury, Feuerwehrleute, die Brände legen. Den Profiteuren der Klimazerstörung muss ebenso in den Arm gefallen werden wie den Waffenproduzenten und Kriegsgewinnlern. Bekanntlich haben die nicht mit allzuviel Widerstand zu rechnen. Das macht in Bezug auf die „Klimakrise“ wenig Hoffnung.
|
Thomas Rothschild - 10. November 2019
2645
|
 Wie soll man leben?
Wie soll man leben?
|
Wie soll man leben? Gibt es noch eine verbindliche Moral? Gibt es Regeln, Grundsätze für den Umgang im sozialen Gefüge, auf die wir uns unter zivilisierten Menschen verständigen können, oder müssen wir uns auf den Kampf jedes gegen jeden, auf den Wildwuchs im Umgang mit dem Nachbarn einstellen?
Kants kategorischer Imperativ, wonach man nur nach derjenigen Maxime handeln solle, von der man zugleich wollen könne, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, ist immer noch eine brauchbare Verhaltensvorschrift. Hielten sich alle daran, sähe es auf der Welt friedlicher aus.
Der keineswegs heroische Arzt Doktor Reumann in Arthur Schnitzlers Einsamem Weg verzichtet auf einen Ruf nach Graz, weil es ihm peinlich wäre, "irgend einen Vorteil dem Malheur eines andern zu verdanken". Der ihm vorgezogene Kandidat war verunglückt. Reumann will auch nicht bei der Frau, die er liebt, vom voraussehbaren Tod seines Patienten profitieren, den diese junge Frau wiederum liebt.
Die Haltung des Doktor Reumann könnte auch sehr gut als Vorbild für das eigene Verhalten dienen. Hätten sich alle Menschen zu jeder Zeit an den Grundsatz gehalten, dass sie keinen Vorteil dem Malheur eines anderen verdanken wollen, dann hätten keine unbescholtenen Bürger die Wohnungen ihrer jüdischen Nachbarn ausgeräumt, als diese deportiert wurden; dann hätten die Angehörigen der Völker im ehemaligen Jugoslawien nicht die Höfe derer übernommen, die fliehen mussten; dann würden Börsenspekulanten keine Aktien kaufen, deren Wert nur deshalb gestiegen ist, weil Tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden; dann würde sich niemand um ein Amt oder einen Posten bewerben, dessen Inhaber ungerechterweise von diesem vertrieben wurde; dann würde sich niemand über „Schnäppchen“ freuen, die bei einem anderen verpfändet wurden oder die dieser zu einem niedrigen Preis verschleudern musste, um seine Miete bezahlen zu können.
Kurz: würde jeder auf jeden Vorteil verzichten, der auf dem Unglück eines anderen beruht, sähe die Welt besser aus.
|
Thomas Rothschild - 29. Oktober 2019
2644
|
 Klassengesellschaft
Klassengesellschaft
|
Es gibt keine Klassengesellschaft mehr! Wer dieses Märchen glaubt, ist eingeladen, einmal eine Stunde im Café Dommayer in Hietzing, dem westlichen Nobelbezirk Wiens, und eine Stunde im Café Dreivierteltakt in der Praterstraße, drüben im 2. Gemeindebezirk, jenseits des Donaukanals, zu verbringen. Beobachten Sie die Menschen, die dort verkehren, ihre Kleidung, ihre Körperhaltung, ihre Umgangsformen, ihre Sprache. Hier, im Dommayer, sitzen jene, die nicht arbeiten müssen, dort, im Dreivierteltakt, jene, die nicht arbeiten dürfen. Hier die höheren Töchter, die erkennbar mehrere Stunden täglich vor dem Kosmetikspiegel oder beim Friseur verbringen, und die Herren Söhne, die die Börsenkurse studieren, dort im Dreivierteltakt die Randexistenzen, die sich keinen Zahnersatz leisten können und die Camouflage des Alkoholismus nicht beherrschen, wenn sie ihre Arbeitslosenunterstützung für ein Achterl oder einen Spritzer verplempern. Die „besseren Leut'“ in Hietzing haben keine Hemmungen, ihren Wohlstand zur Schau zu tragen, und die Verachtung für das „gemeine Volk“ steht ihnen und schon ihren wohlerzogenen Kindern, die sich am Kuchenbuffet die besten Stückchen auswählen, ins Gesicht geschrieben. Die pietistische Zurückhaltung der Schwaben, denen es als anstößig gilt, seinen Reichtum zu demonstrieren, ist ihnen fremd.
Sie begegnen einander selten, die Kunden des Café Dommayer und die Kunden des Café Dreivierteltakt. Die Innenstadt mit ihren Touristen hält sie auseinander. Die wiederum sehen nur den Stephansturm und die Hofburg, und wenn sie einen Kaffee trinken wollen, gehen sie weder ins Dommayer, noch ins Dreivierteltakt, sondern in den neutralen Bräunerhof, ins museale Café Central oder ins vom vergangenen Ruhm zehrende Hawelka. Und sie kehren heim zum Jungfernstieg, nicht nach St. Pauli, schwärmen von Wien und von der klassenlosen Gesellschaft.
Es muss übrigens noch nicht einmal Hietzing und die Leopoldstadt sein. Wer die Bezirksgrenzen zwischen der Josefstadt und Ottakring oder zwischen Wieden und Favoriten überschreitet, durchbricht einen „Eisernen Vorhang“ ökonomischer und sozialer Art wie einst an der slowakischen oder an der ungarischen Grenze den politischen. Das „Rote Wien“, das gegen diese Trennung anzukämpfen versuchte, ist nur noch eine Legende wie der „Melting Pot New York“.
|
Thomas Rothschild - 16. Oktober 2019
2643
|
 Proll
Proll
|
Die Kritik an bestimmten Sprachverwendungen und die Forderung von Verboten schlagen zuweilen kuriose Volten. Gegen ein Wort aber, das zurzeit Konjunktur hat, haben die Sprachpolizisten nichts einzuwenden: gegen das Wort „Proll“. Es ist eine Kurzform von „Prolet“ und wird, wie dieses gelegentlich, ausschließlich abwertend gebraucht (siehe den erhellenden Artikel von Susann Witt-Stahl).
Bertolt Brecht dichtete: „Und weil der Prolet ein Prolet ist,/ drum wird ihn kein anderer befrein,/ es kann die Befreiung der Arbeiter/ nur das Werk der Arbeiter sein.“ „Prolet“ – das klingt bei Brecht und in seiner Zeit stolz. Dass man sein Selbstbewusstsein daraus bezieht, zur Arbeiterklasse zu gehören und seinen Lohn mit ehrlicher Arbeit statt mit Ausbeutung und Spekulation zu verdienen, ist eine vergessene Tugend. Wenn man aber nicht mehr auf seine Klassenzugehörigkeit stolz sein kann, ist man es auf seine nationale Zugehörigkeit. In Kontrast zu Brechts Lob des Proleten schrieb Carl Sternheim etwa mit sarkastischem Spott über den Bürger Schippel.
Mittlerweile hat die Bewertung des Bürgerlichen eine radikale Wandlung erfahren. Es ist im allgemeinen Verständnis etwas Positives. Seine Meriten anzuzweifeln, gilt als Frevel. Dass die Grünen, allen voran ihr konservatives Aushängeschild Winfried Kretschmann, sich rühmen, in der bürgerlichen Mitte angekommen zu sein, vermag kaum noch zu verwundern. Dass aber auch der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier der AfD attestiert, sie sei „antibürgerlich“ und das nicht etwa positiv, sondern als Vorwurf wertet, ist, ob er mit dieser Ansicht nun recht hat oder nicht, verräterisch. Was, wenn nicht die Gegnerschaft zur Bourgeoisie, wäre die Raison d'Être der Sozialdemokratie gewesen?
Als Kevin Kühnert den waghalsigen Versuch machte, eine Möglichkeit anzuregen, die das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vorsieht, nämlich die zwangsweise Kollektivierung („Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden“), beschied ihm Andrea Nahles, die immer noch als halbwegs Linke galt und inzwischen das Handtuch geworfen hat, man könne richtige Fragen stellen und trotzdem falsche Antworten geben, sie aber finde Kühnerts Antworten falsch. Sie hat sich, in Übereinstimmung mit den Granden und den reaktionärsten Proponenten ihrer Partei, gegen den Hauch einer sozialistischen Erwägung ausgesprochen. Sie hat sich für das Bürgerliche entschieden. Es hat ihr nicht genützt. Aber in der Sache standen die Sachwalter ihrer Partei schon hinter ihr. Man ist doch schließlich kein Proll.
|
Thomas Rothschild - 9. Oktober 2019
2642
|
 Natur und Verblödung
Natur und Verblödung
|
Vor ein paar Jahren standen die Schokoladenfirma Ritter Sport und die Stiftung Warentest einander vor Gericht gegenüber. Die Stiftung Warentest monierte, dass der Aromastoff Piperonal, der für die Vanillenote zuständig ist, chemisch hergestellt werde und somit gegen die Angabe verstoße, in der Schokolade Voll-Nuss seien ausschließlich natürliche Zutaten enthalten. Der Schokoladenhersteller versicherte, dass sein Piperonal auf natürlichem Wege gewonnen werde.
Offen gestanden: mir ist es scheißegal, ob der Vanillegeschmack auf natürliche oder auf chemische Weise zustande kommt, zumal selbst die Stiftung Warentest erklärte, dass auch das chemisch produzierte Aroma keine Gefahr für die Gesundheit darstelle. Ja, ja, ich weiß schon, es ging bloß um die Ehrlichkeit der Deklaration. Der Konsument soll sich auf sie verlassen können. Aber hätte es die ganze Aufregung auch gegeben, wenn ein Lebensmittelproduzent einen natürlichen Zusatz als chemisch deklariert hätte? Offenbar nicht. Das Zauberwort „Natur“ hat inzwischen zu einer massenhaften Verblödung geführt. Und keiner redet davon, dass sich mit ihm oder mit der Vorsilbe „Bio“ gute Geschäfte machen lassen. Wo so viel an einer Sprachregelung und der mit ihr zusammenhängenden Ideologie verdient werden kann, sollte man skeptisch sein.
Was natürlich entsteht, ist von vornherein nicht gesünder, nicht bekömmlicher, für den Menschen nicht geeigneter als künstlich – chemisch, technisch – Hergestelltes. Sulfonamide, die mit dem aus der Natur gewonnenen Penicillin konkurrieren, sind ein chemisches Produkt. Die Bakterien, die mit ihnen bekämpft werden, sind ein Stück Natur. Man muss schon sehr an die Vernunft des Schöpfergotts glauben, wenn man die natürlichen Bakterien den chemischen Sulfonamiden vorzieht. Im Übrigen sind die Vorgänge, die als natürlich gelten, nicht weniger chemisch als die von Menschen initiierten. Auch hier bedarf es einer unerschütterlich religiösen Weltsicht, um zu idealisieren, was die angeblich göttliche Natur und nicht der Mensch hervorbringt: den zerstörerischen Hurrikan, das Hochwasser, die Erdbeben und die Giftpilze. Der Mensch mag durch besinnungslose Eingriffe in die Natur manche schädlichen Effekte verstärkt haben. Aber es bedurfte ihrer Mitwirkung nicht. Naturkatastrophen sind älter als die Exploitation der Natur. Und insgesamt hat der Mensch durch seine Erfindungen, durch Chemie und Technik, wohl mehr Gutes bewirkt als Schlechtes. Wer immer nur einen geraden Weg von der Aufklärung zur Atombombe sieht, soll bekennen, dass er die Massen von Frauen in Kauf zu nehmen gewillt ist, die im Kindbett starben, und eine Vervielfachung des ohnedies dramatischen Hungers auf der Welt als Folge des Verzichts von Chemie und Technik in der Lebensmittelproduktion.
|
Thomas Rothschild - 10. Juli 2019
2629
|
 Wie fremd sind uns die Fremden?
Wie fremd sind uns die Fremden?
|
Wenn mir der 87. Film über die sexuellen Nöte von surfenden Halbwüchsigen auf die Nerven geht, erklärt man mir, ich gehöre eben nicht zur Zielgruppe solcher Filme. Und wer könnte es leugnen: ich bin tatsächlich schon lange kein Teenager mehr, die Probleme der Pubertät sind mir zwar noch in Erinnerung, aber sie liegen weit zurück. Und doch – ist damit erklärt, warum mich viele von jenen Filmen langweilen, zu denen die Altersgruppe, die darin abgebildet wird, in Massen strömt?
Im Stuttgarter Schauspiel hörten sich die Gegner von Stuttgart 21 – wie wir heute wissen: ohne Auswirkung – an, wie Gegner von Stuttgart 21 auf der Bühne jene Slogans wiederholen, die sie selbst bei der Montagsdemonstration skandiert haben. Bei der feministischen Theatergruppe applaudieren Frauen ihren Geschlechtsgenossinnen für die Darstellung dessen, was sie Tag für Tag erleben. Schwule versammeln sich bei Veranstaltungen, denen man attestiert, dass sie einer spezifischen Schwulenästhetik entsprächen, als wollten sie ihren Verächtern bestätigen, dass sie mit ihnen nichts gemeinsam hätten, und als gäbe es in deren Erfahrungswelt nichts, was für sie von Belang wäre.
Es hat sich etwas geändert. Wenn es tatsächlich so wäre, dass mir die inflationär produzierten und aufgeführten Coming-of-age-Filme nur deshalb auf die Nerven gehen, weil ich selbst kein „Heranwachsender“ mehr bin – wie erklärt es sich dann, dass zu der Zeit, als ich tatsächlich ein Heranwachsender war, Ingmar Bergmans Wilde Erdbeeren und Akira Kurosawas Ikiru zu meinen Lieblingsfilmen zählten, obwohl ich weit entfernt war von den Erfahrungen eines alten Mannes, der auf sein Leben zurück blickt oder an Krebs stirbt? Woran liegt es, dass wir uns damals als junge Männer für Alexandra Kollontai interessierten und als Heterosexuelle für die Abschaffung des Paragraphen stark machten, der Homosexualität unter Strafe stellte? Wie kommt es, dass wir alle, Junge wie Alte, Frauen wie Männer, Schwule wie Heterosexuelle – und ich meine das, wenn ich an unseren Freundeskreis von damals denke, genau so, wie es hier steht, kann es mit Namen belegen – uns für die Unterprivilegierten im eigenen Land und weit darüber hinaus mehr interessierten als für das Kollektiv, dem wir selbst angehörten?
Wenn die Beobachtung zutrifft, dass das Interesse, gar der Einsatz für das Fremde, das Andere, das Entfernte weitgehend verschwunden ist zugunsten der Wahrnehmung eigener Interessen, dann muss das mit den herrschenden Zuständen zu tun haben. Wenn heute global betrachtet ohnedies Privilegierten nur die Empfehlung einfällt, sich selbst zu positionieren und seine Vorteile wahrzunehmen, statt jenen, die tatsächlich marginalisiert und ausgeschlossen sind, dazu zu verhelfen, dass sie sich positionieren können, dann reproduzieren sie die Werte einer wölfischen Gesellschaft, in der man vorgibt, fressen zu müssen, um nicht gefressen zu werden. Sie haben längst die Regeln des Catch-as-catch-can akzeptiert und internalisiert und spielen das Spiel der rücksichtslosen Konkurrenz mit, noch dazu in der heuchlerischen Variante, die tut, als würde man sich für Mitglieder des eigenen Kollektivs einsetzen, wo man lediglich seine eigenen Vorteile im Blick hat. Sie sind konstitutiver Bestandteil eines Systems, in dem die Wirtschaft (und damit ist nichts anderes als der Profit gemeint) höchste Priorität hat und jede Risikoerwägung außer Kraft setzt – ob sie nun Atomkraftwerke, Gurken oder Autoabgase betrifft. Was einem selber nützt, ist schon allein dadurch positiv, auch wenn es anderen schadet. Kants kategorischer Imperativ ist in der blühenden kapitalistischen Landschaft ein Fall fürs Museum. Wenn da, etwa apropos AKW oder Flüchtlinge, eine Angela Merkel über ihren Schatten springt und das Richtige tut, sollte man nicht lange danach fragen, was ihre Gründe sein mögen, sondern sich darüber freuen. Ob die- oder derjenige, die oder der Einspruch erhebt gegen die egoistischen Interessen der AKW-Betreiber und ihrer Ideologen, ob die Verteidigerin, der Verteidiger der Vernunft, sei es aus Kalkül, sei es aus Einsicht, sei es unter dem Schock einer Katastrophe, Merkel oder Kretschmann heißt, ist nebensächlich. Auf das Ergebnis kommt es an.
Es hat schon seinen Grund, dass Begriffe wie „internationale Solidarität“ und „kompensatorische Erziehung“ oder gar „Rote Hilfe“ aus dem öffentlichen Sprachschatz verschwunden sind. Das ist kein linguistisches Problem. Es spiegelt eine Welt, in der man nur sich selbst sehen will und das Fremde nicht mehr interessiert. Wolf Biermann hat sich einmal über die „Leiden aus zweiter Hand“ lustig gemacht. Inzwischen hat er die aus den Augen verloren. Dennoch, sein Spott traf damals einen richtigen Punkt. Inzwischen ist er anachronistisch. Heute leiden die meisten Menschen nur noch an sich selbst. Sie betrachten sich im Spiegel, der auch die Gestalt einer Kinoleinwand oder einer Theaterbühne annehmen kann, und vergessen, was sich dahinter befindet. Die paar Ausnahmen riskieren, als „Gutmenschen“ verachtet zu werden. Selbst Angela Merkel, Helmut Kohls „Mädchen“, ist in diese Gefahr geraten.
|
Thomas Rothschild – 2. Juli 2019
2628
|
|
|

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
THEMEN
UNSERE NEUE GESCHICHTE
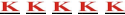
= nicht zu toppen

= schon gut
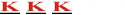
= geht so
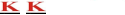
= na ja
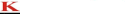
= katastrophal
|