|
James Salter | Alles, was ist
RomanBerlin Verlag, 2013
ISBN 978-3-8270-1162-6
|
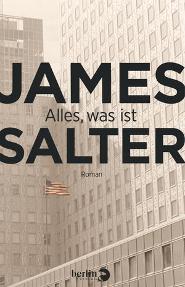
|
Es war einmal die Literatur der Vergangenheit. Es war eine Literatur der Männer. Eine Literatur, die einen männlichen Blick auf die Frauen, die Gesellschaft und das Leben warf. Sie war aber auch die bestimmende Erzählweise der Moderne. Sie zeigte uns eine Welt der Männer und ihrer Sorgen und Ängste, ihrer Reflexionen und Heldentaten. In dieser Welt der literarischen Moderne fühlen wir uns wohl, sie ist uns vertraut, wir haben uns in ihr - wenn auch nicht immer gemütlich - eingerichtet. Die fabelhaften Heroen dieser Welt tragen Namen wie Joyce, Gide, Aragon, Faulkner, Beckett, Musil und unzählige Andere. Zu sagen, ihre Welt berührte uns nicht, wäre eine Lüge. Zugegeben, diese Väter der modernen Literatur verdanken wiederum ihren Vätern viel: Knut Hamsun und Joseph Conrad etwa. Sie verdanken ihnen jenes literarische Erbgut, das auch noch in den Werken des amerikanischen Autors James Salter blüht und gedeiht: Die Mysterien des gebeutelten und einsamen Bewusstseins der entwurzelten männlichen Existenz. Die Idee des unmöglichen Erzählens sowie die Einsicht, dass dieses männliche Bewusstsein nie heranreichen wird an die Welt der Anderen, insbesondere der Frauen, an ihre Sorgen und Ängste. Simone de Beauvoir - ihres Zeichens eine Frau, die sich nie zu schade war, ihre bourgeoise Provenienz als wehrhaftes Schild gegen die kontinentale Bewusstseinsphilosophie der Männer zu richten - stellte das Rätsel des Anderen, das schiere Bewusstsein seiner Mit-Existenz, als die bemerkenswerteste Tatsache der humanen Spezies dar. Sie schuf, eine frühe Antiheldin der Moderne, aus dem Geiste eines maßlosen männlichen Solipsismus die Vorstellung eines "anderen Geschlechtes", das sich der Fesseln des gestrandeten Ego-Bewusstseins des Mannes entledigt. "Emanzipation" nennt man das nur vordergründig, wenn auch der Beauvoir dieses gesellschaftliche Ziel viel bedeutete; hier wäre stattdessen von der Emanzipation des menschlichen Geistes von dessen Weltlosigkeit zu sprechen. Eine Idee, die auch am Ende von James Salters Roman Alles, was ist aufscheint. Nur ist dies nicht die Einsicht einer jungen französischen Intellektuellen in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern die grimme Intuition eines alten Mannes, der sein Leben hinter sich hat.
Wenn die Literatur der Moderne ihrem Wesen nach eine Literatur der Männer war, dann reiht sich Salters leicht verstaubte Art, die Welt zu zeigen, hierin nahtlos ein. Es lohnt, anhand dieses wunderbaren Alterswerkes, die Frage zu erörtern, was wir heute von Salters Roman lernen können. Es ist zweierlei: Zum einen ist Salter - paradoxerweise - deshalb veraltet, weil er im Grunde seines Herzens nicht mehr an das Erzählen glaubt. Zugegeben, er ist weniger pessimistisch als manch einer seiner literarischen Zeitgenossen. Ja es ist gewissermaßen das Eigentümliche seiner Literatur, dass sie aus dem erzählkritischen und solipsistischen Geist der Moderne geboren ist und doch tapfer dem konventionellen Erzählen treu bleibt. Dies übrigens lange bevor der post-postmoderne "narrative turn" diese Idee wiederaufleben ließ. In diesem Punkt ist Salter sehr nahe bei Julien Green oder Philip Roth oder Günter Grass oder Garcia Marquez. Am Ende aber, so wird nicht nur in diesem Werk deutlich, zerfällt seine Erzählung in Myriaden von Facetten, löst den Erzähler auf, verdichtet sich der semantische Nebel. Aber immerhin, Salter behauptet sich tapfer als einer, der eine Geschichte zu Ende erzählt hat: Sei es in dem zum Niederknien wundervollen Jahrhundertroman Lichtjahre oder in dem unvergesslichen Ein Spiel und ein Zeitvertreib oder eben in diesem neuesten Roman , den er nach gewaltigen 36 Jahren literarischen Schweigens (mit Ausnahme seiner Autobiografie) veröffentlichte. Daraus folgt: Salter lehrt uns heute vor allem, was "Erzählen" nicht ist: Schreiben aus dem Geist der Naivität. Schreiben ohne die Krisenerfahrungen der Sprache und der eigenen Geschichte. Oder sagen wir es mit Paul Celan: "Weggebeizt vom Strahlenwind deiner Sprache".
Und so kommt auch James Salter, der tapfer geradlinige Erzähler, in diesem Alterswerk nicht umhin, seinen eigenen Erzähler und dessen Sprache zu dekonstruieren, ihn und seine Geschichte, seinen männlichen Blick zu entlarven und in einer heillos korrumpierte Erzählform zu enden. So sehr es sich Salter gewünscht hätte, aber am Ende gibt es in seinen Geschichten keine Helden. Salters Werke, die auf dem Trümmerfeld der Moderne gediehen, lehrt uns, dass Literatur immer aus der Erfahrung des Scheiterns und der Lebensunfähigkeit entsteht.
Nicht gelingen wollen die vielen Ehen und Partnerschaften in Salters Roman. Der männliche Blick durchstreift jahrzehntlang New York und was er wahrnimmt, was ihn zu Tränen rührt, das ist allenthalben das Scheitern der Liebe. Untreue, die Unfähigkeit zur Hingabe, Drogen, Alkohol, soziale Not, berufliche Selbstverwirklichung. Jede Liebe, so scheint uns der 88jährigen Amerikaner zu sagen, endet zwangsläufig in einer persönlichen Katastrophe. Gleichgültig, wie großartig ihre Protagonisten sind, am Ende wird die Partnerschaft scheitern. Die Liebe, das wird in diesem Roman deutlich, ist eine Angelegenheit, bei der es darum geht, das eigene Scheitern zu lernen. Aber es ist kaum mehr Wehmut in dieser Erkenntnis zu finden. Salter, der die beständige Liebe suchte, hat sich schließlich mit ihrer quartalsmäßigen Endlichkeit arrangiert.
Alles, was ist umfasst einen gewaltigen Zeitraum von 1945 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Philip Bowman, der als Lektor in einem angesehenen New Yorker Verlag arbeitet. Viele Ehen werden in dieser Zeit geschlossen und geschieden, es ist wie das Wehen des Windes, der nicht nur in eine Richtung wehen kann, sondern stets wieder zurückfinden muss. Dabei erzählt James Salter konsequent aus der Perspektive eines einsamen Mannes. Es ist der erschöpfte und gelassene Blick des liebenden Mannes oder eben jenes Helden, der die Liebe suchte und an sich, den Umständen, den Frauen scheiterte. So verliert die partnerschaftliche Liebe in diesem Roman vollständig ihr individuelles Gesicht. Und das ist der eigentliche Skandal dieser erstaunlichen Odyssee durch das liebes- und geltungswütige New York der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Alle Bemühungen und alle Paare gleichen sich auf fatale Weise. Den Geschichten der Liebe mangelt es an Originalität. Dabei ist Salter keinesfalls fatalistisch, wie oft behauptet wurde, sein Alterswerk zeichnet sich vielmehr, wie auch seine frühen Bücher, durch einen elegischen Tonfall aus, denn dieser Autor scheint nur mühsam die Hoffnung auf eine sinnreiche Existenz zu zweit aufzugeben.
James Salter selbst war nicht immer nur Schriftsteller. Was ihn gegenüber vielen anderen klassischen Modernen auszeichnet, ist die Tatsache, dass er kein intellektueller Stubenhocker war: Mit siebzehn Jahren besuchte er die Militärakademie West Point. Dann wurde er Kampfpilot in Korea, danach Drehbuchautor in Hollywood, er bereiste Europa, vergnügte sich mit Frauen und eiferte jenem eleganten Lebensstil nach, den man aus den Filmen der sechziger Jahre kennt. Doch diese hedonistischen Ausschweifungen, die er mit seiner Figur Bowman teilt, waren auch bei ihm die konsequente Folge der bitteren Kriegserfahrungen. Auch Bowman verliert sich im Krieg selbst und wird diesen Verlust sein ganzes Leben lang nicht überwinden können.
Dass Salter es vermag, ganz in der Manier der Moderne, diese schwebende, gleitende, wankelmütige, haltlose Existenz sprachlich und erzählerisch nachzuahmen, das ist auch in diesem Roman seine eigentliche Stärke. Wahllos scheint sein Blick auf die Welt, es treten Figuren auf ohne erkennbaren Sinn, sie kommen und gehen, Nebensätze widmen sich neuen Themen, unverbunden reiht Salter Impressionen aneinander, die Sätze kommen und gehen, sie verführen den Leser, führen ihn über weite Strecken des Buches, tragen ihn weiter von Episode zu Episode, dabei sind es durchaus poetische Perioden, hintersinnig und lustvoll, doch zurück bleibt nur ein "Blick von Nirgendwo".
Anfang der fünfziger Jahre schließt Philip Bowman eine Ehe mit der Protestantin Vivian aus Virginia, die Ehe zerbricht bald, er gerät in das Milieu jüdischer Intellektueller und lernt in London seine große Liebe Enid kennen. Später befindet er sich in Köln, dort lässt er keine Party des Verlegers Heinrich Maria Ledig-Rowohlt aus. Dann begegnet er der nächsten großen Liebe, dem nächsten großen Versprechen, Christine, das ist in einem New Yorker Taxi, da ist er schon von Manhattan nach Hudson umgezogen. Christine, es war nicht anders zu erwarten, betrügt ihn, weshalb er mit ihrer Tochter schläft, aus Engstirnigkeit, aus Zorn, aus Trotz, man weiß es nicht. Irgendwann nähert er sich schließlich Ann an, vielleicht nur deshalb, weil es so banal und leicht ist, eine Kollegin als Partnerin zu haben. Vielleicht eine Vorliebe derjenigen, die wirklich gescheitert sind in der Liebe.
Nichts bleibt am Ende übrig vom unglaublichen Heroismus des Krieges, in dem Bowman als Gespenst neu geboren wurde. Männer wie Bowman, wie Salter, die sich bereits vom Leben verabschiedet hatten, in Form von Abschiedsbriefen etwa, überlebten und mussten irgendwie weiterleben, mussten lieben, mussten Sinn finden, nachdem sie bereits das Ende akzeptiert hatten. Dazu die scheußliche Gewalt, die Hölle der Kriegsmaschinerie. Dies alles macht diesen Roman tatsächlich zu einem "Männerroman" im guten wie im schlechten Sinne, der das Elend der "Modernen" bzw. der "modernen" Männer, insofern sie vom Krieg gezeichnet sind, gewissermaßen aus der Innenperspektive nacherzählt. Erstaunlich dabei ist die Entdeckung am Ende des Romans, auch wenn Zweifel bleiben, ob Bowman selbst diese Erkenntnis vollzieht: In seinem Leben hatten stets die Frauen die größte Macht. Denn ihre Gegenliebe war dafür verantwortlich, ob sein Leben gelang. Und da er scheiterte mit den Frauen, mit der Liebe, betrachtet er auch sein ganzes Leben als gescheitert. An den Frauen zählt Bowmann also die Stunden des Glücks und des Unglücks. Durch sie ist sein Leben gelungen oder nicht. Sigmund Freud, ein anderer Großvater der Moderne, wunderte sich einmal, dass die Menschen ihr Glück auf so etwas Unbeständigem wie der partnerschaftlichen Liebe gründen. Wie auch immer man dazu steht, in dem Alterswerk eines großen Romanciers des zwanzigsten Jahrhunderts lesen wir als eine Art Summe, dass es die Liebe der Frauen ist, die über das Glück und das Unglück der Männer richtet.
Bewertung: 
Jo Balle - 5. Februar 2014
ID 7576
James Salter | Alles, was ist
368 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,99 [D], € 23,70 [A], sFr 32,90
Hardcover
Berlin Verlag, 2013
ISBN 978-3-8270-1162-6
Siehe auch:
http://www.berlinverlag.de/buecher/alles-was-ist-isbn-978-3-8270-1162-6
Post an Dr. Johannes Balle
|
|
|
Anzeige:
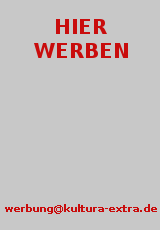
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
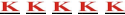
= nicht zu toppen

= schon gut
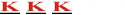
= geht so
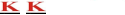
= na ja
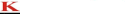
= katastrophal
|