|
Weißt du noch?
|

|
Bewertung: 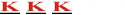
„Ständig ist alles gestern, heute und morgen. Je länger ich hierbleibe, desto mehr bringe ich die Zustände durcheinander, lebe zwischen den Zeiten. Ständig denke ich, sie sind wieder da oder waren noch nie weg.“ (Ricarda Messner, Wo der Name wohnt, S. 49)
*
Behutsam erzählt Ricarda Messner in Wo der Name wohnt vom Sich-Verorten über eine familiären Vergangenheit. Langsam entspinnt sich im autobiographisch geprägten Romandebüt eine Handlung, die einher geht mit einer Suche. Die Ich-Erzählerin wuchs teilweise bei ihren Großeltern auf. Zeitlebens hatte sie eine intensivere Bindung zur Großmutter als zur eigenen Mutter. Auch im Erwachsenenalter lebte sie mit ihrer Großmutter in Berlin Tür an Tür. Als ihre Großmutter stirbt, gewinnen für die Enkelin die Gegenstände im Haushalt der Verstorbenen während der Wohnungsauflösung an Bedeutung. Sie forscht nach, warum und wie ihre Großeltern und ihre Mutter aus Lettland einst zuwanderten. Sie möchte nicht akzeptieren, dass ihre Mutter weiterhin über die Vergangenheit schweigt. Schon früh lernte sie die Gesichtsausdrücke ihrer Mutter zu deuten:
„Großmutter und Großvater wunderten sich oft, verstanden nicht, nach welchem Gesicht ihre Tochter eigentlich kam, dabei sahen sie sich doch sehr ähnlich. Und sie fragten ihre Tochter immer wieder, was machst du ständig für Gesichter? Manchmal sage ich ihr das auch, sie soll ihre Gedanken für sich behalten, aber meistens gefällt es mir sehr, Mutters ausdrucksstarkes Gesicht.“ (S. 101)
Die Ich-Erzählerin nimmt die beunruhigten Gesichtszüge ihrer Mutter als ängstigend wahr, als sie diese zur Herkunft in Riga befragt und erhält keine befriedigende Auskunft. Die Figuren um die Ich-Erzählerin herum erscheinen stets vorsichtig abwartend, selten greifbar, vielleicht um auch nicht angreifbar zu werden?
„In Großvaters Gesicht lag eine heimliche Unruhe. Er sagte immer, es sei besser, nicht aufzufallen. Und niemand konnte so ruhig bleiben wie er. In meiner Erinnerung höre ich keinen laut werdenden Großvater, im Gegenteil, wurde sich im Wohnzimmer oder in anderen Räumen gestritten, war er es, der für gewöhnlich unterbrach, was sei das für eine Lautstärke, wer solle denn noch alles mithören?“ (S. 93)
Die genau beobachtende Erzählerin springt zwischen Details ihrer Familiengeschichte. Sie deutet Bleistiftstriche ihrer Mutter am Seitenrand einer englischsprachigen Ausgabe von J.D. Salingers The Catcher in the Rye (1951) als Anzeichen für Trotz und Aufbruch. Im nächsten Atemzug wechselt sie über zu Großvaters Wunsch nach Deutschland zu migrieren (S. 84). Im Fließtext tauchen regelmäßig russische oder lettische Einsprengsel auf, die nicht ins Deutsche übertragen werden. So etabliert Messner langsam ein Thema der Verschieden-Sprachigkeit. Der Leser selbst wird darüber hinaus verunsichert, wenn (auf S. 37) der Abdruck der Zahlen von 1 bis 100 provoziert.
Später erfahren wir, dass die Erzählinstanz aus „Kinderaugen heraus erzählen“ (S. 49) möchte. Der Erzählgestus scheint so mitunter haltlos, etwa wenn die Autorin experimentell mit anderen Textsorten wie Listen spielt. Eine Formel der Wahrscheinlichkeiten und Variablen scheint unerschöpflich, wenn die Erzählerin ihre ständig wechselnde Handschriften thematisiert:
„Ich selbst habe Jahre gebraucht, um eine eigene Handschrift zu finden. Ständig probierte ich Versionen aus, in denen die Buchstaben mal nach rechts, mal nach links fielen..." (S. 107)
Plötzliche Einfügungen geben sodann Erzählungen anderer Figuren wieder, wenn die erzählende Protagonistin alte Dokumente sichtet. In Kursivschrift wird der Leser so in Einschüben des Urgroßvaters Salomon Levitanus gar direkt angesprochen „Ja, aber, lieber Leser, liebe Leserin...“ (S. 95) In den Worten des Urgroßvaters heißt es dann später:
„Und dann wiederhole ich: Das Wichtigste an allem ist das Fundament. […] Wer schlecht anfängt, endet schlecht.“ (S. 97)
Solche Worte bestärken die Ich-Erzählerin scheinbar in ihrer Spurensuche.
Im Mittelteil gewinnt das Erzählte dann an Dringlichkeit. Ebenjener Urgroßvater war es, der 1941 ein Opfer der Faschisten in Lettland wurde, „im Zentralgefängnis von Riga mit Gummiknüppeln bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen.“ (S. 110) Der Leser erfährt, dass 1941 etwa 72.000 weitere Juden aufs Grausamste von lettischen Nazis ermordet wurden. Noch heute erinnert neben Gedenkstätten der Rigaer Blutsonntag an das Geschehen am 30. November 1941.
Erst gegen Ende des Romans lässt ein Detail aufhorchen: So wurde die Mutter der Ich-Erzählerin einst bei ihrer Zugausreise am 9. April 1971 als Jüdin eingeordnet, ohne dass für diese selbst eine Kategorie wie Religion oder Religiosität zuvor eine Rolle spielten.
*
Wo der Name wohnt thematisiert auf herausfordernde Weise ein Zulassen von Nähe zwischen Familienangehörigen, etwa durch das Wissen um die gemeinsamen Vorfahren. Nebenschauplätze wie wiederholte Einschübe mit formelhaften Sätzen zum familiären Namensrecht und Namensänderungen (S. 22, S. 31, S. 47, S. 63, S. 78, S. 104, S. 117, S. 132, S. 152, S. 165) erscheinen streitbar und überfrachten das vieldeutige Werke etwas. Ricarda Messners vielbeachtetes Debüt erhielt trotzdem unter anderem Juni 2025 den Literaturpreis der Stadt Fulda.
Ansgar Skoda - 9. Juli 2025
ID 15356
Suhrkamp-Link zum Roman
Wo der Name wohnt
Post an Ansgar Skoda
skoda-webservice.de
Bücher
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
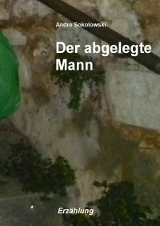
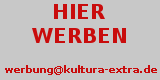
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
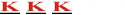
= geht so

= na ja

= katastrophal
|