|
Romantik und
kein Ende
|

|
Bewertung: 
In der Hermeneutik gibt es den Ausdruck Vorgriff auf Vollkommenheit des Kunstwerkes. Ein anderes Wort dafür wäre das Prinzip Wohlwollen. Das ist nicht moralisch gemeint. Es soll heißen, dass wir nur dann ein Kunstwerk sachlich adäquat erfassen, wenn man das Gute daran sieht. Dann kommen seine Eigenschaften so zum Tanzen, dass sie ein stimmiges Bild ergeben. Anders formuliert: Nur wenn ich unterstelle, dass ein Roman sinnhaft und stimmig ist, werde ich ihn verstehen. Indem ich eine solche Haltung einnehme, bringe ich das Kunstwerk zum Leuchten. Es ist, als würde es einen anderen Aggregatzustand annehmen. Ich sehe es plötzlich in angemessenem Licht.
Es geht hier nicht um die Perversion des Geschmackssinnes. Auch soll dadurch nicht das Prinzip der Kritik außer Kraft gesetzt werden. Es geht um eine Haltung, die übrigens auch in unserer Gesellschaft an vielen Stellen verlorengegangen ist, die aber eine notwendige Bedingung des Zusammenlebens und eben auch der Kunstbetrachtung darstellt. Wir sollten nicht nur die Mitmenschen, sondern auch die Kunstwerke so aufnehmen, wie sie bestmöglich aufgenommen werden könnten. Für diese Haltung des „Als-Ob“ spricht vieles, das aufzuzählen im Rahmen einer Buchbesprechung zu weit führt. Eines aber kann gesagt werden: Das Wesentliche an einem Kunstwerk ist weder sein empirischer Wahrheitsgehalt noch seine technische Perfektion. Wer sich einem Kunstwerk öffnet, behandelt es wie einen Menschen, dem man trotz seiner Fehler gerne folgt. Ein Platoniker würde sagen: Es ist die Liebe oder die Sympathie oder das Wohlwollen, wodurch sich Dinge wie auch Menschen in ihrem echten Licht zeigen.
Es ist dieser Gedanke, der sich dem Rezensenten bei der Lektüre des Romans Was wir wissen können von Ian McEwan aufdrängte. Nicht, dass dieser technisch so außerordentlich versierte Autor unser Wohlwollen nötig hätte. Gerade aber in seinem Fall wird deutlich, dass ein Meisterwerk wie dieses in seiner Brillanz erst dann wahrhaft aufscheint, wenn man von technischen Einzelbetrachtungen absieht. Was der Autor mit diesem Werk vorlegt, übersteigt vieles, was heute publiziert wird. Es ist ein Werk, das bleibt.
Rasch ist erzählt, worum es geht. Wir schreiben das Jahr 2119. Die Welt ist nach apokalyptischen Ereignissen überschwemmt, Großbritannien ein Archipel. Der Philologe Thomas Metcalfe fahndet nach einem verschollenen Gedicht des Lyrikers Francis Blundy, das dieser seiner Frau Vivien gewidmet hat und nur ein einziges Mal vortrug. Metcalf und viele andere Forscher halten es für Blundys Meisterwerk. Ian McEwan erzählt die Geschichte dieser literaturwissenschaftlichen Recherche als Suche nach der verlorenen Zeit und einer verlorenen gegangenen Wahrheit.
Man kann zu diesem Roman vieles sagen. Man kann Kritik üben hier und da. Doch man sollte sich darin nicht verlieren. Denn dieser Roman ist hellsichtig und aufklärerisch, zugleich aber geheimnisvoll und schmerzlich, so sehr dies nach Stereotyp klingen mag. Abgesehen davon, dass McEwan, technisch betrachtet, überragende szenische Darstellungen anbietet. Man kann es vielleicht so sagen: Dieser Autor erschafft tatsächlich eine Welt, die wie eine echte mögliche Parallelwelt zu unserer Wirklichkeit erscheint. Dabei generiert er einen Blick aus der Zukunft zurück auf unsere Gegenwart und erhellt damit vieles, das sich nicht so ganz leicht aussprechen lässt. Er fängt den Geist unserer Zeit ein? Oh je, was für eine Plattitüde. Und doch ist sie irgendwie wahr. Vor allem besitzt McEwan ein sagenhaftes Verständnis der menschlichen Seele. Einige Szenen geraten so intensiv, dass einem zumute ist, als wohne man der Situation bei. Wer einmal die Fahrt über den postapokalyptischen Archipel Großbritanniens gelesen hat, wird nicht mehr daran zweifeln, dass der Literatur jene weltverändernde Kraft innewohnt, einen locus amoenus als atmenden Gegenentwurf der eigenen Realität heraufzubeschwören. Eine veritable Dialektik der Aufklärung.
Was wir wissen können ist eine dystopische Geschichte, die sich mit der Wirklichkeit messen lassen kann. Mit dem, was der Fall ist. Dabei huldigt der Autor jener ominösen Kraft der Poesie und ordnet und verunstaltet zugleich die Grenzen unseres Wissens maßgenauer als manche erkenntnistheoretische Abhandlung dies vermag. Indem McEwan dem, was allgemeingütig ist, eine individuelle Note verleiht, poetisiert er. Und indem er dem, was individuell ist, einen allgemeinen Charakter schenkt, klärt er auf. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die sich mit diesem Roman an eine denkwürdige Kunstepoche erinnert fühlen, deren Quellen wir, trotz ihrer verzweifelten und radikalen Diadochenkämpfe im Zuge von Moderne und Postmoderne, nach wie vor in uns tragen. Und vermutlich werden wir mit ihren Schatten noch lange Zeit ringen.
Jo Balle - 9. November 2025
ID 15551
Diogenes-Link zum Roman
Was wir wissen können
Post an Dr. Johannes Balle
BUCHKRITIKEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
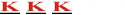
= geht so

= na ja

= katastrophal
|