|
Von Geisterflotten
und verschollenen
Männern
|

|
Bewertung: 
„Hunderte Kilometer von der Küste entfernt, wo es keinen Handyempfang, keine Gesetze gibt.“ (Benoit d'Halluin, Ein Schrei im Ozean, S. 356)
*
Die weltumspannenden Meere bedecken mindestens zwei Drittel der Erdoberfläche. Ihre Tiefen sind jedoch nur etwa zu 5 Prozent erforscht. Transportwege für Menschen und Waren über die Meere sind als Wirtschaftsraum und Transferzone umkämpft.
Gestern war der internationale Weltschifffahrtstag. Es lohnt sich an diesem Aktionstag, der seit 1978 jährlich von der Internationalen Schifffahrtsorganisation organisiert wird, auf eine Roman-Neuerscheinung zu blicken. Benoit d'Halluin legt in Ein Schrei im Ozean einen besonderen Fokus auf Aspekte des maritimen Umweltschutzes und betrachtet gleichzeitig illegale Methoden der Fischerei in Südostasien.
Eine der Hauptfiguren, Sophie, lässt sich als Alter Ego des Autors deuten. Auch sie widmet sich als Autorin einem Buch über die Ozeane. Sie weiß nicht, womit sie anfangen kann und problematisiert bitter eine fahrlässige Überfischung und Verschmutzung:
„Ein Buch über das Leiden der Ozeane – wo anfangen? Worüber schreiben? Über die herkömmlichen Themen, die die breite Öffentlichkeit bewegen? Schillernde Fische, die über den Überresten der Korallenriffe schwirren? Die letzten Wale, die unerbittlich von den Japanern bis hinein in die Antarktis verfolgt werden? Oder den Rest, um den sich niemand schert: Das Rechtsvakuum, die Erderwärmung, die Versauerung, das Plastik, die Ölvorkommen, der Tiefseebergbau? Wo anfangen? Ihre Ratlosigkeit nimmt ozeanische Ausmaße an.“ (S. 326)
Die Französin Sophie befasst sich schlussendlich in ihrem Buch nicht zuletzt mit der Versauerung und Erwärmung der Ozeane. Im Verlauf des Thrillers erfahren wir als Lesende, dass in Erdteilen, wie etwa in Asien, auf den Meeren ein absolutes Rechtsvakuum, das Recht des Stärkeren, und menschliche Grausamkeiten gelten. Auch Menschenhandel und illegale Sklaverei scheinen gelebter Alltag.
Der vom Kanadier Benoit d'Halluin verfasste Roman schlägt demnach hohe Wellen und liegt jetzt in einer einfühlsamen Übersetzung von Paul Sourzac vor. Neben Sophie sind ihr jüngerer Bruder, der vierzigjährige Franzose Olivier Dupuis und dessen Lebenspartner, der Mittzwanziger Arun Leng, Hauptfiguren des Romans. Olivier und Arun leben seit sieben Jahren in Paris als Paar zusammen. Während eines Urlaubs in Pattaya, Thailand, besucht Arun, ein gebürtiger Kambodschaner, seine Eltern und Geschwister in der Heimat. Arun überrascht Olivier, als er vom Familienbesuch zurückkehrt, in Pattaya mit einem Stricher. Es kommt zum Streit zwischen dem Paar, und Arun verlässt Olivier wutentbrannt. Der völlig aufgelöste Arun weiß nicht wohin und betrinkt sich mit einer Zufallsbekanntschaft in einer Kneipe. Er wird betäubt und findet sich am nächsten Tag in einem Schiff auf offenem Meer wieder.
In aufeinanderfolgenden Kapiteln wechseln jeweils die Perspektiven von Sophie, Pierre und Arun. Sophies Erzählebene enthält eine Vergangenheitsebene und beinhaltet traumatische Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend von ihr und Pierre. Die plötzlichen Erzählwechsel nach ungelösten, oft dramatischen Situationen erzeugen als sogenannte Cliffhanger Spannung. Somit ist es witzig wenn Sophie als Autorin die „auf Netflix- Serien konditionierte Gesellschaft“ (S. 421) diskutiert.
Die Gestaltung der Figuren erscheint nicht immer ganz geglückt, wenn etwa mit Marthe, die Tante der beiden zentralen Geschwister, eine gutherzige Figur wie aus einem Bilderbuch plötzlich auf der Bildfläche des Romans erscheint.
Lesende erfahren viel über die Weltmeere. Mal heißt es in Gesprächen zwischen Sophie, die im Romanverlauf mit ihrem späteren Ehemann Juan bei Greenpeace arbeitet, und ihrem Bruder, nur drei Prozent der Meeresfläche seien wirklich geschützt:
„Zunächst einmal sind die Ozeane Gemeingut, sie gehören allen und zugleich niemandem. Wie soll man Gesetze in so großen Gebieten anwenden, ohne überhaupt zu wissen, wessen Eigentum sie sind? Es gibt keine Ozeanpolizei.“ (S. 248)
Es wird problematisiert, dass ein Drittel des Mülls im Meer Fischereiutensilien sind und insbesondere nicht eingesammelte, sich verheddernde oder beschädigte Netze als sogenannte Geisternetze sinnlos weiter töten, da Plastik kaum abgebaut wird. Bojen und lange Leinen sorgen für dutzende Kilometer lange Fischnetze. Oftmals gibt es so zu viel Beifang. So würden etwa zehntausende Delfine durch Netze getötet. Fußnoten im Roman informieren, dass zulässige Leinenlängen nach Vorschrift variieren – zehn Kilometer in der EU, vierzig in den USA, siebzig im Indischen Ozean und bis zu hundert Kilometer in internationalen Gewässern. D’Halloin problematisiert über die porträtierte Arbeit seiner Figuren Korruption und mafiöse Strukturen und Verstrickungen mit der Politik in Indonesien und stellt die Arbeit der 2015 gegründeten, realen Global Ghost Gear Initiative vor, die sich gegen im Meer verlorene schädliche Fischereigeräte einsetzt.
Während Kapitel aus den Perspektiven von Sophie und Piere manchmal mitunter arg betroffen, bitter und einseitig moralisch belehrend erscheinen, lässt einen Aruns plötzliche Lebenswelt atemlos und erschüttert weiterlesen. Arun muss sich fortan als Sklave und kostenlose Arbeitskraft in der Fischerei in Thailand auf indonesischen Gewässern behaupten, ohne zu wissen, wie er sein schweres Los überleben oder ihm entkommen kann. Arun trifft bald auf andere europäische Touristen, die kein Thai sprechen und auch sein Schicksal erleiden. Den Sklaven an Bord der illegalen Fischereiboote geht es teils ähnlich wie ihrem Fanggut. Zynisch-brutal erzählt D’Halloin so vom Martyrium eines zweihundert Kilo schweren Seidenhais:
„Die Folter nimmt kein Ende. Nachdem die Flossen, die von den Chinesen wegen ihrer angeblich aphrodisierenden Wirkung geschätzt werden, entfernt wurden, ist die noch lebende Beute plötzlich uninteressant für die Fischer. Sein Fleisch ist essbar, aber es nimmt Platz weg. Warum also diesen erbärmlichen Hairumpf an Bord behalten, wenn man viel profitablere Beute laden kann? Mit letzter Anstrengung, fast schon, als würden sie ihm einen Gefallen erweisen, packen die Männer das verstümmelte Geschöpf und werfen es wie Abfall über Bord.“ (S. 287)
Benoit d'Halluin gelingt es stets aufs Neue seine Leserschaft zu erschüttern. Doch wie lässt sich eine Welt, in der Recht und Ordnung scheinbar an Bedeutung immer mehr verlieren, zum Besseren gestalten. Über die im Buch beschriebenen Themen zu informieren kann vielleicht ein nützlicher Beitrag sein. Dies geschieht an manchen Stellen in einem moralisch-belehrenden Duktus. Zurück bleiben wir aber auch hier wieder mit der Frage: was können wir tun?
Ansgar Skoda - 26. September 2025
ID 15476
Verlagslink zum Roman
Ein Schrei im Ozean
Post an Ansgar Skoda
skoda-webservice.de
Bücher
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:
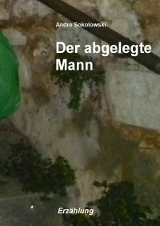
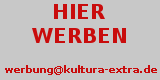
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut
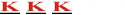
= geht so

= na ja

= katastrophal
|