|
Vladimir Vertlib – Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur
Dresdner Chamisso-Poetikvorlesungen 2006. Mit einem Nachwort von Walter Schmitz und Annette TeufelThelem Verlag, Dresden 2007
257 Seiten, kartoniert
14,80 Euro [D] / 15,30 Euro [A]
ISBN: 978-3-939888-28-4
|

|
Die Fähigkeit zur Toleranz
„Jeder literarische Text ist, meiner Ansicht nach, unter anderem ein Aufstellen und In-Frage-Stellen von Gesetzen. Und so muss man auch eine Rezension lesen, nämlich als literarischen Text zu einem literarischen Text“.
Vladimir Vertlib hängt die Latte hoch, wenn er schreibt, derjenige produziere Literatur, der sich mit einem Literaten beschäftigt. Aber Literatur über Literatur als solche anzuerkennen, heißt auch, sich den Regeln des Spiels zu unterwerfen, aus dem der Lyriker oder Romanautor in der Tradition der Moderne nicht selten ausbrechen will. Vielleicht kann man denjenigen, der eine Rezension schreibt – um nicht „Kritiker“ oder „Rezensent“ sagen zu müssen –, am ehesten als jemanden ansehen, der den irren Versuch unternimmt, Maßstäbe zu finden in dem tendentiell maßstabslosen Terrain eines Autors?
Vladimir Vertlib gehört zu den Schriftstellern, die sich aufgrund ihres biographischen Hintergrunds gängigen Maßstäben zumeist entziehen. Ein knapp zweiundvierzigjähriger Mann, der aus Leningrad stammt, im Alter von fünf Jahren mit seinem Eltern aus der Sowjetunion emigrierte und über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg in Israel, Österreich, Italien, den Niederlanden und den USA heimisch zu werden versucht, um letztlich in Österreich eine Karriere als deutschsprachiger Schriftsteller zu machen, braucht sich um seine „Modernität“ wohl kaum zu sorgen. Als deutschsprachiger Autor russischer Herkunft hatte Vertlib im Jahr 2006 die mit Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung finanzierte Dresdner Chamisso-Poetikdozentur inne. Seine fünf Vorlesungen sind inzwischen unter dem Titel Spiegel im fremden Wort im kleinen Dresdner Thelem Verlag erschienen.
Vor einigen Jahren hörte ich Vladimir Vertlib in einem Diskussionsforum in der Halle 5 der Frankfurter Buchmesse zu. Etwas an dem nicht unangenehmen, aber professionell auftretenden Diskutanten ließ mich stutzen. Das zugrundeliegende Unbehagen meinerseits läßt Vertlib am Anfang seiner zweiten Vorlesung die Zuhöhrerin einer seiner Lesungen so formulieren: „Warum spricht denn der so gut Deutsch? Das ist ja gar nicht seine Muttersprache, aber er hat überhaupt keinen Akzent!“ Für mich hatte der Autor mit dem verwirrenden Namen Vladimir Vertlib allerdings durchaus einen Akzent, und zwar einen österreichischen.
Vertlib kam in sehr jungen Jahren nach Österreich. In seiner ersten Poetikvorlesung beschreibt er eindrücklich die verwirrenden, für seine Eltern teilweise verheerenden Auswirkungen dieser von einem antisemitischen sowjetischen System erzwungenen Emigration: die Beleidigungen durch die Nachbarn, die Herablassung der Vorgesetzten während der anfänglichen Putzjobs seiner Mutter, die Ohnmacht des Vaters angesichts der zu erduldenden Ungerechtigkeiten. Die Selbstverständlichkeit, mit der kleine Kinder sich in neue sprachliche Umfelder einfinden, ist für Vertlib jedoch nicht ungebrochen. Er skizziert seine Eltern als sowjetisierte Juden, die erste Generation, die nicht mehr Jiddisch, sondern nur noch Russisch spricht, die jedoch im Grunde heimatlos ist. Insofern ist sein Spracherwerb von vielen Brüchen gekennzeichnet. Während er seine Beziehung zum Russischen als „eine unerwiderte oder nur zum Teil erwiderte Liebesbeziehung“ beschreibt, betrachtet er seinen Umgang mit der deutschen Literatursprache als „Ehe, die aus pragmatischen Gründen geschlossen wurde“.
Aber sind diese Voraussetzungen bereits die Grundlage für das Schreiben oder gar eine eigene Poetologie? Bei Vladimir Vertlib läuft alles darauf hinaus. Anders als etwa Vladimir Nabokov oder Joseph Brodsky konnte sich Vertlib die neue Sprache nicht aussuchen, in die er emigrierte; sie hat etwas Selbstverständliches für ihn. „Die Tatsache“, schreibt er an einer Stelle in der zweiten Vorlesung, „dass ich mir meiner Sprache nie sicher sein kann, dass ich Worte und Formulierungen hinterfrage, die andere mit intuitiver Selbstverständlichkeit handhaben, sehe ich als Vorteil an.“ Auf diese Weise werde, so Vertlib, fast automatisch die Distanz hergestellt, die ein Schriftsteller so dringend nötig hat. „Ich glaube“, sagt Vertlib, „dass die Fähigkeit zur Distanz ein Signifikum von Literatur überhaupt ist.“ Mit der neuen Sprache erschreibt sich Vertlib auch die eigene, fast verschüttete jüdische Identität. Und die Stoffe hierfür zieht er vielfach aus den Geschichten seiner Familie.
Spiegel im fremden Wort hat mehr als nur autobiographischen Charakter. Hier bekommt man wie selten sonst den Eindruck, daß sich das ganze Schreiben vor allem von den Lebensumwegen her definiert. Vertlib bleibt nicht bei den biographischen Facetten stehen, schon weil ihm klar ist, daß „Heimat“ zumal für einen Immigranten ein schillernder, per se mit Fiktion behafteter Begriff ist. Seine Geschichten sind entstanden, wie er schreibt, „aus Erfahrung und Anschauung und aus deren kreativer Ergänzung. Nur so hatte ich das Gefühl, die Welt als stimmiges Ganzes zu erleben.“ Das hat schon fast eine existentielle Komponente.
Allerdings lebt Vertlib augenscheinlich nicht in einer Traumwelt. Mit großer Klarheit kann er beispielsweise einen „einheimischen Autor“ als jemanden charakterisieren, der für seinesgleichen schreibt, und zwar in Ermangelung von signifikanten Fremdheitserfahrungen, die über die Artikulation einer kollektiven Exotik kaum hinausgehen. „Die ‚Wurzeln‘ eines Autors erkennt man an der Art des Humors, vor allem aber an den für die Beschreibung von Gefühlen und Grenzsituationen gewählten Bildern.“ Ähnlich wie nationale Minderheiten, die „Kentauren Europas“ (László Végel), sind die Zuwanderer, zu denen Vertlib ja zählt, in einer Situation der permanenten Anpassung und Rechtfertigung. Glück und Unglück der Zuwanderer und ihrer Literatur liegt in dem Umstand, daß die Standards, aus denen sie herausfallen, von den Einheimischen aufgestellt werden. „Ich fühle mich nur ganz, wenn ich weiß, dass ich mich nie ganz fühlen kann“, schreibt Vertlib. „Meine Ganzheit ist dieser Mangel. Wahrscheinlich ist das meine Chance.“ Damit erklärt er allen vereinfachenden Begründungen für Sprachwechsel und Integration, wie sie auch in der Politik immer wieder gerne diskutiert werden, eine grundsätzliche Absage. Von „Banalisierung“ ist die Rede.
In seinen Poetikvorlesungen ist der Autor ganz bei der Sache, und das bedeutet auch, bei seinen Werken. Am Ende des Buches kommt man nicht umhin zu denken, daß auch der Vertlib „gelesen“ hat, der keines seiner Werke kennt. Trotz seiner Situation der Anfechtung bekommt der Leser den Eindruck, daß der Autor mit sich und seinen Themen im reinen ist. Beispielsweise verwandte Vertlib Aufnahmen, die er im Gespräch mit seiner Leningrader Großmutter Mira machte, für seinen Roman Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur, in dem es um die Erfahrungen einer jungen Lehrerin im von der Wehrmacht belagerten Leningrad geht. Themenwahl und Herangehensweise scheinen sich ganz logisch aus Vertlibs „besonderer“ Perspektive zu ergeben. Doch in dieser Logik steckt auch Auseinandersetzung und harte Arbeit. Als „Schritt auf dem Weg zur Selbstfindung“ beschreibt Vertlib die Gespräche mit Mira, deren Aufzeichnungen 15 Jahre darauf warten mußten, „dass ich mich reif und erfahren genug fühlte, um sie zu literarisieren“.
Diese Auseinandersetzung mit der permanenten Situation des Übergangs und den Anfechtungen seiner Familienhistorie ist jedoch für Vertlib zugleich das Fundament dafür, mehr einzufordern. Manche der zitierten Erzählungen klingen dabei lehrstückhaft, vielleicht weil Vertlib es sich auch darin nicht nehmen läßt, an konkreten Verwerfungen wie etwa in Letzter Wunsch das Wesen seiner Literatur vorzuführen. Hier sollen letztlich – was einem in den besseren Kulturprogrammen tatsächlich begegnen könnte – heutige Deutsche in einer Radiodiskussion Stellung nehmen zu einer liberalen oder orthodoxen Auslegung eines jüdischen Begräbisrituals, was im Grunde absurd ist. Solche Grenzsituationen, und Vertlib versteht es, sie überall zu finden, sind Schaubeispiele für die unzähligen Fallen, die das Leben jedem einzelnen fortwährend stellt. Eindeutigkeit wirkt da wirklich wie eine Illusion.
Das Problem der Eindeutigkeit tritt an dem Punkt wieder zum Vorschein, wo es um Moralität geht. „Gute Literatur ist, wie ich meine, engagierte Literatur“ – solche Aussagen wirken dann nicht wie ein Gemeinplatz, wenn sie einer wie der Chamisso-Preisträger Vladimir Vertlib äußert. In seiner vierten Vorlesung, die nach einem Essay „Der subversive Mut zur Naivität“ betitelt ist, spricht der Autor uns allen aus der Seele, wenn er sagt, man müsse, bevor man anfängt zu schreiben, klären, wo man steht, und sich auch eingestehen, stets involviert zu sein. Es gibt viele, zum Teil sehr kluge und schlichte Einlassungen zu diesem Thema. „Man muss sich bemühen, den eigenen Ansprüchen und Gefühlen, dem eigenen Wahn, nicht auf den Leim zu gehen, und muss sich ihnen doch gleichzeitig immer wieder aussetzen, um nicht Opfer des kühlen Hauchs der Vernunft zu werden.“ An Vertlibs Prosa und Essays läßt sich studieren, wie man mit sich selbst soweit uneins sein muß, um Literatur produzieren, und soweit eins sein sollte, um darüber gewissenhaft Auskunft geben zu können.
„Vladimir Vertlibs erzählte Poetik ist eine Einladung zum Dialog.“ Mit diesen Worten schließen Annette Teufel und Walter Schmitz ihren den Vorlesungen angehängten, rund 50seitigen Aufsatz über Vertlibs „Wahrheit und ‚subversives Gedächtnis‘“. Es ist ein langer Weg, der zu diesem offenen Schluß führt. Er führt auch wieder zurück zum Anfang, zum Schreiben über das Schreiben, zum Forterzählen des Begonnenen. Derjenige hat die besten Möglichkeiten, Literatur zu schaffen, der sich seines Standpunktes als Erzähler in einer stetig sich wandelnden Wirklichkeit und niemals völlig gesicherten Vergangenheit und Erinnerung bewußt ist – so könnte man eine Logik des Dialogikers Vertlib formulieren.
„Die Erfindung des Lebens als Literatur“, so sind die Poetikvorlesungen untertitelt – ein wesentlich passenderes Motto als der verschwiemelte Titel. Es ist eine Literatur, die aus dem Ungenügen der eigenen Erfahrung, dem permanenten Dazwischen entsteht. Kaum deutlicher läßt sich Literatur nicht nur als Beruf, sondern auch als Lebensaufgabe beschreiben, die zugleich eine Lieblingsvokabel der Mulitkulturanhänger mit Inhalt füllt: Toleranz, und zwar als menschliche wie literarische Tugend – also auch dem Rezensenten gegenüber.
p.w. – red. / 8. April 2008
ID 3782
Erschienen als Band 8 der Reihe "WortWechsel". Thelem ist ein Imprint von w.e.b. Universitätsverlag und Buchhandel, Dresden.
Siehe auch:
http://www.tud-press.de
|
|
|
Anzeige:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
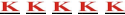
= nicht zu toppen

= schon gut
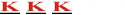
= geht so
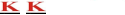
= na ja
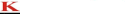
= katastrophal
|