Die 13. BERLIN BIENNALE lädt an vier Orten der Stadt zur Erkundung und Weitergabe des Flüchtigen in der widerständigen Kunst
|

|
Mit einem gewinnenden Lächeln lassen sich Kuratorin Zasha Colah und Assistenzkuratorin Valentina Viviani für die Pressefotos der 13. BERLIN BIENNALE ablichten. Kunst muss nicht bierernst sein, auch wenn sie um ernste Themen kreist. Der postkoloniale Blick ist aus der BIENNALE-Kunst seit 2018, als das KuratorInnenteam aus Südafrika das Motto "We don’t need another hero" ausgab, nicht mehr wegzudenken. Die aus Indien stammende Zasha Colah sieht das nicht ganz so pathetisch. Ihre BIENNALE trägt den Titel "das flüchtige weitergeben". Kunst als etwas Flüchtiges zu begreifen, das erst in der Weitergabe an das Publikum seine ganze Wirkung entfaltet, zielt auf ihre Fähigkeit „im Angesicht von legislativer Gewalt in Unrechtssystemen ihre eigenen Gesetze zu definieren und das Denken auch unter Bedingungen von Verfolgung, Militarisierung und Ökozid nicht abklingen zu lassen.“ So die offizielle Verlautbarung zur Ausstellung, die sich wie immer über mehrere Berliner Kunstinstitute und andere temporäre Orte der Stadt erstreckt. Die 60 künstlerischen Positionen mit mehr als 170 Werken, die über die Hälfte eigens für die BERLIN BIENNALE produziert wurden, verteilen sich auf die vier Ausstellungsorte KW Institute for Contemporary Art und die sophiensæle in Berlin-Mitte sowie den Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart und das ehemalige Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße in Berlin-Moabit. Weitere Positionen ziehen sich auch durch den Berliner Stadtraum.
Der Fuchs, auch in Berlin immer häufiger zu sehen, dient hier als Sinnbild des flüchtigen Wesens, das der deutsche Künstler Daniel Gustav Cramer in seinem Werk Fox & Coyote mit einem kalifornischen Wildtier aus einer anderen Stadtlandschaft in Verbindung bringt. Mit mehreren in Berlin verteilten Bildern des Kojoten bildet der Künstler ein „skulpturales Objekt“ aus verstreuten Einzelbildern, das sich erst in den Köpfen der BetrachterInnen als Skulptur zusammensetzt. So ähnlich versteht sich auch das Konzept der BIENNALE, deren einzelne Ausstellungsorte sich auch erst durch den Besuch zu einem Ganzen fügen. So hat jeder Ort auch eine bestimmte Geschichte, die sich mit den anderen Orten verbinden lässt. Neben den KunstWerken in der Auguststraße, ein für die zeitgenössische Kunst umgebaute Margarinefabrik, wo die BERLN BIENNALE 1998 zum ersten Mal stattfand, sind das die sophiensaele, die als ehemaliger Versammlungsort für Arbeitervereine vom Kampf um Demokratie zeugen. In der Nazidiktatur als Produktionsort für Propagandamaterial missbraucht, waren hier in der DDR die Werkstätten des Maxim Gorki Theaters untergebracht.
Nach der Wende wurden die sophiensaele von der freien Kunstszene als Produktionsort besetzt. Heute ist v.a. die Freie Szene vom Spardiktat des Senats bedroht. Die deutsche Künstlerin Luzi Meyer verbindet in ihrer Audioinstallation Berlin Piece for Voice and Tap Dance Texte, basierend auf Notizen, die sie anhand von Erinnerungen an politische Zusammenkünfte, Ausstellungseröffnungen, Senatsdebatten oder während der Nutzung deutscher und internationaler Medien zu einem lautpoetischen Hörstück verdichtet hat, mit dem Klang eines Stepptanzes auf einem Akazienbrett. Der indische Künstler Amol K Patil spielt in Erinnerung an den Versammlungsort in seiner Installation Burning Speeches flammende Reden von PolitikerInnen ab, bis das Radio raucht.
Eine ähnliche Geschichte besitzt das ehemalige Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße in Berlin-Moabit. 1902 als Erweiterungsbau der Nördlichen Militärarrestanstalt gebaut, fand hier 1916 ein Prozess gegen Karl Liebknecht statt. Er wurde wegen Teilnahme an einer Antikriegsdemonstration zu einer mehrjährigen Haft verurteilt. Unter den Nazis als Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis genutzt, saßen nach dem Krieg hier unter anderem Mitglieder der Rote Armee Fraktion ein. Nun zeigt die BIENNALE hier widerständige Kunst u.a. aus Myanmar, dem Sudan, Südafrika und Indien. Liebknechts Prozess, von ihm als „Komödie“ empfunden, verarbeitet die italienische Künstlerin Anna Scalfi Eghenter in ihrer mehrteiligen Installation Die Komödie! Bereits am Eingang ins Gerichtsgebäude sieht man durch eine Scheibe Liebknechts rote Flugblätter durch eine Windmaschine im Raum herumflattern. In einer Videoarbeit transformiert sie dessen Appelle an die Arbeiter in die Gegenwart und fordert die heutigen VerbraucherInnen auf, sich gegen die modernen Finanzmärkte als Ursache von zyklischen Krisen, Ausbeutung, Konsum und Verschwendung zu wehren.
|

Selection of Prison Paintings von Htein Linm - im ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße | Foto: Stefan Bock
|
Von Krieg, Gewalt, Folter und Verfolgung handeln die teilweise verstörenden Bilder der Künstlerin Busui Ajaw aus Myanmar, die in ihrer fünfteiligen Gemäldeserie The Military State’s Oppression of the Peoples die Verfolgung der Volksgruppe der Akha durch das Militär und bewaffnete Milizen verarbeitet, aber auch Einblick in das Leben des Bergvolks gibt. Ebenfalls aus Myanmar stammt der Künstler Htein Lin. Seine surrealistisch anmutende Selection of Prison Paintings [s. Foto oben] ist mit einfachen Mitteln auf Stoffen während seiner sechsjährigen Haft wegen Anstiftung von Protesten entstanden. Der aus dem Sudan stammende Künstler Elshafe Mukhtar dokumentiert in seinen Zeichnungen, in denen die Soldaten beider Seiten Stiefel als Köpfe tragen, die Kämpfe zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und den Streitkräften des Landes, die seit 2023 im Sudan toben. Einen ironisch-spielerischen Umgang mit dem Verlust von Heimat pflegt die südafrikanische Künstlerin Helena Uambembe. Als Kind vertriebenen Angolaner bäckt sie in einem Videotutorial Schlammkuchen aus Erdklumpen gegen jede Form von Landraub. Daneben hängen Küchentücher mit ironischen Sprüchen wie: „Kann Spuren von Nationalismus enthalten“ oder „Spuren von Rassismus“.
Im Hauptausstellungsort, dem KW Institute for Contemporary Art in der Auguststraße in Mitte, sprühen die künstlerischen Ideen nur so. Die große Halle im Erdgeschoss betritt man über eine Treppe von hellen Backsteinen, die die italienische Künstlerin Margherita Moscardini zunächst an staatenlose, staatenübergreifende und extraterritorialen Organisationen und Nationen wie Universitäten, Indigene Gruppen und autonomen Regionen gescheckt hat. Als Spende zurückgeschickt ergeben sie nun zusammen ein Monument, das niemandem gehört und einen unbegrenzten Zugang für alle symbolisiert. Zum Verweilen lädt die Raum- und Klang-Installation der Künstlerin Anawana Haloba aus Sambia ein. Aus skulpturalen Lautsprechern erklingt die experimentelle Oper Looking for Mukamusaba, die an mythische und historische weibliche Persönlichkeiten Sambias erinnert.
|

Costume avvoltoio, Mulino di Trump von Piero Gilardi - im KW Institute for Contemporary Art | Foto: Stefan Bock
|
Im 1. Stock fallen einem sofort die Figurengruppen aus Textil von Chaw Ei Thein aus Myanmar auf. Sie beschreiben Szenen künstlerischer Proteste gegen Myanmars Militärregime. Sie gehen einen Dialog mit den karnevalesken politischen Skulpturen des italienischen Künstlers Piero Gilardi [s. Foto oberhalb] ein. Ein Pleitegeier, die EZB als feuerspeiender Drache, eine Trumpmühle mit Raketenflügeln oder der italienische Industrielle und Fiat-Boss Gianni Agnelli als Gerippe, Gilardi macht sich lustig über die Mächtigen der Welt. Ebenso ironisch aufgeladen wie raumgreifend ist der riesige Büstenhalter (El Corpiño), den die argentinische Künstlerin Kikí Roca gemeinsam mit dem Frauenkollektiv Las Chicas del Chancho y el Corpiño geschaffen hat [s. Foto unterhalb] . Die Künstlerinnen bieten hiermit der argentinischen Krise die Brust. Sehr witzig auch das AktivistInnen-Kollektiv Panties for Peace aus Myanmar, das Pakete voller Höschen an hochrangige Funktionäre Myanmars geschickt hat, da nach einem Aberglauben die Berührung von Frauenunterwäsche angeblich die Manneskraft schmäler soll. Ein Defizit an kritischem Vorstellungsvermögen attestiert der indische Comic-Künstler Sarnath Banerjee der westlichen, neoliberalen Welt in seinen Bildergeschichten, die er an Lesetischen auch noch mit Geschichten, die man über Audiostationen hören kann, mischt.
|

El Corpiño von Kikí Roca und Las Chicas del Chancho y el Corpiño - im KW Institute for Contemporary Art | Foto: c) Stefan Bock
|
Die künstlerische Protestkultur der Welt ist vielgestaltig und bedient sich nicht selten der Kultur, die sie kritisiert. Die popkulturelle Figur des Jokers aus den US-amerikanischen Batman-Filmen benutzt der im niederländischen Exil lebende Künstler Sawangwongse Yawnghwe aus Myanmar in seiner Video- und Rauminstallation Joker’s Headquarters. Gesamtkunstwerk as a Practical Jok im obersten Stock der KunstWerke. Hier klärt er über die Verwicklungen von Finanzwelt, Rüstungsindustrie, Militär und Politik auf und bereitet sich auf die Übernahme der Weltherrschaft vor. Wie versteckt ironischer Protest in einer Diktatur zu Irritationen führen kann, zeigt das Video Potknięcie (Stolpern), der 1973 gegründeten polnischen Akademia Ruchu (Bewegungsakademie). In einer ahnungslosen Menschenmenge vor dem Büro der KP Polens gerieten dabei immer wieder Mitglieder der KünstlerInnengruppe ins Stolpern, um so den festgefahrenen „Lauf“ des alltäglichen Lebens zu stören. Und auch Exterra XX, eine feministische Künstlerinnengruppe aus Erfurt, übte bereits in den 1980er Jahren den freien Gang außerhalb staatlicher Kunstinstitutionen. Einige ihrer Werke sind in den KunstWerken und dem ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße zu sehen.
Wer dann noch nicht genug hat, gehe in den Hamburger Bahnhof. Das Museum für Gegenwartskunst ist immer einen Besuch wert. Die BERLIN BIENNALE stellt dort im Ostflügel des Hauses weitere fünf Kunstpositionen vor, von denen besonders die mehrteilige raumgreifende Videoinstallation Halmang der südkoreanischen Künstlerin Jane Jin Kaise zu Meeres-Mythen und Ritualen für Meeresgottheiten beeindruckt. Die indische Künstlerin Zamthingla Ruivah Shimray erinnert mit ihrer Installation aus bestickten Wollsarongs an die Vergewaltigung und Tötung einer jungen Frau 1986 durch indische Offiziere. Ihr Landsmann Vikrant Bhise zeigt in seinem mehrteiligen Gemälde We Who Could Not Drink auf den eingeschränkten Zugang zu Trinkwasser in der Millionenstadt Mumbai.
Die Ausstellungen an den vier Orten werden noch in der Veranstaltungsreihe "Encounters" durch Begegnungen mit den KünstlerInnen, Lesungen, wissenschaftliche Vorträge, Tribunale, kollektive Gedenkspaziergänge und sogar kleine Comedyabende flankiert.
|
Stefan Bock - 27. Juni 2025
ID 15331
Weitere Infos siehe auch: https://13.berlinbiennale.de
Post an Stefan Bock
Ausstellungen
Biennalen | Kunstmessen
Kulturspaziergänge
Museen
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:
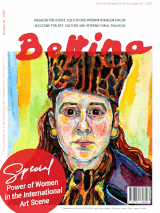

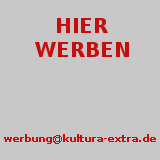
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk

= nicht zu toppen

= schon gut
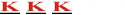
= geht so

= na ja

= katastrophal
|