|
|
 |
|

Portrait von Wangechi Mutu, Foto: Chris Sanders © Wangechi Mutu
|
Montagen Epiphanien
oder die Haut auf dem Spiel
|
My Dirty Little Heaven Wangechi Mutu in der Deutschen Guggenheim und einer Blindenführung da hindurch gefolgt.
Teil 2: Das Übergehen
Text: Gerald Pirner
„Man sollte weder Dinge noch Menschen anschauen, man sollte nur in Spiegel schauen, denn Spiegel zeigen nur Schatten.“ (Oskar Wilde)
„laß die / dinge liegen; leg / die worte dazu, aber laß die / dinge liegen. (Inger Christensen)
Mit kleinen Schalen wie diesen hier arbeite sie immer. Bildausschnitte aus Zeitschriften Magazinen und Büchern darin gesammelt. Vielleicht Jahre zuvor bereits sie ausgeschnitten und ohne eine Verwendung vor Augen. Kriterienloser Stich der Schere in oberflächlich Haftengebliebenes. Bilder aus Kontexten gedrängt. Teile von Bilder aus Ganzem und was in ihnen an Darstellung an Bericht visualisiert - im Schnitt abgetrennt und verworfen. Unter ihren Bilderspuren verlorengegangene Bedeutung und verlorengegangen was in ihnen bezeugt. Von Geschichte getrenntes Geschehen. Ohne Zeit Bild im Begriff bloßer Beschreibung. Nur mehr für sich. Aber vielleicht gehe er zuweit, wie er sich fragt, lasse ihre Eigenzeit außer Acht, den Moment die Stimmung das Gefühl in welchem das Bild aufgefunden in welchem es herausgeschnitten in welchem es abgelegt in welchem es aus dem getrennt wohinein es ursprünglich gesetzt. Gewichtungen Stimmungen in ihrem Aufbewahren aufgehoben. Eigenzeit des Gefühls des Denkens auf Anderes übergehend Anderes aufnehmend. Eine Abteilung Tiere eine Abteilung Pflanzen eine Abteilung Menschen eine Abteilung technisches Gerät. Und freilich weiter, freilich tiefer gehen. Den Schnitt viel tiefer geführt ausgetrennt ausgelöst ins Partiale ins Partikulare: eine Schale Gesichter eine Schale Pupillen eine Schale Wimpern eine Schale Augenbrauen eine Schale Nasen eine Schale Lippen eine Schale Zähne Arme Beine Finger Nägel Haare. Und dann wohl hineingehen ins Innere, wie er denkt, Organe etwa. Nach Organen die Schalen die Schalen nach Organen aufgeteilt und er zählt sie auf für sich und die Schalen vor-gestellt und überquillend von all dem was über Jahre gesammelt sich angesammelt von ihr dahinein gesammelt auch die Organe in Schalen.
Davon aber habe sie nicht gesprochen, wie er denkt. Nur das Äußere des Körpers habe einen Niederschlag in ihrer Aufzählung gefunden. Das Körperaußen das was zum Körperbild gehöre das was hier als Körperbild zerschnitten. Jetzt aber die Schalen, wie gesagt. Drei an der Zahl hier und er nimmt sie vom Rolltisch auf dem auch der Reliefplan des Raumes, durch den sie mit der, die sie führt gegangen. Perlen in der ersten Schale Glasstaub in der zweiten und kleine Steine in der dritten.
Was aber denn nun zu sehen, sie gefragt. Was es aber auch immer sei es solle vielleicht zuerst aus der Totale betrachtet werden: „Aus einigem Abstand heraus, wenn Sie so wollen.“ Schritte. Eine tritt heraus löst sich aus dem Kreis. Sie hält inne. Ein junges starkes Mädchen, sagt sie, und fortfahrend: eine Art Medusa mit Schlangen, die aus dem Kopf herauszüngeln. In der Hand halte sie etwas, das stark blute, das aussehe wie ein Schädel und während sie spricht und während sie wohl dabei hinsieht, entfernt sie sich, nähert sich dem was sie betrachtet, wovon sie spricht wovon her sie spricht. Das hört er nicht. Hört nur wie sie geht, wie sie nach vorn geht von ihm aus und da wo sein Gesicht hingewandt. Hört wie sie sich dorthin entfernt. Und gefragt von der die sie alle führte, ob sie es denn bemerkt habe, dass sie sich immer mehr genähert habe sich immer mehr dem Bild nähere: „Sie sind immer näher gegangen, immer näher drangegangen“, sagt sie, „haben Sie das bemerkt?“ Ein Stück Schädel habe sie in der Hand, wie gesagt, Schädel eines Tieres, wie sie denke, und dass der so eingearbeitet, dass er von weitem gar nicht zu sehen. Nein, verbessert sie, zu sehen schon aber nicht zu erkennen von dort wo sie vorher gestanden. Der Rücken des Mädchens, nach rechts hin sei er ausgerichtet, wie eine andere sagt. Die Schenkel ein wenig geöffnet sitze sie mit abgespreizten Beinen in einem Kindersitz und sitze so wie im Erwachsenenalter es unbequem werden würde, so eine dritte. Den Arm habe sie angewinkelt und vor sich eben dieses Etwas haltend wie einen Spiegel, und er fragt sich, ob sie das tatsächlich gesagt habe oder ob er das denke, ob sein Bild sich da eingeschlichen habe, freilich nicht sein Bild, das Bild des Blinden, eher das Bild, das er sich mache, das er sich gemacht habe aus dem was er gehört.
|

Wangechi Mutu, The Bride who married a Camel\'s head, 2009, Mixed media, ink, collage on Mylar, 42 x 30 inch, Foto: Mathias Schormann © Wangechi Mutu und Susanne Vielmetter Los Angeles Projects
|
Die Hälfte des Gesichtes von einem schwarzen Vogel gebildet in dessen Brust ein Loch geschnitten und ein menschliches Auge schaue da hervor. Daneben das zweite menschliche Auge und beide Augen zusammen ließen den Vogelkörper übersehen ließen ihn hinter einem menschlichen Gesicht verschwinden, das bei näherer Betrachtung gar nicht vorhanden. Erneut verschwinde der Vogel, so die Erfahrung der Sehenden entferne man sich nur ein ausreichendes Stück vom Bild von der Collage, die der Abstand homogen erscheinen lasse. Was in der Hand da gehalten, das blute sehr stark als wäre es getroffen und dorthin führe ein Unterarm, der zunächst wie eine Vase erschienen, sich in ein Auspuffrohr verwandelnd, wenn Mensch nur nahe genug: „Freilich müssen Sie wissen wie ein Auspuffrohr aussieht sonst bliebe das ein Gefäß.“ Der Ellbogen von einer Motorradgabel gebildet die Füße eine Mischung aus Rollerskates und technischem Gerät. Teile des Körpers des Gesichtes aus Teilen von Tieren von Pflanzen von Gerätschaft aus Plastik und Metall. Eine menschliche Hand mit krallenartigen Nägeln schieße aus dem Hinterteil hervor. Einen Kamelschädel halte sie in der Hand, sagt eine, und dass sie die Region darauf gebracht habe aus der die Künstlerin stamme, und der Titel belege, so eine andere, dass dies zutreffe: Braut die einen Kamelkopf heiratet.
Jung sei das Mädchen und mit noch kaum ausgebildeten Brüsten. Zwischen den Schenkeln ein roter Fleck, eine Blüte, wie eine meint, Blut eher, die andere. Blut und Blüte und alles dazwischen. Ein Farbfleck als Verweis. Verweis auf Menstruation Verweis auf Entjungferung Verweis auf Beschneidung Verweis auf Geburt. Und von hier aus und von weiteren Besucherinnen den Schädel des Kamels als Embryo erkannt, so stark wie das blute: eine Abtreibung. Nichts aber an all diesen Gedanken lässt die Arbeit sich abschließen. Den Blick des Betrachters der Betrachterin entzweiend. Metapherverwucherung. Eine Brosche die das Mädchen trägt wie eine Parabel: Unterpfand der Hand. Zwischen ihren Fingern sie jetzt und sie gibt sie ihm in die Hand. Ein Stück Wirklichkeit aus der Collage genommen und in Umlauf gebracht wie das Wertäquivalent in seinen Kreislauf. Bezahlt werde letztlich auch dafür und womit das zeigt immer das Ende. Aus Perlen Glasstaub und Steinchen eine Brosche geformt, die in das Bild des Mädchens eingepasst, die sie trägt.
Zu einer jeden Ausstellung in der Deutschen Guggenheim werde der jeweilige Künstler die jeweilige Künstlerin gebeten eine von den Besucherinnen zu erwerbende Edition herauszugeben, die im Museumsshop dann käuflich zu erwerben. Was er nun zwischen seinen Fingern halte sei Teil eines Hartplastikpuzzles auf das Braut, die einen Kamelkopf heiratet aufgedruckt. Die Brosche, aufgeklebt auf eben solchen Hartplastikträger, versehen mit einem Loch für die Kette und eingepasst in das Puzzle sei nach Material und Form die gleiche wie die in der Collage. Die Collage durch einen „realen“ Gegenstand aufgebrochen der hinein in sie montiert. In seinem Double verlässt er sie wie ein in Unruhe geratenes Symbol das in Umlauf gesetzt weil es zu wandern habe wie die Ringe des Kula-Tausches in Melanesien. Herausgenommen aus einem zerrissenen Bild das nur die Trägheit des Auges zusammenhält kündet seine Lebendigkeit vom Zerfall. Spitzig ja scharf zwischen den Fingern wie er spürt und zugleich und dazwischen glatt und unerklärlich feucht und kühler die Perlen als der Träger der auf der Haut liegt, dass die das nicht bemerkt. Unter Fingerbewegungen in ein lebendiges Wuchern gespürt. Metastasisches Ausplatzen von Zellen. Himbeerformartige Mutation. Süße Metastasen zum Tod, das einzige was da lebt.
All seine Betrachtungen vom Bild bei sich gesammelt und so unabschließbar diese wie die Welten seiner Teile, die der Rahmen nur provisorisch beieinander hält. Auch keine anderen Bilder hält dieser ab, das Gewucher der Fragmente in seinem Innern zu vermehren. Was eigentlich es ausmacht das bricht das Bild in seinem Innern auf widersprechend der Vorgabe des Rahmens etwas abzuschließen. Hineingezogen wird der in all die Fugen die collagierten Risse aus dem das an Unfertigem an Unabgeschlossenem herausquillt, das er sonst doch verschließt ja versiegelt.
|

Edition 51, Wangechi Mutu, The Bride Who Married a Camel’s Head (Detail), 2010
|
Übergriff und Verklärung
Einem Virus nicht unähnlich verändert der Eingriff der Montage das gewohnte Bild einer Erscheinung indem das was ihm zugefügt bisher Unbeachtetes Unbegriffenes hervortreten lässt als zeige sich in der Gewalt, die dem Bild angetan der eigentliche Kern dessen was zuvor als erkannt erachtet. Wenn etwa John Heartfield Ende der 20er Jahre in Hitlers wie von einem Röntgengerät durchsichtig gemachtem Thorax eine Wirbelsäule aus Reichsmarkstücken montiert, so erscheint dabei nicht nur das Kapital als Rückgrad des Nationalsozialismus. Geradezu gleichnishaft wird hier die Funktion der Montage selbst ausgeleuchtet. Während in der Montage also etwas vermeintlich Begriffenem eine Art Parasit eingepfropft der entlarvt der aufklärt – optimale Kunstform für Propaganda und Agitation – bleibt dergestalt „aufgeklärtes Bewusstsein“ auch verändert auch revolutioniert, nichts denn die Abgeschlossene Welt einer Aussage. In stärkstem Kontrast der Montage gegenüber bringt die Collage wiederum die ganze Welt in Bruch, lässt nichts an Teil oder Ganzem im Abschluss von Begriffenem zur Ruhe kommen: je für sich ein jedes ihrer Teile seine Welt wie seine Geschichte bei sich haltend, tritt ihr Kontext in der Verfugung zum Bild nur umso stärker hervor und mit ihm das was im Ausschnitt zuvor von ihm getrennt. Widersprüche Reibungen Unvereinbarkeiten – zentrifugal gleichsam treibt die Collage in der Nähe betrachtet auseinander. Ort und Welt verpflichtet, versichert die Montage ihnen Stand, worin Zeit in gewisser Weise in Erkenntnis erfüllt. In der Collage aber Zeiten aus Welten gelöst und die in Fragmenten mit anderen verfugt – übergreifende Bewegung von zerstücktem Ganzen, dem eine Welt viel zu eng und die setzt auch kein Rahmen mehr durch.
Während in der Montage der Schatten immer nur der Schatten des Anderen (Schatten aber auch einer anderen erreichbaren Welt) verkriecht in der Collage der Schatten sich in die Risse in die Schnitte ihrer Teile der Fugen ihrer Bruchstücke ins Unverfugbare ins Unverfügbare alle Teile in ihrer Geschichte immer anwesend belassen. Diametral freilich auch die Collage dem Virtuellen entgegenstehend dessen Bemühungen ja letztlich darauf gerichtet die Schatten in Doppelgängern oder Avataren zum Verschwinden zu bringen. Während also unter dem Schnitt der Montage der Schein, zumal der des Ganzen gebrochen, bringen Wangechi Mutus montierte Pflanzen- Tier- und Menschenteile mit Ausschnitten aus technischem Gerät gepaart, solchen Schein gerade hervor und, unter Näherkommen, das vermeintliche Körperbild in organische und anorganische Partikel zerfallend, wird die Frage, was denn und mit welcher Kraft solche Integration bewirke, ihre Antwort irgendwo zwischen einer dunklen Farbgrundstimmung und der Voreiligkeit menschlicher Wahrnehmungsgewohnheiten finden. Was hier als Schein sich zeigt einerseits menschliche Wahrnehmung selbst andererseits aber auch seine Wiedereinführung ins Kunstwerk als dessen zentraler Funktion, nur, dass seine Entlarvung wie von der Avantgarde einstmals betrieben, gleich miterscheint. Sich auf den Schein einlassend, ja ihn hervorbringend zugleich demaskierend ohne sich mit dem Scheitern objektiver Wahrnehmung zufrieden zu geben. Feiern des Scheines Feiern der Partialobjekte Feiern ihrer Geschichte ihrer Initiationen Feiern ihrer Opferungen Feiern ihrer Laszivität ihrer Erotik ihrer Gewalt ihrer Vergänglichkeit ihres Zerfalls. Aufdecken des Scheins um ihn zu bejahen um ihn mit der Wirklichkeit zu vermählen wie dieses lasziv die Lippen geöffnete Mädchen mit einem Kamelschädel. Vermählung von Leben und Tod von Zerfall und Verführung. Entlarvung des Körperbildes als sprachverbürgte Metapher als Fetisch und Fetisch des Ganzen. Aufdeckung der Wahrnehmung als immer schon zerbrochen um gerade ihre Zerbrochenheit zu bejahen. Aufdeckung des Sehprozesses in seiner Nähe zum Taktilen und dessen Berührung. Unter der Hand Blindheit und Sehen ganz nah. Nicht vertrieben wird der Schein nicht die Imagination. Gebrochen aber sind sie und ganz materiell und ganz handgreiflich. Zwischen Fragment und dem was es „übergeht“. Ästhetik als eine Ethik bei Wangechi Mutu sichtbar wie spürbar, eine Ethik deren Denken von der Wahrnehmung als immer schon zerrissen ausgeht um wieder zu ihren Rissen zurückzukommen. Den ganzen Menschen den gibt die Natur nicht her. Wo er aber postuliert, da errichtet sich sein Bild immer nahe am Pogrom und an Massenmord.
|
In der Reproduktion der Collage aber wird die Fragmentiertheit der Collage aufgehoben und das Bild vollstreckt an ihr dieselbe Homogenisierung die es auch an Welt und Gegenstand vollstreckt. So gerät der Aufdruck der Collage auf den Kunststoff mit dessen Zerschneidung zum Puzzle zur Kolportage gelingenden Wahrnehmungsurteils an dessen Ende nackte und nach einfachen Regeln erreichbare Identifizierbarkeit gesetzt, die keinen Rest mehr übrig lässt der von Anderem spräche denn von Begreifbarkeit. Verliert unter der Hand das Werk in erzwungener Nähe des horizontalen Puzzlegewebes sein Spiel mit dem Schein – die Teile der Collage im Ganzen der Reproduktion aufgegangen das ja von nichts mehr durchfurcht – gerät dem Betrachter die Betrachterin mit der Brosche als Puzzlestein etwas zwischen die Finger, dessen stichige Geschwulst aus Perlen Glasstaub und Steinen einer einfachen Aufhebung in der Reproduktion sich zu widersetzen scheint. Scheint. Denn was hier Schein der Reproduktion und Wahrnehmung „entlarvt“ ist als Double hierfür doch gar nicht „autorisiert“. Der verlorene Schein der reproduzierten Ausschnitte reproduziert als Schein des Ganzen vom Schein des Echten eines Doubles vorgeführt.
Krankhaftes Anrühren einer „Todesmetapher“ in einem Material mit Halbwertzeit über zig Menschengenerationen hinaus. Und dennoch: inhaltslos der Einspruch dieses Dinges entleert in synthetische Zeitlosigkeit. In keinem Kontext wird dies Ding gehalten. Heraus fällt es aus der Collage wie aus dem Puzzle gleichermaßen. Als Schmuck getragen als Wert erworben wird es Zeichen der Austauschbarkeit also Zeichen schlechthin wird es gleichsam äqui-valent. Die Unerfassbarkeit des Dinglichen gegen Verdinglichung eingetauscht. Verwandlung von Kunst in Schmuck. Verwandlung von Kunst in Geld. Verwandlung von Kunst in die Austauschbarkeit der Ware und im Preis des Puzzles all dies ausgezahlt.
|

Edition 51, Wangechi Mutu, The Bride Who Married a Camel’s Head, 2010 © Deutsche Guggenheim
|
Transfigurationen
Dann aber der Geruch. An manchen Tagen unerträglicher Gestank. Dann greife das Wachpersonal ein, wische den Boden leere die Näpfe. Verschimmelter Talg vielleicht. Ranzige Butter. Ja eher etwas von Tieren von deren Fett. Unsauberes. Ungewaschenes. Riechbarer Zerfall in verschiedenen Stadien. Etwas saures dazwischen. Essig etwa. Das auch, das rieche er auch, wie er denkt. Aber noch etwas anderes, schmieriges zähes. Essig sei dagegen durchsichtig ja luzide, wie er denkt. Er schmeckt diesem Wort nach. Mühelos sauge sich ein Schwamm etwa mit ihm voll dabei etwas lehmiges an Geruch abgebend - bräunliche Grottenerdigkeit. Hier nicht. Was hier sich einmische ein eher süßlicher Stich, eine kristalline Verklebung. Milch wäre etwas von solcher Art: eine Emulsion von Widersprüchen eine Emulsion als Paradox. Kaum aber Adjektive die dem Sinnlichen die Mischung begrifflich auseinanderhielten. Mit Namen sie fast alle wie verklebt als verflüchtigten sie sich sonst und als hätte dem entgegengewirkt werden zu müssen. Zur begrifflichen Einordnung sprich Ortung des Geruchs erschienen ihm Eigenschaftswörter hier eher unzuträglich. Nein, eher verstärkten diese an kein Material gebundenen Eigenschaftswörter - so wenige die Sprache davon hierfür auch bereit hält – nur noch die Intensität und eine von ihm ausgehende Unsicherheit, woher das was da ungehindert in den Körper einströmt denn nun eigentlich rühre.
Ungehobelte Leistenbretter kniehoch zu Stellagen genagelt an die Türen der Verschläge ihn erinnernd in welchen die Großeltern Hühner gehalten, nur dass deren Geruch damals trockner und wärmer. Wie viele Stellagen sie wisse es nicht man könne sie aber abzählen, so die die sie durch die Ausstellung führte. Alle diese Gestelle jedenfalls in eine Reihe gestellt und diese sei über 13 Meter lang. Auf 3 Meter überkopf in schwarzen Gummimanschetten 40 Flaschen mit der Öffnung nach unten gehängt und versehen mit Dosierstöpseln so dass unablässig Flüssigkeit aus ihnen herabtropft auf den Boden auf die Stellage und in emaillierte chinesische Metallnäpfe auf deren Leisten. Aus einem Teil der Glasflaschen Wein aus dem anderen Milch. Aller Anfang und Ende zwischen diesen beiden „ganz besonderen Säften“ von abendländischer Liturgie und Ikonografie aufgerufen und – über Kreuz gleichsam – die mögliche Erlösung im hereintretenden Messias. Das Wort „das Fleisch ward“ jetzt in einer Konstellation von Dingen erinnert deren Begriffskonnotationen gleichermaßen an die Sinnlichkeit der religiösen Erfahrung gemahnen wie an die Vergänglichkeit des Fleisches das solche lebt. Körperlichkeit der Laktation wie des Abendmahls. Körperlichkeit des Wortes das „unter uns wohnte“. Der heiligen Wunde Blut so sehr geschmeckt wie Angela von Foligno einst nackt am Altarbild des Herrn. Die Brüste der Gottesmutter in mittelalterlicher Darstellung auf den Sohn übergegangen der als Kind die Gemeinde stillt. Sinnlichkeit als „Gedächtnis der Zukunft“ birgt in sich aber vor allem die Ahnung des Zerfalls und die, wo nicht erneut sie eine Abbildung für sich gefunden – vom Fernsinn also nicht vom Leib gehalten, stattdessen sogar noch vom „niedrigsten der Sinne“, dem Geruch, eine Rückkehr in die Erhabenheit musealer Atmosphäre verhindert – lässt diese Installation aus Holz Blech Glas aus vergammelten Wein und Milch zu einem Symbol werden, das der Transsubstantiation einen Gottesbegriff entgegenstellt dessen absolute Unerreichbarkeit keine Materialität mehr zu nahe kommt. Andererseits gewinnt was hier an Flaschen Holzleisten und Blech zusammengestellt seinen ästhetischen Charakter zuallererst aus der Brechung religiöser Symbolik gegen alltägliche Hilfsbedürftigkeit gegen das alltägliche Sterben gegen den alltäglichen Tod. Alltagsgegenstände gleichsam überblendet – Weinflaschen als Krankenhaustropf und die Bretter an Stellagen erinnernd, auf denen in Uganda Leichen gebettet, wie sie sagt, und eine Erfahrung Wangechi Mutus hier zitierend. Die Totenbretter seiner Kindheit vertikal an den Zäunen, denkt er. Das ganz banale Elend das ganz banale Verrecken an ganz banalen Alltagsgegenständen die den Glauben zurücktranszendieren ins Menschliche und eine ganz andere Menschwerdung Gottes in welcher die Liturgie als Blasphemie erscheint als Verhöhnung des Fleisches und des Wortes.
Blechnäpfe mit Blumen in ihren Senken in Reihen aufgetischt wie zum Kitamittagessen oder zum Abendmahl von Leonardo – ästhetischer Wahrnehmung und ihrer Unentscheidbarkeit im Geruch ganz aufdringlich widersprochen wo das Olfaktorische eben nicht so leicht sich in ästhetische Negation biegen lässt. Vielleicht ein Versuch vielleicht eine Versuchsanordnung. Vielleicht ein Versuch wider allzu schnelle kritische Überformung. Vielleicht ein Versuch den Schnitt zwischen Ästhetik und Alltagswahrnehmung noch einmal und ganz anders zu denken. Vielleicht ein Versuch wider Kategorisierungen und Hierarchisierungen. Rückkehr der Negation und das Readymade dennoch nicht aus dem Gedächtnis verloren. Eine Autorität des Körpers zwischen beiden gewinnend ein spürbares denkbares Nein gegen Verhältnisse, eine gesellschaftliche Praxis der Negation, die Konstruktion und Konstruiertheit der Wahrnehmung dabei aber nicht vergisst.
|
|

Blick in die Ausstellung, Wangechi Mutu: My Dirty Little Heaven, Foto: Mathias Schormann © Deutsche Guggenheim
|
Die Blindenführung wurde von Silke Feldhoff in Zusammenarbeit mit dem ABSV gestaltet.
|
Gerald Pirner - red / 27. Juli 2010
ID 00000004733
Weitere Infos siehe auch: http://www.deutsche-guggenheim.de
|
|
|
Anzeigen:



Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk
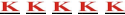
= nicht zu toppen

= schon gut
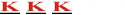
= geht so
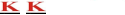
= na ja
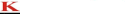
= katastrophal
|