
Blick in die Ausstellung, Wangechi Mutu: My Dirty Little Heaven, Foto: Mathias Schormann © Deutsche Guggenheim
|
Raum Dichten
oder das Gedächtnis des Materials
|
My Dirty Little Heaven Wangechi Mutu in der Deutschen Guggenheim und einer Blindenführung da hindurch gefolgt.
Teil 1: Das Material
Text: Gerald Pirner
„Nicht die „teilweise Unsichtbarkeit“ des Baumes verstellt nebulös den erwähnten Blick des Beobachters auf den Baum, sondern es schweben Phantome, Gespenster, ätherische Körper um den Baum, der unerreichbar wird. Solche baumartigen Gottheiten gibt es in allen Mythologien, auch in der jüdischen und griechischen, und aus ihnen quillt unentrinnbar unsere Weltanschauung. […] Dem Beobachter am allernächsten und infolge dessen am leichtesten abzuschaffen ist konkret das der Lunge. Ich sehe keinen Baum, sondern die grüne Lunge und sehe sie ebenso morphologisch wie funktionell. […] Andere Gespenster klammern sich noch enger an den Baum, zum Beispiel die Gespenster der „Fruchtbarkeit“, des „Phallus“, des „Lebensbaums“.“ (Vilem Flusser)
Seit der Raum erfunden war er immer zuallererst Ausgrenzung. Zwischen Innen und Außen scheidend, macht in seinem Inneren er das Verhältnis zwischen beiden aber auch erfahrbar. Wenn etwa der Hall in der Kathedrale, nachdem er unzählige Male gebrochen und ineinandergeschoben, sich aus dem Endlichen ins Unendliche geradezu hörbar verliert, erscheint zwischen den Mauern eine Unerreichbarkeit in Zeit und Transzendenz in einem kurzen Moment wie aufgehoben. Vollkommen entgegengesetzt diesem sakralen Raum und seinem Versprechen, brechen die Mauern des Holocaustturmes im Jüdischen Museum den Schlag des Blindenstockes in ein Vielfaches von Peitschenhieben und, in Schnittschärfe diese, auf den Hörenden einschlagend ohne dass der zu entkommen wüsste. Stahlversiegelt das Außen. Herabgestoßen alle Transzendenz in himmelloses Schwarz.
Ein anderer Raum. Ein Kunstraum. Die Deutsche Guggenheim. Terrazzoboden sonst und oft der ergangen. Unter den Schritten, die der sonst gegen die Wand schmeißt, treten die Wände herein und mit ihnen das, was sie draußen halten sollen. Wenn, wie im Blinden, kein Bild vorgaukelte er sei da, flüchtet der Raum selbst sich dorthin, zurückgezogen von dem, was in ihm sich tut.
Jede Veränderung im Raum verändert auch das sich in ihm darstellende Verhältnis von Innen und Außen. Derselbe Raum, dieser Kunstraum, ein vollkommen anderer Raumzustand – ein Kunstraum jetzt so wörtlich wie metaphorisch. Wände tastbar mit Filz bespannt eingezogen, den Raum breitseitig komprimierend. Weitläufig gespürt und doch akustisch/olfaktorisch verdickt. Nichts geht da mehr raus. Nichts zeigt mehr an, dass es da überhaupt noch ein Draußen gibt. Alle Geräusche der Körperbewegungen bei sich. Nichts was von ihnen loskäme in einen Hall oder ein Echo. Ein Raumzustand träge gesättigt, vollgesogen und zäh doch zugleich alle Körper in ihm durchdringend ohne selbst in eine Bewegung geraten zu müssen. Das Bellen eines Hundes eingeschlossen in seinem Hall und so punktuell der, dass er an den Fremdkörper des Ganges in Mark Z. Danielewskis Das Haus erinnert, an dem Moment wo am Echo der Kinder zu hören, dass da etwas nicht stimmt, weil es hier kein Echo geben kann. Der Boden ein Grund der nachgibt. Irgendwo zwischen Morast und anhebendem Hemmtraum. Verlorene Festigkeit und doch zugleich zuviel davon. Auslegware vielleicht Linoleum. Die Hand nach oben streift über Klebeband an verklebtem Filz. Stehender Geruch. Ein verstaubtes Teppichlager sagt einer und eine andere dass da was fault.
Mein Kleiner Dreckiger Himmel – die erste große Ausstellung der afrikanischen Künstlerin Wangechi Mutu.
Mein Kleiner Dreckiger Himmel – eine Expedition hinein in Grenzpfade der Wahrnehmung, zu den Rissen zwischen ihren Registern.
Eine kleine Gruppe von Blinden und Sehenden um eine Frau, die sie führen solle. Im Anfang hier ein taktiler Plan. Der Raum darauf reliefartig abstrahiert wie es ein Begriff tut, wenn er durch überbordendes Wort hindurch Schneisen schlägt um zu erreichen was in ihm angelegt. Auf einen Holzkasten das Plastikrelief gelegt, nachdem es von allen ertastet und sein Bild sich in blinde Imagination eingeschrieben, vor das sich stellend – Vorstellung eben – was als dichtes Geräusch- und Geruchgewebe seine Durchquerbarkeit erst noch erweisen müsse. Auf einem Kasten also der Plan und das Gestell mit Rollen versehen und vor sich hergeschoben von ihr, die führt, die vorangeht, der Plan des Raumes durch den Raum hindurchgeschoben wie eine Monstranz vor einer Prozession.
|

Blick in die Ausstellung, Wangechi Mutu: My Dirty Little Heaven, Foto: Mathias Schormann © Deutsche Guggenheim
|
Leben und Überleben
Die eigentliche Magie aber das ist das Wort selbst. Die eigentliche Magie das ist das Wort aus der Stimme. Bildlos von keinem Begriff in Grenzen gestaucht, ruft im Körper des Blinden es eine Unzahl von Bildern hervor, die nichts Gesehenes zurückscheucht ins Fleisch. Überbordendes von Wort und Stimme enggeführt im Begriff, den das Wort hindert in Identifikationen zu scheiden. Eher dem was gerufen provisorische Räume geöffnet in unentwegter Verschiebung. Unbehauste Empfindungen von Hören und Riechen etwa, in Andeutungen gestreift sie verstärkend, ohne sie in einem Raum gleich zu verräumen. Reichweiten und die Kraft die sie sinnlich belässt ohne sie Sinn werden zu lassen.
Die Stimme also. Ihre Worte. Nichts Dozierendes in ihnen. Kein pädagogisches Surplus. Eher etwas gestreift das sich verwandelt. Die Stimme das Wort ein Raum. Ein Versteck vielleicht. Vielleicht die letzte Zuflucht. Zukunftlos jedenfalls ohne Ausweg ohne Entkommen. Der einzige Raum. Der letzte Raum. Ein Keller etwa. Ja vielleicht ein Keller. Bräunliche Wände und die Worte in leicht angewiderter Stimme als sprächen sie von ungesunden Körperausscheidungen. Vom Boden her, wie sie sagt, noch bräunlicher noch dunkler und das ziehe sich hoch, das krieche an den Wänden nach oben und wo es schon ist und wo noch nicht, das sei nicht zu unterscheiden. Und im Blinden vermischt sich der Gestank mit beschriebener Farbe zum Körperzustand, in welchem diffuse Widerwertigkeiten geöffnet - aber immerhin etwas geöffnet und sei es nur um den Eiter der Phantasmen auslaufen zu lassen.
Etwas mache sich breit wie Schimmel wie Stock oder Schwamm wie man andernorts sagt, wie man dort sagt, wo er herkommt und woher er ihn kennt, wo er ihn gesehen, damals, als das noch möglich. Punktstrahler Spotlights auf die Wände gerichtet, wie sie sagt. Ausgeleuchtet so gerahmte Collagen. Als träten sie aus den Wänden heraus, wie er denkt, was freilich nicht zu sehen. Die Wände aufgerissen von den Strahlern. Etwas sichtbar wie von Außen, wie er denkt. Dass es etwas außerhalb der Wände gibt. Das sagt sie nicht, wie gesagt, das denkt er, denkt aber auch, dass sie, so wie sie spricht, und in diesen Worten das genau so sieht. Nochmals an den Begriff gedacht. Gedacht an das, was der Begriff aus dem Wort herausschneidet. Der Begriff dieser rücksichtslose Weg durchs Wort. Der Begriff dieser rücksichtslose Schnitt wildwüchsiges Denken eliminierend.
Irgendwo ein Geplätscher. Dass da etwas volläuft dass da etwas ausläuft, wie er denkt. Aber auch das ist von einem Hall umgeben, von etwas also wie einem Außen wo die Dichte des Raumes doch nichts anderem als sich selbst Raum gibt. Alle Ausdehnung des Geräusches verschluckt. Kein Entkommen kein Hall und was hier zu hören vielleicht der Einspruch eines Wunsches. Vielleicht aber auch das grausige Genecke, das diesen Kellerraum als eine Falle entlarvt.
Mein Kleiner Dreckiger Himmel – unreines Erlösungsreich als Wahn nach dem Ende.
Mein Kleiner Dreckiger Himmel – Zeugnis einer aufgeteilten Welt wo Gott vom Menschen aus dem Paradies gejagt und das Glück ein dreckiger Flicken namens Notdurft.
Ein Stoff so kräftig dass noch sein Faltenwurf fest genug erscheint gegen Zeit und Geschehen. In unterschiedliche Dichte gepresst die Bahnen. Zwei Sorten unter der Hand. Rauer die eine, undurchlässiger und die Oberfläche dabei glatter ja weicher die andere. Beide vor einem Gerüst vertikal herabhängend es überziehend seine Konturen dabei hervortreten lassend um über dessen nach vorne tretenden Ständerfüßen auszulaufen. Das ganze Gestell bedeckend dabei sich überlappend. Die Kanten spürbar unter ihm wie Gebein unter Muskelgewebe. Klopfen der Fingerknöchel daran: ein schmutzig spröder Klang wie von Pappe und daneben und ganz anders eine weiche Resonanzöffnung wie von Holz die selbst der eng anliegende Stoff nicht verdeckt. Den Stoff selbst aber und seinen Namen den verrät schon die Berührung. Ein fester Griff der ihn ins Wort setzt. Filz, und Filz in zwei unter der Haut unterscheidbaren Sorten. Der Schnitt ihrer Überlappung wiederum von breitem Fabrikklebeband gehalten aber vielleicht eher markiert. In Fragen von der Ausstellungsführung sich dem Material genähert, ohne dass es in Kreuzworträtselbegriffsgejage wieder verscheucht. Ein Gespräch. Ahnung eines kollektiven Gedächtnisses, das im Material hin zur Welt sich weitet. Seinen Ausgang nehmend in Erfahrungen und Bedingungen der Einzelnen mit dem Material und in Erzählungen entlang der Genealogie des Materials weit darüber hinaus, hinaus ins umgebende Elend. Altkleider würden zerschreddert, so die Beschreibung der Herstellung von Filz. Dann würde alles in Bahnen miteinander verfilzt wobei die ursprünglichen Materialien auch danach an Farbe und Struktur noch zu erkennen. Wie gestückt sehe der Filz aus, die Grundfarbe ein dreckiges Grau, eine Farbe in welcher alle Farben ins Unreine gemischt. Filz in hiesigen Regionen Dämm- und Isolationsmaterial. Um Rohre gewickelt und verklebt. Wärmedämmung. Akustische Isolation. Filz in der Autoproduktion wie eine sagt, etwa an den Türen an den Fenstern. Filz zu Hüten Mänteln und Schuhen gefertigt – neuer Trend aus kargen Zeiten dafür aber teuer. Filz und Rindenmulch um Unkrautwuchs zu verhindern, sagt eine. Von einer US-Firma importiert weisen die hier von Wangechi Mutu verwendeten Filzdecken Typenbezeichnungen aus, in welchen der Riss durch die Welt in Luxus und Elend deutlichst zu Tage tritt: Typenbezeichnung 1 die Humandecke und Typenbezeichnung 2 die Katastrophendecke. Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen so vom Material her und von seiner Berührung und dem was da berührt in schärfstem Kontrast gegeneinander verspiegelt, und verspiegelt schon deshalb hier der richtige Begriff, weil das eine doch nicht ohne das andere, das Elend nicht ohne den Luxus zu denken, ja gar nicht existent.
Decken für zerschossene halbzerrissene Leiber. Decken für überfüllte Krankenhäuser für Behelfslazarette – Gruß und Hohn von Menschlichkeit wo doch der Filz zumeist aus den Ländern aus denen auch die Waffen kommen, die den Körper zerfetzt, der unter dem Filz notdürftig gebettet. Filzdecken für Behelfszelte über ein paar Pflöcken ausgespannt. Schutz für menschlichen Abhub, zurückgelassen oder ausgeschieden von der Kapitalverwertung und selbst da, zumeist doch nichts anderes als Produkt der Kapitalverwertung, wo von „Naturkatastrophen“ die Rede. In den Metropolen schütze der Filz also Gegenstände des Lebens, in Regionen des Elends des Krieges des Hungers sei er notdürftiger Schutz für Menschen.
|

Blick in die Ausstellung, Wangechi Mutu: My Dirty Little Heaven, Foto: Mathias Schormann © Deutsche Guggenheim
|
Berührte Kunstgeschichte
Ohne Green Card, und bislang sei ihr eine solche nicht bewilligt worden, könne die Künstlerin zwar in den USA, wo sie studiert habe, seit einigen Jahren lebe und im letzten Jahr ein Kind bekommen habe sich zwar aufhalten, laufe aber Gefahr, so sie das Land verlasse nicht mehr hereingelassen zu werden. So habe die Ausstellung in der Deutschen Guggenheim nur über Skypkommunikation von ihr eingerichtet werden können. Einsicht Austausch über den Laptop, mit welchen der Kurator durch die Ausstellungsräume in Berlin gegangen und zu einer ganz bestimmten Zeit jeden Tag zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, wenn sie sich recht erinnere, ja zwischen 18.00 und 19.00 Uhr wohl, ihr das über die Kamera zeigend, was Assistenten tagsüber nach ihren Anweisungen aufgebaut. Diskussionen Korrekturen sodann und deren Ausführung am nächsten Tag, und zur selben Zeit und auf dieselbe Weise, erneut besprochen korrigiert erweitert. Der Anstrich der Wände sei auf diese Weise von ihr genauso koordiniert worden wie alle Exponate nach ihren Anweisungen gefertigt und die skulpturalen Arbeiten seien in und für die Deutsche Guggenheim erst entstanden. Auch die Figur, vor der man gerade stehe und über die man gesprochen habe und die ursprünglich im Atelier der Künstlerin in New York vollkommen anders konzipiert als das was jetzt hier zu sehen was jetzt hier zu tasten, habe erst und unter ihren Anweisungen aus New York und im Laufe des Ausstellungsaufbaus ihre letztgültige Gestalt gewonnen. Als Baum sehr schnell von den Besuchern und Besucherinnen bezeichnet verdankt die Skulptur solchen Namen den ständerartigen Ausläufern, die - wohl als Wurzeln gesehen oder imaginiert – sich sternförmig vom Stamm in den Raum strecken. In dieser phallischen Kahlheit - sechs Menschen bedürfe es die Figur zu umfassen, wie sie sagt – wirke sie aber, und dies sein Gedanke nachdem von Sehenden sie ihm beschrieben, eher wie eine Säule, ein animistisches Objekt, das nach oben hin sich kastenförmig verbreiterte. Ja, kubusförmig laufe es aus, so eine andere, über das was noch meterweit sich über die tastenden blinden Hände hinaus erstrecke. Unerreichbares Ganzes. Und nur das Bild tut so als sei das anders.
|
Material wie Form des Kubus später in einer anderen Ecke der Ausstellung hinter einer Leinwand mit Videoprojektion wiederentdeckt. Ein filzüberzogener schenkelhoher Kubus auf dem ein Tischchen mit langen gedrechselten Beinen platziert und darauf ein tierähnlicher Körper wie im Sprung. Glatt, gleichsam nackt dessen Haut. Nur die Pfoten unter Fell, in unterschiedlichen Arten von Fell allerdings. In erster Berührung der Ohren den Hasen von Albrecht Dürer erinnert, den er noch gesehen, der zudem in derselben zum Sprung ansetzenden Position gezeichnet. Vor allem aber die Ohren riefen das Bild in Erinnerung, deren geschraubte Form eher an Hörner erinnernd und damals, als er sie sah, als er noch gesehen, für ihn eher ein hybrides Wesen: ein Hase mit geweihähnlichem Gebilde auf dem Kopf. Jedenfalls aber dass etwas an dieser Zeichnung nicht stimme, wie er dachte, jetzt dachte und damals wohl auch gedacht haben mochte. Die Ohren aber nur. Nur die Ohren. Und jetzt an diesem nackten Körper entlang, den eine als Kaninchen mit halb abgezogenem Fell bezeichnet, jetzt diese Ohren, und dass da nicht nur die zwei, die zuerst berührt und die zuerst den Begriff aufgerufen und das Bild, und das Bild aus der Kunstgeschichte jetzt, nachdem von dieser Berührung aus weitergetastet, noch weitere Ohren erkannt, und das Tasten der Berührung widersprechend, die Zeit dem Augenblick, dem Bild des Augenblicks und der Vorstellung. Aber auch die Beine unter Tasten vermehrt und was so sicher gedacht, so sicher erkannt gedacht, das konnte das Bild der Sehenden nur noch als Fabelwesen bezeichnen: ein Wesen also, dessen endgültige Form dessen Gestalt niemals endgültig bestimmbar. Unter einem Begriff solches Wesen subsumiert und alle Wesen solcher Art deren Gestalt immer unbegriffen bleibt und deren Wesen nicht minder. In der Zeit also Erkenntnis widersprochen und ihr nicht, wie nachgedacht, Präzision folgend sondern Diffusion.
Den Verweis auf die Kunstgeschichte von der Form her treibt das Material noch in eine ganz andere Richtung, gerade da, wo es wie das hier, der Filz, neben Fett und Kupfer zum Merkmal eines Künstlers wurde, der in ihm gerne seine Legende wie Eigenmystifikation zu begründen suchte. Joseph Beuys, angeblich nach dem Abschuss seines Sturzkampfbombers im Zweiten Weltkrieg über der Sowjetunion von Tartarenfrauen unter einem Filzzelt gesund gepflegt, machte dieses Material schon fast zum Fetisch seiner magischen Selbstinszenierung als Schamane, in das eingewickelt er sich durch halb New York in einem Krankenwagen chauffieren ließ um in der Galerie René Block seine Kojoten-Performance zu präsentieren. Thronend auf dem Filz verweist Wangechi Mutus Hasenhybrid noch in der Form auf Beuys, der in einer anderen Performance mit einem toten Vieh dieser Gattung auf dem Arm durch eine Ausstellung stolzierte um diesem die Kunst zu erklären. Vielleicht erinnerte sich Wangechi Mutu als sie dem Hasen imaginär das Fell über die Ohren zog auch an Beuys´s Sentenz mit der er eine seiner Performances beendete: „Ja, jetzt brechen wir den Scheiß ab.“
|

|
Die Blindenführung wurde von Silke Feldhoff in Zusammenarbeit mit dem ABSV gestaltet.
|
Gerald Pirner - red / 6. Juli 2010
ID 4711
Weitere Infos siehe auch: http://www.deutsche-guggenheim.de
|
|
|
Anzeigen:



Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk
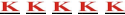
= nicht zu toppen

= schon gut
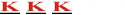
= geht so
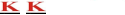
= na ja
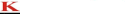
= katastrophal
|