WETTBEWERB
Final Portrait / Mr. Long
|

|
Nach dem Eröffnungsfilm Django war die amerikanische Produktion Final Portrait das zweite Biopic über einen Künstler, nämlich über den Maler und Bildhauer Alberto Giacometti. Der gebürtige Schweizer (1901-1966) schuf mit seinen extrem schmalen, Strichmännchen-ähnlichen Skulpturen ein unverwechselbares, auch von Kunstlaien unmittelbar wiederzuerkennendes Werk, dass durch moderne Strömungen wie den Kubismus und Surrealismus beeinflusst war. Der Film basiert auf der Biografie A Giacometti Portrait des US-Kunstkritikers James Lord, der mit dem Werk des Bildhauers sehr vertraut war und der sich knapp zwei Jahre vor dessen Tod in Giacomettis Pariser Atelier hat porträtieren lassen. Diese zunächst auf zwei Tage angesetzte Sitzung dehnte sich wegen Giacomettis exzentrischer Arbeitsweise auf rund drei Wochen aus, in deren Verlauf James Lord seinen Rückflug nach New York ein ums andere Mal verschieben musste. Zugleich lernte er die Arbeitsweise und die Schrullen des Meisters der abstrakten Bildhauerei ziemlich gut kennen, was Lord in besagtem Buch verarbeitete.
Der großartige amerikanische Schauspieler und Regisseur Stanley Tucci erzählt also nicht das Leben Giacomettis nach, sondern beschränkt sich auf eine winzige Episode, als der Künstler bereits weltweite Anerkennung erfahren hat. Das Setting des Films spiegelt den Erfolg und den Reichtum des Bildhauers jedoch in keiner Weise wieder, im Gegenteil: Das Atelier und die Privaträume Giacomettis und seiner Ehefrau sind von einer ausgesuchten Schäbigkeit und Komfortarmut geprägt. Tuccis konzentriertes Kammerspiel entlässt den Zuschauer kaum aus der bedrückenden, chaotischen Atmosphäre, spielt zu mehr als 90 Prozent in Giacomettis Atelier. Dazu kommen ausgeblichene, beinahe farblose Bilder von Kameramann Danny Cohen und eine sparsame Dramaturgie, sodass die eigentliche Attraktion des Films das Zusammenspiel von Geoffrey Rush als Giacometti und Armie Hammer als James Lord ist.
Die beiden extrem unterschiedlichen Männer kommen sich im Verlaufe der Sitzungen für das Porträt Stückchen für Stückchen näher, und doch bleiben wegen der Entscheidung für ein Kammerspiel natürlich viele interessante Aspekte aus beiden Biografien unerwähnt. Vieles muss sich der Zuschauer selbst zusammenreimen, so wie dies auch James Lord tun musste, der aufgrund einzelner Beobachtungen Rückschlüsse auf Giacomettis Lebensumstände gezogen hat. So wird ihm rasch klar, dass Giacomettis seine Frau (Sylvie Testud mit Mut zur Hässlichkeit) kontinuierlich mit einer Pariser Prostituierten betrügt, die er sogar von deren Zuhälter freikauft. Mme. Giacometti hingegen vergnügt sich gelegentlich mit einem japanischen Liebhaber, den ihr Mann wie einen alten Freund begrüßt. Die Person Giacomettis wird schon in den ersten Szenen als typisch zerrissene Künstlerpersönlichkeit etabliert. Nein, man muss sagen: Stanley Tucci zeigt ein Genie, der durch und durch aus Macken und Neurosen besteht. Es ist denn auch Geoffrey Rushs Verdienst, dass er als kettenrauchender, fluchender, unberechenbarer Bildhauer nicht wie ein Abziehbild aller Vorurteile gegenüber Künstlern wirkt.
Nachdem James Lord sich einigermaßen auf die sprunghafte Art Giacomettis eingelassen hat, muss er feststellen, dass dieser so sehr von (historisch verbürgten) Selbstzweifeln angenagt ist, dass er kaum mehr ein Kunstwerk beenden kann. Was zwischendurch entstanden ist – und für den Auftraggeber wie den Zuschauer überzeugend wirkt – verwirft der Maler und pinselt es fast komplett immer wieder über. So muss sich das Modell eines Tricks bedienen, um sein Porträt – eines der letzten, die Alberto Giacometti "vollendete" – schlussendlich doch noch in Händen zu halten. Dieses Tauziehen zwischen Maler und Modell und der künstlerische Schaffensprozess eines Besessenen ist schön anzuschauen, und die Skizzenhaftigkeit des Films entspricht ja durchaus Giacomettis eigener Kunstauffassung, dass ein (modernes) Werk nur vorläufig und unfertig bleiben kann. Doch den Mangel an Komplexität und Tiefe kann Tucci nicht übertünchen.
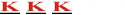
|

Final Portrait | (C) Parisa Taghizadeh
|
*
Ein Killer, der gut kochen kann. Oder ein Koch, der gut killen kann? So ganz genau weiß der Zuschauer nicht, was die Titelfigur des taiwanesisch-japanisch-chinesischen Thrillers, Mr. Long, zuerst und bei wem gelernt hat. Denn Mr. Long ist mindestens ein so schweigsamer Einzelgänger wie der Eiskalte Engel, den Alain Delon im gleichnamigen französischen Krimi stilbildend 1967 verkörperte und der bekanntermaßen einen Samurai zum Vorbild hatte (Originaltitel: Le Samourai). Nun wird der Ball also wieder in Richtung Asien zurückgespielt, und der eiskalte Engel ist diesmal ein hünenhafter Taiwanese (stoisch: Chen Chang). Der wurde von einem japanischen Mafiosi in das Land der aufgehenden Sonne geschickt, um dort eine konkurrierende Bande zu liquidieren. Ausgerechnet die Obergangster jedoch kann Mr. Long mit seiner scharfen Klinge nicht in Streifen schneiden, sondern findet sich selbst in einem Sack wieder, in dem er begraben werden soll. Zu seinem Glück gelingt ihm durch einen anderen Zwischenfall die Flucht. Gehetzt von der japanischen Bande zieht Mr. Long sich in eine heruntergekommene Siedlung am Rande einer Stadt nahe Tokio zurück, wo er zwischen verfallenen Häusern warten will, bis ihn das nächste Fährschiff Richtung Taiwan zurückbringt.
Nach diesem actionreichen und spannenden Auftakt beginnt die lange Zen-Phase des dramaturgisch offenkundig bewusst uneinheitlich gestalteten Films, der sich vom beinharten Thriller zur burlesken Milieustudie und zarten Liebesdrama wandelt – um nach rund 90 Minuten wieder zum Actionthriller zu mutieren. Die Unausgewogenheit der Geschichte wird noch durch eine längere Rückblende und die eine oder andere Unglaubwürdigkeit verstärkt. Doch wer die bisherigen Werke von Kultregisseur Sabu (eigentlich Hiroyuki Tanaka) kennt (z.B. Hard Luck Hero, 2003; Kanikôsen, 2009; Miss ZOMBIE, 2013 oder zuletzt Happiness, 2016), weiß, dass dieser die atmosphärische Abwechslung nicht nur von Film zu Film, sondern bisweilen auch innerhalb eines Filme anstrebt. Positiv ausgedrückt: Künstlerische Freiheit rangiert bei Sabu vor traditionellen dramaturgischen Werten wie Geschlossenheit und Glaubwürdigkeit.
Auch in Mr. Long gelingt es Sabu wieder einmal, eine Fülle sehr unterschiedlicher Stimmungen zu erzeugen, abgesehen davon, dass sich trotz Überlänge keine Langweile einstellt. Denn schließlich ist man neugierig darauf zu erfahren, ob der große Schweiger von der Bande aufgespürt wird oder aber seine Vorstadtidylle leben kann. Ersteres ist der Fall, aber wie gesagt, das dicke Ende kommt erst, nachdem eine geradezu märchenhafte Geschichte von einem gefallenen Engel erzählt wurde, der seine verletzliche, fürsorgliche Seite entdeckt und sie vorübergehend gegen seine Eiseskälte einwechselt. Denn einmal in seinem Versteck untergekommen, trifft Mr. Long einen kleinen Jungen (Runyin Bai), dessen Mutter (Yiti Yao) heroinabhängig ist und prostituiert. Der schließt zaghaft Freundschaft mit dem Unbekannten, und alsbald fällt auch einem Rentner auf, dass Mr. Long eine hervorragende Nudelsuppe kocht. Einsatz Schneeballeffekt: Der Alte rückt mit einer ganzen Freundesclique im Schlepptau an, die Mr. Long nicht nur eine Wohnung, sondern auch gleich einen Garküchenstand herrichten, mit der er seine taiwanesischen Köstlichkeiten in einem Park verkaufen kann. Das bringt wohl nicht so viel wie die Auftragsmorde, aber es läppert sich und lässt die Abreise Mr. Longs in greifbare Nähe rücken.
Doch da sich die Beziehung des Killers zu dem kleinen Jungen und dessen Mutter, die Long auf kalten Entzug gesetzt hat, intensiviert und er zunehmend – wenn auch nicht sichtbar – Vergnügen an seiner bürgerlichen Existenz verspürt, bleibt er in der japanischen Provinz hängen. Bis schließlich die alten Widersacher, die auch für das traurige Schicksal von Mutter und Sohn verantwortlich sind, wieder auftauchen.
Wer sich mit buddhistischer Gelassenheit auf diese merkwürdig konstruierte, aber feinfühlig erzählte Geschichte einlässt und nachvollziehen kann, dass Liebe nicht nur durch den Magen geht, sondern gutes Essen auch Brücken zwischen Menschen verschiedener Kulturen und mit, nun ja, sehr verschiedenen Berufen bauen kann, der wird hier gut unterhalten.
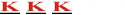
|

Mr. Long | (C) 2017 LIVE MAX FILM / LDH PICTURES
|
Max-Peter Heyne - 14. Februar 2017
ID 9837
Weitere Infos siehe auch: http://www.berlinale.de
Post an Max-Peter Heyne
BERLINALE
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|

Rothschilds Kolumnen
DOKUMENTARFILME
DVD
FERNSEHFILME
HEIMKINO
INTERVIEWS
NEUES DEUTSCHES KINO
SPIELFILME
TATORT IM ERSTEN
Gesehen von Bobby King
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
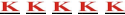
= nicht zu toppen

= schon gut
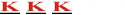
= geht so
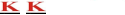
= na ja
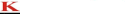
= katastrophal
|