|
Chamisso-Literaturfest in Schwabach
Niemand geringeres als 12 namhaften Autoren unter der Moderation der Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan fanden sich unter dem Motto „Moving Cultures: Viele Kulturen – Eine Sprache“ in Schwabach im Rahmen eines interkulturellen Festivals zusammen:
Gino Chiellino, Hussain Al-Mozany, Adel Karasholi, Ismet Elci, György Dalos, Vladimir Vertlib, Selim Özdogan, Yoko Tawada, Terézia Mora, Zehra Cirak, Ilja Trojanow, José F.A. Olivier, alle zusammen, ein Fest der Poesie.
Schwabach in der Funktion des Gastgeber, kleinstes Mitglied eines Kooperationsmodells der vier Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, das sich der Förderung von „innovativen und spannenden Kulturprojekten und aktuellen Fragestellungen unserer Lebenswelt widmet“.
Große Autoren also, an einem herrlichen Sommertag. Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, doch eines gemeinsam haben: Sie alle stammen aus einer nichtdeutschen Kultur und schreiben deutsche Literatur. Ein interessanter „Gegensatz“, der zur gedanklichen Forschungsreise über Gemeinsames und Nichtgemeinsames im Wahrnehmungshorizont der Kulturen einlädt, Fremdes und Unfremdes erfahren, Grenzen verwischen oder verschieben lässt.
Und trotzdem wird deutschsprachigen Autoren nichtdeutscher Herkunft immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, im Gegensatz zu unseren großen europäischen Nachbarkulturen.
Aus diesem Grund verleiht die Robert-Bosch-Stiftung alljährlich den Adelbert-von-Chamisso Preis, benannt nach dem gleichnamigen französischen Exilanten und deutschen Dichter. Mit diesem Preis soll die Möglichkeit sprachlicher Selbstbesinnung und Erneuerung und die Bereicherung der deutschsprachigen Literatur durch die Arbeit dieser Autoren gewürdigt und gefördert werden. Alle Autoren dieses Literaturfestes sind Adelbert-von-Chamisso Preisträger.
Zwölf waren nun gerufen, und zwölf waren dank Förderung der Robert-Bosch-Stiftung gekommen. Ein sommerlicher Garten mit einer großen Lesebühne, dort ausreichend Platz für bis zu vier Autoren nebeneinander. In der Mitte der Bühne Renan Demirkan, Schauspielerin, ebenfalls Autorin und betitelte „Kosmopolitin“, welche sich tapfer und in anerkennenswerter Leistung als Moderatorin durch die Marathon-Veranstaltung schlug.
Ein zauberhaftes Ambiente. Ausreichend Sitzplätze. Keine Dolby-Surround Anlage, keine Special-Effects, deine Fantasie hat endlich wieder Auslauf. Während sich bewegungslose Spaßgesellschaft in klimatisierten Kinosälen „Matrix-Reloaded“ zu Gemüte führt, sitzen andere heute genussvoll in diesem Garten und schwitzen bei Poesie und interkulturellerem Erfahrungsaustausch.
Gino Chiellino
Punkt 14:00 Uhr war es dann soweit. Gino Chiellino betrat die Bühne. Gino Chiellino ein Mensch, der im innerlichen wie äußerlichen Spannungsverhältnis zweier Kulturen lebt und schreibt.
Er wurde 1946 in Carlopoli/Kalabrien geboren und ist seit 1970 in Deutschland. 1976 hat er in Italianistik promoviert und 1995 in Romanistik über die Literatur der Fremde habilitiert. Er ist Professor für „Vergleichende Literaturwissenschaft“, mit einer Deutschen verheiratet und hat drei Kinder. Neben zahlreichen Essays und literaturwissenschaftlichen Arbeiten insbesondere zur Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik hat Chiellino – seit 1976 Gedichte in deutscher Sprache schreibend – auch vier eigene Lyrikbände veröffentlicht. Zahlreiche Lesereisen in viele Länder sowie Gastpoetikdozenturen in Tokio bzw. Vancouver schmücken seinen Weg. 1987 erhielt er den Adelbert-von-Chamisso Preis.
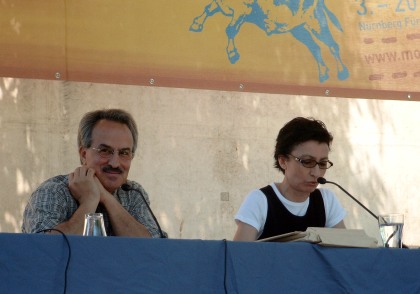 Gino Chiellino (l.), Renan Demirkan (C)Foto: Stefan Ort 2003
Gino Chiellino (l.), Renan Demirkan (C)Foto: Stefan Ort 2003
Zu beginn, in einer Vorstellungsrunde Berichtet Gino Chiellino anschaulich von den Schwierigkeiten der Überwindung der eigenen kultureller Grenzen:
Er selbst fühlt sich in der deutschen Kultur nicht aufgenommen. Nicht aus Gründen eines mangelhaften Integrationsprozesses oder mangelhafter Anerkennung in Deutschland - es gibt schlichtweg keine Institution, die bestätigt, dass man aufgenommen ist. Kein Land der Welt ist zu einer solchen Aussage in der Lage. Kein Land der Welt spricht über eine Behörde den erlösenden Satz "du bist aufgenommen" aus. Schließlich geht es um innere Prozesse. Die eigene Kultur ist nahezu unüberwindbar.
Daher sieht sich Gino Chiellino als Person mit mehreren „Ichs“, die hart im Kern aber mit weichen Übergängen nebeneinander existieren. „Ichs“ unterschiedlicher Kultur. Das ist seine Organisation um in und mit der Fremde/Fremdheit umzugehen.
Ein Zitat aus einem seiner Werke:
Die Einladung
Mit Verkleidung, bitte!
stand auf der Einladung.
Ich habe mich entschieden
als Wallraff zu kommen.
Niemand wird mich als Gastarbeiter erkennen.
(Aus: Sehnsucht nach Sprache, Neuer Malik Verlag, 1984)
|
Ein weiteres Zitat aus der unveröffentlichten Sammlung „Canti per M/Lieder für einen Buchstaben“, soll an dieser Stelle die kraftvolle aber zeitweise auch melancholische Poesie Gino Chiellinos verdeutlichen:
Canto 50
Cinia bewohnt nicht mehr
den Pinienhain in der Bucht
Mit harziger Stimme rufen Zikade
Viper und Möwe ins Gestrüpp zurück
In der Mittagssonne
wird das Meer zu einer Linie
zwischen Grün und Blau
zerfließt die Erinnerung an Cinia
mit dem weichen Gang aus Wind und Sand
(aus „Viele Kulturen – Eine Sprache“ die Preisträgerinnen und Preisträger des Adalbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung)
|
Mit großer Anerkennung entlässt das Publikum nach der Lesung eine bemerkenswerte Person der Literaturgegenwart. Ein gelungener Auftakt für einen viel versprechenden Nachmittag.
Hussain Al-Mozany
bbetritt die Bühne. Hussain Al-Mozany ist 1954 in Amarah/Irak geboren und 1980 nach Deutschland übergesiedelt. Er studierte in Westfalen Arabistik und Islamwissenschaft, Germanistik und Publizistik. Seit 1988 ist er als freiberuflicher Schriftsteller in Köln tätig. 2003 erhielt er den Adelbert-von-Chamisso Förderpreis.
Hussain Al-Mozany liest zunächst aus seinem Werk „Mansur oder der Duft der Freiheit“ (Reclam, 2002).
 Hussain Al-Mozany (l.), Renan Demirkan (C)Foto: Stefan Ort 2003
Hussain Al-Mozany (l.), Renan Demirkan (C)Foto: Stefan Ort 2003
In der sich anschließenden Vorstellungsrunde berichtet Hussain Al-Mozany dass er die Beziehung zwischen Kultur und Kunst als wichtigste Beziehung sieht, die zwischen Menschen stattfindet. Er will mit seinen Beitrag in der Literaturgegenwart Menschen verbinden, jedoch nicht als „Brückenbauer“ bezeichnet werden. Menschen sollen sich untereinander und auch zu den unterschiedlichen Realitäten verbinden. Den Realitäten der Gesellschaft und den Realitäten der Politik. Wahrnehmungen sollten nicht verdrängt, sondern verknüpft werden. Ein Spannungsverhältnis, dass es zu ertragen gilt.
Ein kurzer Ausschnitt aus Hussain Al-Mozanys Literatur, am Beispiel eines sterbenden Freundes verdeutlicht an dieser Stelle, wie er diese Spannungsfelder literarisch verarbeitet:
Mein einziger Freund starb ohne eine vorherige Ahnung seines Todes. Kurz vorher lächelte er, als er mir den Ratschlag gab, in Krisen den Wodka zu suchen. Aber, Freund, weshalb Wodka? Er war stark und gut, seine Seele war sicherlich größer als sein Körper, und gerade unter der ständigen Last dieser schweren Seele zerbrach sein Körper. Wenn er statt seines geltenden Lachens Stahlhanteln gehoben hätte, wäre ich vielleicht nicht hergekommen. Was suchte ich nur in diesen fremden Scherben? Soll ich in meiner Wüste in noch entlegeneren Wüsten Zuflucht suchen? Ein typischer Rezitator las auf seine Seele Verse in gebrochenem Arabisch, dann kauerte er am offenen Grab nieder und pries kurz: Gott ist troß! Mein Gott, Gott ist troß?!
Mein Freund nahm sein furchtbares Lachen mit sich und verschwand, er lag nun unter fremder Erde zwischen lautlosen verbannten. Er ging fort, nachdem sein Verstand gereift war. Alle Leute wussten schon lange, dass er bald fortgehen würde. Trotz allem hatte er alle zum Verstummen gebracht, er hatte sie am Kragen gepackt, sein Tod brachte sie ins Schleudern und ließ sie kopflos um sich Kreisen. Sie flüchteten vor seinem Sterben.
(aus „Viele Kulturen – Eine Sprache“ die Preisträgerinnen und Preisträger des Adelbert-von-Chamisso Preises der Robert Bosch Stiftung)
|
Adel Karasholi
welcher zur rechten Hand von Renan Demirkan saß, während Hussain Al-Mozany las, kommt zu Wort.
Der 1936 in Damaskus, Syrien geborene ist jüngstes Mitglied des arabischen Schriftstellerverbandes. 1959 verließ er Syrien und kam über Beirut, München und West-Berlin 1961 nach Leipzig, wo er seither lebt. Er studierte am dortigen Literaturinstitut und promovierte 1970 über das Theater Brechts. 1968 bis 1993 arbeitete er als Lektor an der Universität Leipzig. Heute arbeitet er als freier Schriftsteller überwiegend an Gedichtbänden. 1985 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Leipzig und 1992 den Adelbert-von-Chamisso Preis.
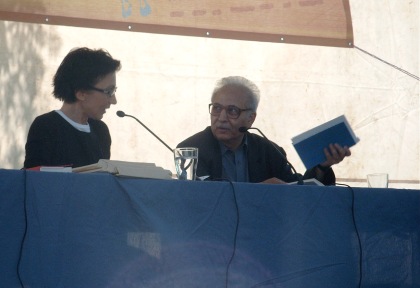 Renan Demirkan, Adel Karasholi(r.); (C)Foto: Stefan Ort 2003
Renan Demirkan, Adel Karasholi(r.); (C)Foto: Stefan Ort 2003
Adel Karasholi über sein Integrationserlebnis:
Meine arabischen Gedichte, mit deren Übersetzungen ich bekannt wurde, waren vorwiegend aus Emotionen geboren, ihre Diktion war gefühlsbetont, ihre Metaphern und ihre Themen waren exotische. Man nahm mich auch als einen Exoten gern an, bereitete mir volle Veranstaltungssäle und begeisterte Leser. Nur: ich wollte nicht als Exot gelten und als solcher wirken. Ich wollte nicht wie eine Orchidee gezüchtet werden in einer netten, zufriedenen Stube. Krampfhaft versuchte ich, mich verständlich zu machen. Man merkte dies und hat mich ständig missverstanden. Auch ich schlug vergebens an einen Felsen, der keinen lebendigen Quell mehr gewährte. Da bot mir die Fremde ihren Schatten, den ich dankbar annahm. Ich habe angefangen, Gedichte in deutscher Sprache zu schreiben. Dieser Handel war vielleicht töricht, aber er war schicksalhaft unabwendbar. die Irrfahrt begann. Eine Rückkehr oder gar einen Ankunft irgendwo war nicht mehr möglich. Das Sprachheimweh ritzte zuweilen meine Haut, glich Noahs Taube, die immer wieder zurückkehrte, um zu verkünden, dass die Irrfahrt weiterginge.
(aus „Viele Kulturen – Eine Sprache“ die Preisträgerinnen und Preisträger des Adalbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung)
|
Adel Karasholi zitiert aus seinen Werken:
Zwei Frauen
Die Erste
Sie steht vor dem Spiegel und fragt mich oft, ob ihre Augen schön sind.
Ich sage: Ja.
Wenn sie mit mir tanzt, fragt sie mich oft, ob sie nicht am besten tanzt.
Ich sage: Ja.
Sie fragt mich, ob ihre Schuhe zu ihrem neuen Kleid passen.
Ich sage: Ja.
Nun fragt sie mich, ob ich sie liebe.
Die Zweite
Sie fragt mich, ob ich Post von zu Hause habe.
Ich sage nein, sie ist traurig.
Sie fragt mich, ob ich mich einsam fühle.
Ich sage nein, sie ist glücklich.
Sie fragt mich, ob ich ruhige Kinder liebe.
Ich sage nein, sie umarmt mich.
Sie fragt mich nicht, ob ich sie liebe.
|
Ein bemerkenswerter Autor, der sich ebenso an diesem Nachmittag in die Herzen seiner Zuhörer gelesen hat.
Yoko Tawada
 | |
Die 1960 in Tokio, Japan geborene Schriftstellerin lebt seit 1982 in Hamburg, wo sie Literaturwissenschaft studierte und auf japanisch und deutsch zu schreiben begann. Seit 1986 veröffentlicht sie in Deutschland und Japan. Die mehrfach international gekrönte Preisträgerin, war 1997 Stipendiatin der Villa Aurora in Los Angeles und 1999 als Max Kade Distiguished Visitor am Massachusetts Institute oft Technology.
|
Zu ihren Auszeichnungen gehören unter anderem der in Japan verliehene „Gunzo-shinjin-Bungaku-Sho“ (1991), der in Deutschland verliehene Förderpreis des Lessing-Preises (1994) sowie der Adelbert-von-Chamisso Preis (1996).
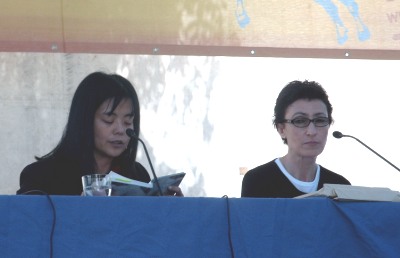 Yoko Tawada (l.), Renan Demirkan; (C)Foto: Stefan Ort 2003
Yoko Tawada (l.), Renan Demirkan; (C)Foto: Stefan Ort 2003
Yoko Tawada liest zunächst aus Ihrem Werk „Talisman. Von der Muttersprache zur Sprachmutter“ (Konkursbuchverlag, 1996):
„Ein deutscher Bleistift unterschied sich kaum von einem japanischen. Er hieß aber nicht mehr »Enpitsu«, sondern »Bleistift«. Das Wort »Bleistift« machte mir den Eindruck, als hätte ich jetzt mit einem neuen Gegenstand zu tun. Ich hatte ein leichtes Schamgefühl, wenn ich ihn mit dem neuen Namen bezeichnen musste.
Es war vergleichbar mit dem Gefühl, das auf mich zukam, als ich meine verheiratete Bekannte mit ihrem neuen Familiennamen ansprechen musste. Bald gewöhnte ich mich daran, mit einem Bleistift - und nicht mehr mit einem Enpitsu - zu schreiben. Bis dahin war mir nicht bewusst gewesen, dass die Beziehung zwischen mir und meinem Bleistift eine sprachliche war.
Eines Tages hörte ich, wie eine Mitarbeiterin über ihren Bleistift schimpfte: »Der blöde Bleistift! Der spinnt! Der will heute nicht schreiben!« Jedes mal, wenn sie ihn anspitzte und versuchte, mit ihm zu schreiben, brach die Bleistiftmine ab. In der japanischen Sprache kann man einen Bleistift nicht auf diese Weise personifizieren. Ein Bleistift kann weder blöd sein noch spinnen. In Japan habe ich noch nie gehört, dass ein Mensch über seinen Bleistift schimpfte, als wäre er eine Person.
Das ist der deutsche Animismus, dachte ich mir. Zuerst war ich nicht sicher, ob die Frau ihre Wut scherzhaft übertrieb oder ob sie wirklich so wütend war, wie sie aussah. Denn es war für mich nicht vorstellbar, so ein starkes Gefühl für einen so kleinen Gegenstand empfinden zu können. Ich bin zum Beispiel noch nie in meinem Leben über mein Schreibzeug wütend geworden. Die Frau schien aber - soweit ich es beurteilen konnte - ihre Worte nicht als Scherz gemeint zu haben. Mit einem ernsthaften Gesicht warf sie den Bleistift in den Papierkorb und nahm einen neuen in die Hand. Der Bleistift, der in ihrem Papierkorb lag, kam mir plötzlich merkwürdig lebendig vor.
Das war die deutsche Sprache, die der für mich fremden Beziehung zwischen diesem Bleistift und der Frau zugrunde lag. Der Bleistift hatte in dieser Sprache die Möglichkeit, der Frau Widerstand zu leisten. Die Frau konnte ihrerseits über ihn schimpfen, um ihn wieder in ihre Macht zu bekommen. Ihre Macht bestand darin, dass sie über den Bleistift reden konnte, während der Bleistift stumm war.
Vielleicht schimpfte sie über ihn, um sich dieses Machtverhältnisses zu vergewissern. Denn die Frau war sehr verunsichert in dem Moment, als sie nicht weiter schreiben konnte. Unabhängig davon, ob es an der ständig brechenden Bleistiftmine liegt oder an der mangelnden Kreativität, wird jeder Mensch verzweifelt, wenn er plötzlich nicht weiter schreiben kann. Er muss dann seine Position als Schreibender wiederherstellen, indem er über sein stummes Schreibzeug schimpft. Leider handelt es sich hier nicht um einen Animismus.
Trotzdem kam mir der Bleistift lebendig vor, als die Frau über ihn schimpfte. Außerdem kam er mir männlich vor, weil er der Bleistift hieß. In der japanischen Sprache sind alle Wörter geschlechtslos. Die Substantive lassen sich zwar - wie das bei den Zahlwörtern sichtbar wird - in verschiedene Gruppen aufteilen, aber diese Gruppen haben nie das Kriterium des Männlichen oder des Weiblichen: Es gibt zum Beispiel eine Gruppe der flachen Gegenstände oder der länglichen oder der runden. Häuser, Schiffe und Bücher bilden jeweils eigene Gruppen. Es gibt natürlich auch die Gruppe der Menschen: Männer und Frauen gehören zusammen dahin. Grammatikalisch gesehen ist im Japanischen nicht einmal ein Mann männlich.“
|
Yoko Tawada schöpft Kreativität nicht nur durch den inneren Vergleich, dem Inhalt der Worte der Sprache, sondern auch durch die äußere Form, wie beispielsweise der immanenten Leseweise. Sie verwendet mithin das gesamte was eine Sprache zu vermitteln mag, angefangen von der Form bis zum mehrdeutigen Bedeutungssinn. So haucht sie Leben ein, in Bleistifte, alte Schreibmaschinen, sogar in ihren eigenen Namen, wie sie angesichts der türkischen Moderatorin bemerkt:
„Man hat mir einmal gesagt, mein Name, Tawada, bedeute im türkischen ´in der Pfanne´. Das wäre auch ein schöner Anfang für eine Geschichte.“
Zehra Cirak
Die 1960 in Istanbul, Türkei geborene Lyrikerin siedelte 1963 nach Deutschland über. Seit 1982 lebt sie in Berlin. Zehra Cirak gibt regelmäßig mit ihrem Mann, dem Objekt-Künstler Jürgen Walter Lyrik-Performance-Gastspiele in Deutschland und im europäischen Ausland. Zahlreiche Stipendien und bedeutende Preise schmücken ihren Werdegang. So erhielt sie unter anderem 1993 den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis und 2001 den Adelbert-von-Chamisso Preis.
Zehra Cirak schreibt nicht nur Lyrik, sie führt Lyrik gemeinsam mit ihrem Ehemann auf. Über sich selbst sagte sie einmal:
Meine Texte haben Körperlichkeit, der Mensch ist ja etwas zum anfassen. Ich versuche etwas zu durchschauen, den Menschen anzufassen, nicht mit den Händen, sondern mit den Blicken.
|
So gibt es zahlreiche Texte, die für Jürgen Walters Objekte geschrieben wurden. Objektkunst, die Alexander L. Heil folgendermaßen umschrieb:
Mit stets präziser, oft lauter Gestik, gelegentlich aber auch in leise Anklage, definiert und deklariert Jürgen Walter wesentliches unserer Existenz in seinen Werkzyklen. Vom Weltbohrer bis zum Sturzflieger, vom Spiegelbild hin zur Kriegsperformance reicht die Sicht seiner Realität Kunst.
|
 | |
In einigen dieser Werkzyklen sind kleine Lautsprecher eingebaut, aus denen in unterschiedlichen Klangkompositionen die Werke von Zehra Cirak gelesen werden.
Vorsichtig wird ein Objekt aufgestellt, mal mitten im Publikum, mal auf der Lesebühne. Anschließend hört man aus den integrierten Lautsprechen Zehra Cirak. Sie liest ihre Lyrik untermalt von Klängen und Tonverfremdungen. Text und Form verschmelzen zu einer besonderen Einheit.
|
Nach der etwa 20 minütigen Performance liest Zehra Cirak noch auf bitten der Moderatorin ihr Gedicht „Mit ausgesuchten Worten“:
Mit ausgesuchten Worten
Eine Rede und eine Wendung
ein sich winden im Fehl
nichts fehlerfrei sprachspüren
erst sagen dann machen oder
nichts verraten von den Fehlern
erst falschsagen dann richtigmachen
oder nichts machen und viel sagen
Sprachrechte im Rechtsprech wie
Fehlersprech dem Sprachfehler im Redeversprech
Rechtsagung
Lüge
sprichwörtlich wahr gesagtes im Redeverbot
auch bei Sprachstörung anzuwendendes Sprachlabor
Spruchkammer im Rederaum wenn Sprücheklopfer
Sprechzellen sprengen mit
Lüge
redelustige Redekunst auch sprachgewaltig
und Sprachpfleger im rausreden
sich Freispruch für Freispruch absagen
lügende Sprechblasen
endlich sprachlos
Opferworte Tätersprache
im Sprechzwang die Redelust der Redeschlacht
Lüge
über Gott und die Welt über Tod und Teufel
mit ausgesuchten Worten
verzeihlich auch wenn
sprachfehlerfrei
vom Gehirn zur Lippe zum Ohr
|
 Renan Demirkan, Zehra Cirak (r.); (C)Foto: Stefan Ort 2003
Renan Demirkan, Zehra Cirak (r.); (C)Foto: Stefan Ort 2003
Im anschließenden Interview erzählt Zehra Cirak über die Art und Weise ihre Wortfindungen:
Diese Sprachexperimente sind keine ausgearbeiteten Wortspiele. Sie überfallen mich. Sie sind einfach da. Der Anblick der Wörter verführt mich dazu, darin mehr zu sehen. Und diese Wörter finden mich. Sie wollen durch mich entdeckt und freigelassen werden. Ich sperre sie eine gewisse Zeit lang ein, und lasse sie dann auf Papier irgendwann wieder frei. Ich bin also der Erlöser dieser Worte.
Fortsetzung folgt
s.o. - red / 1. August 2003
|
|
|

