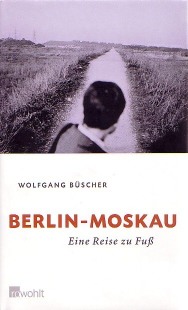|
Wolfgang Büscher
Berlin - Moskau. Eine Reise zu Fuß
240 Seiten
Preis: EUR 17,90 [D]/EUR 18,90 [A]/SFr 30,70
ISBN 3-498-00631-2
Erschienen im Rowohlt
Verlag, Reinbek
9. Auflage, Juli 2003 |
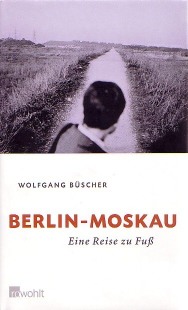 |
Wolfgang Büscher ist nach Moskau gegangen. Zu Fuß, vom Juli bis zum
Oktober 2001. Warum genau er diese Wanderung unternommen hat, ist schwer
zu sagen. "Sie jagen ihrer Phantasie nach", sagt ihm ein Kriegsveteran
kurz vor der polnischen Grenze. "Warum laufen Sie dem Tod nach?"
Vielleicht ist Berlin - Moskau. Eine Reise zu Fuß, das Buch,
das Büscher über seinen gut achtzig Tage dauernden Spaziergang nach
Moskau geschrieben hat, die Beantwortung genau dieser Frage. Es ist
bereits vor einigen Monaten in einer schönen Ausgabe, Hardcover mit
Lesebändchen, im Rowohlt Verlag
erschienen, hat aber mit dem Russland-Schwerpunkt der
Frankfurter Buchmesse
neue Aktualität gewonnen. Und es ist der Beweis, dass man nach Moskau
gehen kann, ohne sich totschlagen zu lassen, wie der ehemalige Soldat
mutmaßte, und ohne andere totschießen zu müssen, wie die Heeresgruppe
Mitte im Herbst 1941, deren Weg Büscher eingeschlagen hat.
Die Route ist nicht weiter spektakulär: von Berlin über Küstrin nach
Torun, von dort an Warschau vorbei möglichst zügig über die Grenze nach
Weißrussland. Es ist nicht Polen, das Büscher interessiert, obwohl er
mit der Suche nach dem Osten bereits dort beginnt. Vielleicht liegt
es auch daran, dass der Autor kaum ein Wort Polnisch spricht und seine
Wanderung durch Polen hauptsächlich mit Hilfe eines Netzwerks von
Deutschlehrerinnen bestreitet - ein Land "auf dem Weg nach Westen"
liegt ihm ohnehin nicht.
Bloody Wostok
Östlich von Polen kann er sich dagegen sehr gut verständigen. Der Osten,
das wird schnell deutlich, beginnt immer ein Stück weiter östlich.
Von Torun aus ist es das heutige Ostpolen, von Bialystok das nahe Belarus.
Und vom einst polnischen Westteil des Landes verweist man ihn wiederum
Richtung Osten: "Wot Wostok". Die Wanderung führt ihn nach Minsk, von
wo aus er die alte, schnurgerade Autobahn M1 entlang durch unendlich
eintönige Landschaften, tiefe Wälder und weite Flusstäler bis in die
Grenzstadt Orscha wandert. Über das russische Smolensk geht es weiter
über Wjasma und Gagarin, bis er nach fast 2000 Kilometern Moskau
erreicht.
Büscher ist 1951 geboren, sein Großvater starb im April 1945 auf den
Seelower Höhen bei Berlin. Er hat noch ein persönliches Hühnchen zu
rupfen mit dem Krieg, der ihm auf seinem Weg überall begegnet: in der
schönen neuen Sowjetwelt der GUS-Staaten als Negativbild, in den
Erzählungen der Menschen als gelebte Schicksale. Wahre Epen kommen da
an die Oberfläche: die polnische Gräfin Mankowska, die es aus Standesethos,
Zähigkeit und polnischem Nationalstolz schafft, den Zweiten Weltkrieg
zu überleben und ihre Familie zu retten; der russische Partisan, der
aus einem deutschen Gefangenenlager flieht und als Mutprobe seine
Geliebte in einem weißrussischen Dorf töten lassen muss; der deutsche
Hauptmann schließlich, der mit seiner jungen jüdischen Geliebten hinter
die russischen Linien flieht, um in Moskau von Stalins Geheimdienst
abgeholt zu werden. "Der Osten ist ein Geschichtengrab", schreibt
Büscher, "ein Tagebau des Tragischen, der Stoff liegt dicht unterm Gras."
So dicht, dass er in Katyn, wo 1941 neben zahllosen Sowjetbürgern über
4000 polnische Offiziere und Intellektuelle vom russischen Geheimdienst
NKWD ermordet wurden, direkt unterhalb der Grasnarbe bereits auf
Knochen stößt.
Ein müdes Land hinter einer ernsthaften Grenze
Erst in Weißrussland beginnt für Büscher die Reise ernst zu werden.
"Das müde Land", wie er einen Münchner Filmschaffenden zitiert. An der
Grenze beobachtet er, wie die Zöllner mehrere Stunden mit Schmugglerinnen
um ihre Billigware feilschen, doch fehlt ihm der ironische Grundton
eines Radek Knapp, um darüber zu berichten. In Grodno ist es dann
vorbei mit Dusche und Handtuch im Hotel, und das unweigerliche Kiewskij
Kotlet wird ihn von nun an bis kurz vor Moskau begleiten. Hinter der
"ernsthaften Grenze" liegt Lukaschenkos postsowjetisches Reich, dessen
Verfall in großen Städten wie Minsk von Aufräumbrigaden mit einem
eingedrillten Elan konserviert wird.
Für Büscher ist es das Land der Gegensätze: die agrarische Einöde der
endlosen Ebenen, die verwildernde Zone von Tschernobyl im Süden, die
er mit Arkadij, einem seiner zahllosen Reisebekannten bereist, der
11. September schließlich, den er fassungslos im Fernseher des Witebsker
Kulturpalastes erlebt. Und es ist das stets von den geschichtlichen
Gegebenheiten versehrte Land, das ihn umtreibt. Nicht erst Napoleon
zog hier durch, im Zweiten Weltkrieg konnten die Weißrussen nur zwischen
radikaler Polonisierung im Westen, Stalinschem Terror im Osten und
Mord und Zerstörung während der deutschen Besatzung wählen. "Was sind
wir nur für eine Nation?" stellt ihm in Minsk ein Demonstrant der
Opposition die rhetorische Frage, kurz nach der verlorenen Präsidentenwahl.
"Gar keine", lautet seine lakonische Antwort.
Wie einst Mathias Rust
"Tief im Osten verschwinden", beschreibt Büscher den innigsten Wunsch
seiner Reise, "noch tiefer." Vom Radar verschwinden - wie einst Mathias
Rust auf seinem Flug zum Roten Platz, den Büscher allerdings nicht
erwähnt. Er möchte so sein wie alle anderen, dazugehören. "Ich sah jetzt
ganz und gar russisch aus", ein Mann mit Rucksack in Stiefeln, Hose
und Hemd, der an einer großen Straße entlang von einem Ort zum andern
zieht. "Ein Landstreicher in Russland, was denn sonst."
Und er fällt tatsächlich nicht auf, begegnet auf diesem Weg schreienden Greisen und
freundlichen Trinkern, mürrischen Wäscherinnen und kultivierten
Museumswärtern, er trifft einen Ex-Partisanen, einen Guru und eine
orthodoxe Äbtissin, die ihr Kloster einer Karriere im neuen Russland
vorzieht, und heult im Wunderwald von Boris-Gleb mit echten oder
eingebildeten Wölfen. Orscha, Mojaisk, Wjasma, Gagarin lauten die
Chiffren für den russischen Osten, und wenn es nur das Hotel ist:
"Es hieß Wostok. Osten. Ich drückte die Holztür auf, trat ein und war
im Osten."
Wolfgang Büscher hat vor allem ein ernstes Buch geschrieben, und
es ist damit auch, nicht ohne Grund, ein sehr deutsches Buch. Oberflächlich
betrachtet könnte man an Frühstück mit Bären des Amerikaners Bill
Bryson denken, auch er Jahrgang 1951, und in der Tat lassen sich
Parallelen finden: die Erfahrung des eigenen Körpers, die Urwüchsigkeit
von Natur und Mensch, der Wunsch, etwas herauszufinden über ein
bestimmtes Land. Doch hier enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Der
Weg nach Moskau ist nicht der Appalachian Trail, an dessen Rand Motels
und Fast-Food-Restaurants warten, Büscher ist kein Wiedergänger von
Bryson, und es ist auch nicht Wladimir Kaminer, der seine Heimat
erwandert - der käme wohl gar nicht erst auf die Idee.
Büscher wählt einen sehr deutschen Weg, nach Russland zu gehen: nicht
nur den der Wehrmacht, sondern vor allem einen inneren. Er will begreifen,
ergründen, was an den einsamen, langweiligen und öden Landstrichen mit
ihren einfachen und gebildeten, mal warmherzigen, mal kaltblütigen
Menschen dran ist. Er will es vor allem artikulieren können und wählt
dazu eine fast expressionistische, immer ein wenig atemlose Sprache.
In der Partisanenzone
Echte Männlichkeit ist auch im Spiel, nicht nur bei den groben
Kolchosarbeitern von Jaludok, die ihn wissen lassen, er sei hier in
der "Partisanenzone". Es gibt einen Kampf, Aug um Aug, lange antizipiert
und garniert mit geheimen Bildern aus der Adoleszenz, der aber, nachdem
er am Ende ausgetragen wurde, wie nichts verpufft. Ein Traum?
Und dann gibt es wieder Passagen, die nach Lebenshilferatgeber klingen:
"Dreh dich nicht um. Geh weiter, auch wenn du es nicht verstehst. Du
wirst es morgen verstehen." Sicher, die Erfahrung, den ganzen Weg
gegangen zu sein, kann Büscher niemand nehmen. Und doch schimmert an
solchen Stellen ein allzu deutsches Pflichtethos durch, das auch die
bisweilen packende Sprache nicht bändigen kann.
Büscher ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der seine Füße
gebraucht und darüber schreibt. Seine Paten heißen Johann Gottfried
Seume oder Theodor Fontane, Michael Holzach oder Werner Herzog.
Heutzutage über das Laufen zu schreiben heißt eben auch, den Anachronismus
der Moderne, der in ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten besteht,
zur Sprache zu bringen. Was nehmen wir wirklich aus einem über die
Autobahn, zumal über eine einsame russische Autobahn brausenden Auto
heraus wahr, ein Gefühl, das Büscher mit einem "Transatlantikflug"
gleichsetzt? Der Wanderer ist da tatsächlich nichts anderes als "ein
unidentifizierbares, allenfalls bemitleidenswertes Ding", das sich in
den Staub der Straße drückt. Aber er hat wenigstens etwas erlebt.
"Was machen wir jetzt?"
Kurz nach der ersten Kälte erreicht er in Mitten von Kaufhäusern und
vorbeiziehenden Luxuslimousinen Moskau. "Kaukasische Männer standen
herum, in ihren Fingern spielten Rosenkränze und Banknotenbündel, sie
wunderten sich, als ein komischer Penner mit brennenden Augen und einem
heiseren Jubelschrei auf das Ortsschild von Moskau zulief und es
umarmte. Er war da."
Doch die Luft ist raus, und der Nachspann liest
sich wie ein Stück aus einem billigen Krimi. Das Schriftstellerdorf
Peredelkino und Boris Pasternaks Haus besucht Büscher mit Anzug und
der Staatskarosse eines befreundeten "neuen Russen", und im Wagen wartet
immer schon Natascha auf ihn und fragt: "Was machen wir jetzt?"
Beim Leser bleibt am Ende von Berlin - Moskau das Gefühl zurück,
das sich nach dem Besteigen eines Berges einstellt: wer rauf geht,
muss immer wieder auch runter und kommt meistens dort an, wo er
aufgebrochen ist. Fast drei Monate Wanderung durch die tiefsten Tiefen
des geheimnisvollen Ostens sind nach 230 Seiten quasi ausgelöscht.
Denn Moskau ist anders. Moskau ist schon wieder Westen. Und der Hit
"Ja ljublju tebja", der in sämtlichen Dorfkneipen dudelte, ist allenfalls
noch etwas für die Berliner Russendisko.
p.w. - red. / 30. September 2003
|
|
|