Hamburger Staatsoper. Besuchte Vorstellungen: 21.2. 2007, 27.2.2007, 2.3.2007.
Richard Strauss. Frau ohne Schatten
|

|
Strauss ohne (allzu viel) Schatten
|
Bekanntlich leben Kunstwerke fernab von Stilen, Strömungen, Schulen. Manche von ihnen gewinnen ihre Einzigartigkeit aus dem Grad an Sperrigkeit, mit der sie sich dem einordnenden, falsch identifizierenden und röntgenologisch ausgerichteten Blick der Moderne entziehen können. „Die Frau ohne Schatten“ entzieht sich ihrem Zeitalter in mehrfacher Hinsicht: durch ihren Märchencharakter. Durch ihre ethisch-moralische Perspektive. Durch ihre gewagt simple Utopie. Durch ihre Länge. Und natürlich durch die Abstand schaffende Perfektion wie sie eine Arbeit des Ausnahmeduos in der Opernwelt Hofmannsthal und Strauss an den Tag legt. Und diesem Werk ist in seiner Rezeption, selbst in Wien, häufig unrecht angetan worden. Ganze Szenen wurden umdisponiert, weggelassen gar. Sicher ist es kaum untertrieben, wenn man Generalintendantin Simone Young besonderes Lob zuschreibt, „Die Frau ohne Schatten“ rein ohne Streichungen zu präsentieren. Auch auf die Gefahr hin, dass der dritte Aufzug, in dem das Schönste passiert, von etlichen Hamburgern nicht mehr wahrgenommen wird.
Dunkel beginnt die Inszenierung von Keith Warner, so dunkel wie das hinabgesprungene Keikobad-Motiv von Tenor- und Basstuba zu den schummerigen Holz- und Blechbläserakkorden. Auf offener Fläche. Man sieht Schatten. Nein, stehende Menschen. Ein Bote (exzellent: Jan Buchwald) will wissen, ob die Kaiserin schwanger ist. Eine Amme (Gabriele Schnaut), die man kaum versteht, antwortet, dass dies weiterhin nicht der Fall ist. Nun erfährt man, wie ein weiß-silbriger Kaiser (grandios: Stuart Skelton) auf Jagd geht, nach seinem Falken suchen möchte. Und er nimmt dazu ein Armbrüstchen mit. Dann stellt sich die nächste Kandidatin vor. Ganz ähnlich zu den musikalischen Motiven in diesem Expositionsteil verläuft das hier. Die schöne Kaiserin (Emily Magee) macht träumende Flugbewegung im Raum: „Ist mein Liebster dahin ...“. Noch ist ihr gar nichts klar. Aber sehr bald flüstert ihr ein blassgeschminkter und im abstrichroten Velourshirt unter Frauenanzug steckendes Falkenweibchen (Irena Bespalovaite) die Koordinaten ihres Unglücks: „Die Frau wirft keinen Schatten, der Kaiser muss versteinern.“ Will sie wirklich Mensch bleiben und ihren Geliebten retten, braucht sie einen Schatten: Gebärfähigkeit.
|
| Wechsel. Heruntergefahren kommt eine von Bühnenbildner Kaspar Glarner stichhaltig eingefangene Färberhausatmosphäre: Die Felle bluten aus, tote Ochsen hängen an der Wand. Roh ist es hier. Leben ohne Überguss. Doch Barak, der Fellfärber am Stein, ist musikalisch umso weicher gezeichnet. Ein lieber Mann, allzu lieb, um sein unwohlig fühlendes, herumzickendes Fräulein zu verzücken. Seine in Hamburg etwas pausbäckigen, eigentlich aber monströsen Brüder nerven zudem total ab, wie Musicalfiguren in der Oper. Das Färberpaar bekommt keine Kinder, obwohl die Frau eigentlich genug Schatten hat. Aber durch die vereinseitigende Darstellung von Lisa Gasteen eben doch nicht hat: Unmittelbare erotische Anziehungskraft. „Jung und schön“ wünschte sie sich Hofmannsthal – gesanglich kommt Gasteen dem mit ihren enervierenden „Barak“-Rufen näher als mit den manches Mal zu schrill geratenen Ausbrüchen. Gegenüber der gebrochenen, pflegebedürftigen Stimme von Daniel Sumegi jedoch die plausiblere Besetzung.
|
Der Schatten wird getauscht. Von der Färberin zur Kaiserin. Wie Manon unterliegt die Färberin dem teuflischen Reiz des Komfortschönen. Einem Tuch. Und einem jungen Traumjüngling – eine Mad Max light-Version (Benjamin Hulett). Doch der Tausch des Schattens scheitert. Weil er ungerecht ist: Barak leidet. Sitzt weinend der Kaiserin gegenüber.
Sie erträgt dieses ungerechte Tauschverhältnis auf Kosten der Leiden eines Anderen nicht. Lehnt es ab. So will sie keine Menschin bleiben. Gefährdet lieber sich und den versteinerten Kaiser. Die Kunstfiguren des Stücks. Und als alles vollkommen offen ist, nach dem etlichen hin und her zwischen der rohen Welt des Färberhauses und der silbrig schimmernden, auf das Unendliche angelegte des Falknerhauses im zweiten Aufzug, beginnt der dritte Aufzug eigentlich in der dunkelsten Ecke überhaupt, einer von Orpheus und Dante her bekannten Unterwelt. Hier zeigt die Inszenierung zum ersten Mal die uns heute umgebende Realität, eine U-Bahn Station „Keikobad“. Barak und seine Frau versöhnen sich nach anfänglich maximaler Entfernung in einem straussisch wunderschönen Liebesduett. Dann, im finsteren Gewölbe begegnet die Kaiserin ihrem Vater: nicht persönlich, nur seiner Aura. Und sie widersteht alle endlos quälende Prüferei. Der „Hüter der Schwelle“ ist dabei ihr psychologischer Schatten. Sieht genau aus wie die Kaiserin: weißblond, mit weichstem Gazellenfell über der Schulter. Die wunderbarste Szene des Abends und sicher eine mit Ewigkeitswert ist die sich und die Staatoper in Rausch singende Emily Magee vor dem heruntertropfenden Körperwasser ihrer darstellerisch brillanten Hüterin Christiane Karg. Dazu eine die Hamburger Philharmoniker zu erfüllender Klangpracht dirigierende Simone Young. In jeder Hinsicht ist das allergrößte Oper.
|
| Die mit dem hier abwechselnd gesprochenen „Ich will nicht“ den Kaiser aus seinen Ketten befreiende Kaiserin sorgt für die letztmögliche Einlösung der freilich bürgerlichen Utopie, die Warner durchaus doppelbödig zeichnet. Eine grüne Trasse, durch ein Bächlein getrennt, kommt da hereingefahren. Es ist schlichtweg ein Zuviel des Guten. Eben, wie das Werk ein Zuviel will: Versöhnung, Liebe, Einheit, ein gelingendes „Überleben der Menschheit“ (Hans Mayer). Diesem Anspruch gegenüber erweist sich die Schlussszene in hohem Maße werkgerecht: Warner weiß sogar geschickt das von Hofmannsthal/Strauss eigentlich hierarchisch gedachte Gefälle zwischen den Paaren zu korrigieren. Findet ein in der Tat märchenhaftes und authentisches Symbol für eine friedliche und brüderliche Gesellschaft. Authentisch eben auch darum, weil er dieses Bild doppelt bricht: einmal in dem er die Paare ihr Idyll selbst von Außen betrachten lässt. Und einmal durch einen heruntergelassenen Gazeschleier. Nicht zum ersten Mal sehen wir darauf dies beleuchtete Rechteck vor uns. Und fragen: Ist dieser markierte Übergang zwischen den Realitäten nicht selbst Keikobad, der in dem ganzen dreieinhalbstündigen Werk, wie der Großkritiker H.H. Stuckenschmidt einst so heftig bemängelte, nie persönlich auftaucht, außer als Motiv? Könnte ja sein, dass sich da jemand was bei gedacht hat.
|
| Trotz oder gerade wegen dieser Art von Fragezeichen ein voller Erfolg: Für das Werk, das ungekürzt erstrahlen kann. Für Generalmusikdirektorin Simone Young, die sich als eine wunderbar ausdifferenzierte Strauss-Exegetin erweist und wie Pausengespräche offenbaren die Menschen noch tagelang nach der Inszenierung mit den phänomenalen Klangergebnissen der Hamburger Philharmoniker (Sonderlob: Solo-Violine) zu beschäftigen versteht. Für Emily Magee, die sich als eine Sopranistin von Graden vorstellt. Und nach den zuletzt so schlappen Inszenierungen an der Staatsoper, gerade angesichts eines sehr schwierigen und kantigen Werks, für Keith Warner. Bravo. Buhs gab das Publikum Frau Schnaut als mittlerweile schlichtweg überforderte Amme und Daniel Sumegi für einen an Grundheber-Maßstäben gemessenen desolaten Barak. Und es rufen diejenigen gegen Simone Young, die Richard Strauss wohl nicht so gerne mögen. Oder anderes. Aber das wäre eine andere Geschichte.
|
Wolfgang Hoops - red / 6. März 2007
ID 3049
Richard Strauss
Die Frau ohne Schatten
INSZENIERUNG: Keith Warner
BÜHNENBILD: Kaspar Glarner
KOSTÜME: Eva Dessecker
LICHT: Wolfgang Göbbel
Aufführungen:
18. März 2007 19:00 - 23:15 Uhr
Ort:
Großes Haus
Weitere Infos siehe auch: http://www.hamburgische-staatsoper.de/3_spielplan/frameset_spielplan.php
|
|
|
Anzeigen:



Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BAYREUTHER FESTSPIELE
CASTORFOPERN
CD / DVD
INTERVIEWS
KONZERTKRITIKEN
LEUTE MIT MUSIK
LIVE-STREAMS |
ONLINE
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
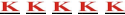
= nicht zu toppen

= schon gut
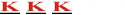
= geht so
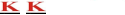
= na ja
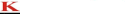
= katastrophal
|