Hamburgische Staatsoper, 22. Februar 2009
Claude Debussy
Pelléas und Mélisande
Wiederaufnahme
|

|
Willy Deckers zehn Jahr alte Inszenierung zu „Pelléas und Mélisande“ wird an der Hamburger Staatsoper wiederaufgenommen.
Der Vorhang geht auf und wir sind im Traum. Uns posiert eine kniende Frau mit Krone. (Welch Zeitraum, welche Ordnung, wie viel verlorene Historie, wie viel Traurigkeit spricht bereits aus diesem Bild?) Sie kniet vor einem antiken Rundbrunnen. Traum, das wissen wir, bedeutet immer eine andere, aber gleichberechtigte Wirklichkeit, es bedeutet, dass das eigene Ich in allen Schattierungen gezeigt wird, bzw. dass das Ich darin sich selber inszeniert. Viele Opern (und Stücke) zeigen dem Ich der Menschheit sein Unbewusstes, ganz wenige nur tun dies jedoch wie das Drame lyrique Debussys konsequent mit den Mitteln des Traumes selber: Symbole, Vagheit, Andeutung, Verzerrung, Absurdes gehören genauso zu ihr, wie der Schnitt, das Erwachen und die Alinearität der Handlung. Und, was wir wissen sollten: Das, was gezeigt wird, ist nicht das, worum es geht, vielmehr ist es das, was das Dahinterliegende zu öffnen vermag.
|
| Nach einer Traumdeutung zu Pelléas und Mélisande passiert darin nämlich ungefähr folgendes: Ein Herr Golaud trifft auf die eben eingeführte kniende Frau – es ist, wie wir bald erfahren, die überirdisch schöne Mélisande. Das erzeugt nun das Begehren unseres Jägers. Da dieses übermächtige Begehren unkontrollierbar ist, ruft es Angst hervor. Wir sehen sie zum Beispiel in reaktivierter Gestalt bei seiner Entdeckung ihres Ringverlustes. Solche Angst erzeugt Orientierungssuche an Normen, wie sie sich in bürgerlichen Normalgesellschaften und natürlich auch zwischen Golaud und Mélisande durch die Ehe zu realisieren pflegen. Nun werden solche Normen (aus der Sicht des Normengläubigen) schnell überschritten, weil das Schöne – sonst wäre es nicht – sie weder erkennen noch anerkennen kann. Aus Übertretung der Norm folgt Strafe – wer vom Apfelbaum aß –, in diesem Fall sogar Mord an seinem Halbbruder Pelléas. Die Strafe führt zum Verlust, ja zur Auflösung des Schönen selber.
|
| Soweit, so nah. Diese Kette – Schönes, Begehren, Angst, Norm, Strafe, Tod – sehen wir jeden Tag, jetzt sehen wir sie als Traum zu einer Musik, die es möglich macht, diese Unheilskette zu erkennen und zu durchbrechen. Ach, ist nicht Debussys Musik von den intimen Seinsbeschreibungen zwischen Mélisande und Pelléas bis hin zu den späten Sonaten in weiten Teilen von der Vorstellung begleitet, Begehren und Schönheit in ein neues angstfreies und natürliches Verhältnis zu setzen, die Mordkaskade zu umgehen und die Schönheit aus der Natur zu erhalten? Ohne jetzt mit dieser Theorieschiene noch weiter zu langweilen, sei angemerkt, dass Willy Deckers Inszenierung eine Traumarbeit geblieben ist und Lawrence Foster am Pult alles gegeben hat, um die musikalische Ausgestaltung eines Traums zu verhindern – was stellenweise nicht gelungen ist.
|
| Decker arbeitet in einer recht strengen Form, einer mal hellweiß, mal schwarz-dunkel gehaltener, halbrund wie halbseiden aufgehängter Arenatuchung. Darin können sich die Schemen von Personen äußerst frei entfalten. Die Auseinandersetzung läuft sowohl über Symbole, wir sehen Apfel, Fisch, Brunnen, Sonnenuhr, als auch über sublime Psychologie und den Choc (wie im 4. Akt). Den Reduktionismus in punkto Farbe kompensiert Decker durch die Verlängerung des Blicks auf die Wesen des Traums. So entstehen Bilder, die im Betrachter zu Impressionen anwachsen. Man denke neben dem skizzierten Eingangsbild an das morbide Bild der „Familie“, an die drei Glatzen in der Grotte, an Yniold und den Stein, natürlich auch an Mélisande auf dem (phallusartigen) Turm oder wenn sie auf immer einschläft. Was man an Deckers Inszenierung neben einer einstudierungsbedingten, teilweise sicher recht blassen Personenführung (auf der Leiter) bemängeln muss und weshalb diese Arbeit nicht ganz an das Verdichtungsniveau wie zuletzt bei seinem Amsterdamer „Boris Godunow“ oder älteren Arbeiten wie der Salzburger „Traviata“ und auch der Hamburger „Salome“ heranreicht, mag nicht unwesentlich damit zusammenhängen, dass er davor zurückscheut, die Beschränkungen, die er sich durch die Bühne Gussmanns und den Farbverzicht auferlegt, zeitweilig zu durchbrechen und so die Form mit ihrem Widersacher stärker zu konfrontieren, wie die Musik es immer wieder tut (3/3 oder 5). Dort, wo Decker sich das traut, wie z.B. einfach durch eine Stuhlfackel zum Ausgang der zweiten Szene (um damit Golaud ein Zeichen zu geben), kommt es sofort zu einer Maximierung des Ausdrucks, zu einer metaphysischen Intensität. Dort, wo Decker sich an die Form und in der Form hält, wie selbst noch bei Mélisandes Tod bleibt er, trotz der charmanten Idee einer transzendenten Verdoppelung, in einer simplen binären Logik verhaftet und befangen.
|
Wenn die letzte Szene so eine Wirkung auf das Publikum ausübt, dass uns lange Zeit nach dem Verklingen der allerletzten Flöten- und Streicherhauche noch eine Stille-Fermate erhalten bleibt, so liegt das an der Mélisande Gabriele Rossmaniths. Sie ist eines der Theaterwunder, die, obgleich sie die Akte 1-3 – offensichtlich vom Zeisig gepackt – komplett in den Teich gesetzt hat, uns durch ihr einmaliges Blickverhalten und durch Rückkehr zu einer Gesangskultur letzter Worte mit einem vollendeten Eindruck nach Hause schickt. Rätselhaft ist und bleibt sie. Eher kompakt und wuchtig als elegant und rund präsentiert sich Michael Volle als Golaud. Eine Musik der Worte zum Klang zu bringen, geht ihm ab. Das macht Renate Spingler in der Briefszene besser. Vor allem weil sie ihr Tempo singt, niemanden imitiert, sondern Geneviéve auf eine eigene, subtile und einprägsame Weise entwirft. Erwähnen wir zwischendurch auch noch, dass Harald Stamm den Arkel bereits 1977 unter Hans Zender gesungen hat, bevor wir zu den Sängern kommen, deren Stimmen uns wirklich verzaubern konnten: Das ist der lyrische Bariton Adrian Eröds als Pelléas, eine Sternstimme mit hoher Halbwertszeit, und der Tölzer Knabe Andreas Mörwald als Yniold. Eröd singt so frei und unschuldig aus der Maske, wie ein Gebirgsbach aus dem Felsen tritt. Sein Pelléas gehört (neben Schmeckenbechers Beckmesser) zweifelsohne zu den männlichen Höhepunkten in dieser Spielzeit. Yniold wird eigentlich immer ein bisschen vergessen. Dank Andreas Mörwald mit seinem schlanken, konzentrierten Knabensopran besteht dazu keine Gefahr mehr. Ihrer beider Gesangsleistung ist umso höher zu veranschlagen, als ihnen mit Lawrence Foster eine merkwürdig abgesnackte musikalische Leitung gegenübersteht.
Wo Debussy die Auferstehung Allemondes als Passion entwickelt hat, dirigiert Foster auf sonore Schmerzfreiheit, wo Debussy den Traum von kristalliner Schönheit komponiert hat, dirigiert er nichts außer falschen Glanz, wo Debussy Fragezeichen setzt, schlägt er auf Vorfahrt, wo Debussy Klangmischungen evoziert, provoziert er das alte Primat der Streicher, wo Debussy Zeit zum Atmen lässt, hechelt er, wo Licht gesetzt ist, interessiert er sich für das Dunkle, wo Debussy Gesang deklamiert, blamiert er die Stimmen durch Masse. Konkreter? Die Einstiege in die Akte 1-3 sind allesamt katastrophal verlaufen und gekennzeichnet von absoluter Vulgarität, Szene 2/2 ist ein Flickenteppich, ein Patchwork aus Nichtprobe. Instrumente wie die Harfe (!) spielen im Off. Interessant und hervorhebenswert sind die Klangergebnisse, die mit vermeinter Rücksicht auf Yniold entstehen. Die Ballszene (4/3) ist musikalisch eine der gelungensten an diesem Abend. Das einzige, was man Foster neben einer abnormen Liebe zu Kontrabässen darüber hinaus noch attestieren kann, ist, dass er die Stufe Debussy in der Musik nicht genommen hat. Die Philharmoniker spielen mithin dort am besten, wo sie ihn seinen Unfug schlagen lassen und stattdessen dem Tempo von Eröds Melos folgen, wie es im vierten Akt partiell gelingt. Hier kommen Momente einer einzigartigen Oper, einem Wunder an Musiktheater zu Gehör, wie es von einer Hamburger Debussy-Vorstellung einstmals in toto erwartet werden konnte: Bitte nutzen sie die Gelegenheit und proben sie!
|
Wolfgang Hoops - red / 26. Februar 2009
ID 00000004214
Claude Debussy
Pelléas et Mélisande
in französischer Sprache
Unterstützt durch die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper
Aufführungen:
3. März 2009 19:00 - 22:30 Uhr - Online-Verkauf
6. März 2009 19:00 - 22:30 Uhr - Online-Verkauf
Ort: Großes Haus
Weitere Infos siehe auch: http://www.hamburgische-staatsoper.de
|
|
|
Anzeigen:

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
THEATERTREFFEN
URAUFFÜHRUNGEN
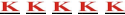
= nicht zu toppen

= schon gut
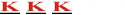
= geht so
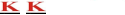
= na ja
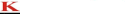
= katastrophal
|