Georg – Kolbe - Museum Berlin, 11. Februar - 28. Mai 2007
Der Aufriss der Gestalt
oder unverschließbare Schwelle der Berührung
Über die Ausstellung „Die Macht des Dinglichen. Skulptur heute!“ im Georg – Kolbe - Museum Berlin
Text: Gerald Pirner
|
Welches ist der eigentümliche Raum dieses Denkens und welche Sprache kann es sich geben? Zweifellos hat es sein Modell, sein Fundament, seinen Wortschatz in keiner bereits definierten Reflexionsform, in keinem schon ausgesprochenen Diskurs […] Doch sollten wir lieber versuchen, von dieser Erfahrung zu sprechen und sie in der Ohnmacht ihrer Sprache sprechen zu lassen, gerade dort, wo ihr die Worte fehlen, wo sich das sprechende Subjekt verflüchtigt, wo sich das Schauspiel im verdrehten Auge zu drehen beginnt. (Michel Foucault)
Zustoß der Berührung Hand erfüllt, allein sie Kontur allem Gegenständlichen und aus ihm etwas herausgerissen, das in ihrer Fläche und deren Krümmungen jedes Mal anders montiert… Kanten, Materialübergänge, formend geformter Hautabdruck, Eigenschaften wörtlich eingestürzter Körperäußerungen, die bildlos keine Gestalt halten. Verschwunden ist diese hinter ihrem Fragment, das die Hand sich zuteilt als wäre es von ihr… Berührter Gegenstand seiner Gestalt sich entzogen, im Alltagsraum dem Blinden umgehbar, solange der Gebrauch unter seinen Vorgaben gelingt. Zum Wort wird er in der Handhabe, wird ausgesprochen zu dem was er vorher schon war: Ein wörtlich erfasster Begriff, wenn im Zweck auch nur unter einer Bedeutung. Die aber genügt dass er weiterkommt, dass er drum rum kommt, dass er an dem ankommt, was sein bildloses Bild im Nachhinein bestätigt.
Der Kunstraum aber und zunächst nicht das Kunstwerk, dem Tasten primär auch nur die Eigenschaften durchdekliniert, entzieht alle Feststellung und lässt die Hand nicht mehr ankommen, weil kein „und weiter“ oder „dorthin“ ihre Bruchstücke überformt. Bei sich bleibt sie und hat solch Sich spiegellos zu ertragen.
Nicht die geschlossene Tür mit der Klingel. Diesmal zum Garten und dorthin ein Raum geöffnet aus dem klappernde Schritte wie gestöckelt. Eine laute Stimme eine Frage wiederholend, weil sie vergessen, dass sie sie bereits gestellt und auch das sagt sie und verstummt. Dann endlich hinter dem Rücken die Schläge und Wärme gespürt aus der Richtung wo mit dezentem Geklirr etwas abgestellt. Angefordertes in Gegenständen auffordernd, dass das getan wird, was bestellt. Vorsichtig greift er hin, ist es doch heiß und das weiß er und der kleine Henkel will erst noch gefunden werden. Dann trinkt er und trinkt in kleinen Schlücken, auf gesellschaftliche Weise Dinge vergegenständlichend, indem er sie gebraucht, indem er von ihnen spricht und indem ein jedes Wort so tut, als gingen solche Gegenstände über seine Haut hinaus…
Wo die Ausstellung „Die Macht des Dinglichen. Skulptur heute!“ im Georg - Kolbe - Museum über das Haptische einen Zugang zur Skulptur andenkt, will der folgende Text Haptisches wie Taktiles weitestgehend wörtlich nehmen. Dabei sucht er das Bild zunächst auszublenden, was einem Blinden, wie dem Autor dieser Zeilen, nur scheinbar organisch erleichtert. Verfügt der Sehende doch über ein Bild, das alle anderen Bilder ausgrenzt. Solches Hilfsmittel aber steht dem Blinden nicht zur Verfügung. Alle in einem jeden Moment seiner Wahrnehmung einstürzenden Bilder muss er erst einmal wieder loswerden und da hilft eben kein Geschau.
Ausgehend von Heidegger der seinen Begriff des Dinglichen zwischen „Versammlung“, „Fassen“ und „Halten“ aufspannt ist der in der blinden Berührung einbrechende Gegenstand, der, kaum erschienen, hinter seiner Materialität schon verschwunden, als ein Zustoßen und Aufbrechen zu verstehen, das Eigenschaften bei sich zusammenzieht, ohne sie allerdings bei sich halten zu können. Denn Halt ist hier in solchem Eindringen eher Berührtwerden und das Gefäß weniger Heideggers „Krug“ denn ein Körper, dem das Adjektivische des Materials keinen Gegenstand verschließt. Ohne solchen Verschluss aber verläuft sich Fassen, will es nicht Ergreifen und Heideggers betrachteter „Krug“ wird undicht. Fassen ohne Halt lässt bildlos die Hand ins Material greifen, ohne dass solcher Art Begriffenes tatsächlich erfasst. Der Begriff des Dinges in der Philosophie bezeichnet immer wieder eine Unbezeichenbarkeit, lässt ihn ganz geöffnet vom Denken umgehen und manches Mal fast betasten, als nähme das Sehen sich in ihm zurück, suchte in seinem Inneren die Blindheit und suchte sie als seine allererste Gründung.
|

Florian Baudrexel, Halt mich fest, 2006, Pappe auf Holzrahmen 194 x 330 x 95 cm, Courtesy Arndt & Partner, Berlin/Zürich. Foto: Bernd Borchardt.
|
Skizzen zwischen Raum und Skulptur
Etwas in der Hand auf der Schwelle seiner Materialien von keinem Bild in Gegenstand gezogen. Spuren der Verarbeitung, des Gebrauchs noch bevor von Eigenschaften Gestalt ausgedacht… Stumpfes Geraschel herausgetastet, selbst da welk wo der Staub weggewischt. Um ein Schraubengewinde herum wellige Pappkartoninnereien, ausgefranst an Rändern um nicht aufzuhören. Vorsichtig die Finger an spitz verschieferten Holzleistenkanten und weiter rein wo kein Blick folgt… Allzu glatte Kartonfläche ertastete Spuren anderer Finger, dem zu Werk montierten Verwertungsmüll neue Geschichte eingraviert. In Norm-Gegenständen vermittelte Handlungsanleitungen von unverwendbaren Produktionsmittelresten ausgeschieden… Stapelpaletten hier als vertikales Gestell und in Holzverstrebungen das zurückhaltend, was durch die Wand und von Außen hereinbricht. „Halt mich fest“ so der Titel von Florian Baudrexels Arbeit – eine Raumkontraktion in einen Raum einbrechend. Verfächert, vereckt, verschluchtet, ihn mit dem konfrontierend was er vermeintlich trägt, was ihn ausmacht und gegenständlich auslöscht. Zeit kein „und weiter“. Gestürzt sie in einen Ort der ihre Materialschichten zu Dreidimensionalität verstaucht, und langsam tastet der Finger in aufklaffenden Stillstand… Die Haut vor unberechenbarem Material auf der Hut, in Gestalt der Hand sie hineingelegt, als käme es in solcher zu sich, würde das, was es niemals wäre und erschiene doch nie anders denn auf ihr. Bildlos scheidet allein Berührung zwischen Gestalt und Raum und verteilt diesen unter deren Vielzahl. Etwas Imaginäres dabei produzierend ist der Begriff des Raums für den Blinden doch sinnlos. Schritt um Schritt stoßen Hören, Riechen und Berühren zu und kein Bild hält deren Einbrüche vom Leib. Räumliches bleibt so in Blindheit bei sich. Was ihr zustößt zerreißt alles Imaginäre. Nur in seiner Vorstellung glaubt der, der nichts sieht, dass er irgendwo rauskommt. Im Bild verläuft der Raum in Zeit. Geschieden von sich und getrennt von seinem Aufeinmal wird er messbar und Elementen und Partikeln unterworfen. Im Dinglichen aber stößt er dem Blinden zu, fällt in seiner Unberechenbarkeit über ihn her und der Handausschnitt, dessen worauf da gestoßen: Nur Material ist es in seinen Eigenschaften schwimmend. Nichts hält es zu Gegenstand und kein Gegenstand bringt Dingliches zum Verschwinden. In blinder Hand das Material zugleich Ding und Gestalt. Gegenstand wird es erst im alltäglichen Umgang. Der Kunstraum aber und das Kunstwerk in ihm, dies Kunst-Ding blockieren solche Wahrnehmungsfluchten.
Florian Baudrexels Arbeit kontrahiert den Raum im Ding, lässt diesen Einsturz Darstellung werden, ohne dass in der Bewegung der Hand etwas als dargestellt bestimmbar. Werden ist es und Aufeinmal und in einer jeden Berührung Raum in Geruch in Geräusch in Getastetem in berührend Berührtwerden sich um das Ding lagernd sich an ihm füllend zu etwas, das Zeit vernutzt um einen Moment zu verbleiben.
Zweite Begegnung: Wand lang und deren Parallele auf eine andere, die zur Ecke sie aufstößt. Genutzt sie als Handlauf und durch Rahmen und durch Leisten, nein, kein Holz, viel zu kühl… Glatt unverschliert zurückgenommene Geräusche – die Sehende die sieht da durch, für den Blinden kommt nichts von Draußen. Nur was auf Haut trifft ist da und sonst nirgends. Was erwartet stößt nicht mehr zu. Angetroffen wird es und selbst wenn der Blinde es anderswo vermutet. Holz gesägt, die Spuren davon zwischen etwas Feuchtem gerochen, zwei Stadien des selben Stoffes und die Hand erneut über Pappe, die Staub feuchter erscheinen lässt als sie ist. Ein anderer Staubgeruch und viel trockener eher steinern: Die Hand sucht findet nichts, fährt über gekippte Ecken, denkt Giebel und das Gehirn setzt Leisten als Mauern dazu. Unter beiden Händen Ruinenfelder. Architektur von der Wand in das gedrungen, was sie auszeichnet, was sie aufweist und ausformt: den Raum. Höhen und Stürze von blinder Hand in Fläche gekehrt aus deren Zweidimensionalität die Tiefe in den Körper wuchert. Die dritte Dimension von ihm aus konstruiert und das Ding fällt in der Hand mit dem Raum zusammen und nichts bleibt solcher Deckung denn Körper.
In der Blindheit wird Mensch zum Flächenwesen. Aus skizzenhaft eingedrungenen Gravuren die dritte Dimension konstruiert und noch wo Flächen verstuft gekrümmt oder gebogen sind sie nur die gekrümmte verstufte gebogene Fläche der Hand. Wo Raum nichts denn unverfugte Zustände der Haut, atmosphärisch verdichtet, dass davon erzählt werden kann, werden auch Begriffe wie Innen und Außen sinnlos. Abfolgen von Aggregatszuständen sind sie, unterschiedliche hohe Intensitäten an Verdichtung von Schmecken Spüren Fühlen von Tasten Berühren Hören und Riechen. Hans Schüles Arbeit „float“ scheint mit diesem Gedanken zu spielen. Ein Rohr - diese physikalisch eindeutige Scheidung zwischen Innen und Außen - in Ringe gesägt, von der Wand weg sie zu Wölbungen verfugt, auseinander hervorgehende Blasen bildend, sich teilend, Zellgewebe nicht unähnlich, klebrig in der Hand und zugleich rau, scharfkantiger Stahl in Haut ritzend… Ein durchlässig gebauschtes Gebilde, luftig gegen sein Material, in Bewegung gleichsam aufgebläht, als triebe etwas zu amorpher Gestalt auseinander, das sich und sie auch wieder zurückziehen werde… Das Spiel ums Ganze und den aus ihm gewonnenen Teilen in der Schwebe gehalten, kehrt gelenktes Durchströmen des Rohrs sich in höchst mögliche Öffnung, den gerandeten Kreis als seine zweidimensionale Grundform dabei vervielfachend und in seinen Verschiebungen, in seinen Biegungen um sich, in seinen Krümmungen zu ganz neuer Tiefe, zu vollkommen anders ausgeformter Ausdehnung kommend, ohne dass die Grundform des Kreises in ihrer „Geradlinigkeit“ aufgegeben. Sie verdoppelt sich, bringt sie aus sich selbst hervor, teilt sich und verteilt sich wie eine organische Matrix, eine Grundstruktur die etwas einnimmt ohne es einzuschließen, den von ihr ausgewiesenen Ort als Innen wie Außen neu öffnend, sich allseitig tasten lassend und was hineingreift erfasst solch Innen als Außen und was zufasst greift Außen als Innen… Aus Verschiebungen einer Fläche die dritte Dimension gewonnen und Durchlässigkeit gleich mit vervielfacht: Röhrenrichtung als Plural über die ganze Oberfläche verteilt. Die umformende Hand deckt solche Durchlässigkeit ab und in den gespürten Ringen gespürt, dass allein sie verschließt. Ihre Fläche - im Streifen ist sie Abdeckung Wesenhaftigkeit dabei entstellend und zugleich allein von ihr hervorgebracht gedacht. In tastender Betrachtung von Händen an- und miteinander verschweißte Einheiten zu handbreiten Wucherungen verzeitigt, einer Bewegung also unterworfen, in welcher dem Blinden im vermeinten Festkörper keine Feststellung mehr möglich und er, sich von der Skulptur leiten lassend, in seiner Bewegung sie selbst in Bewegung spürend, eine Bewegung die zu keinem Ende kommt, zumindest nicht in ihm.
|

Jonathan Meese, Son, 2004, Bronze 44 x 29 x 25 cm, Courtesy Contemporary Fine Arts, Berlin. Foto: Jochen Littkemann.
|
Selbstporträt in Haut und Häutung
Jonathan Meese „Son“ (Selbstporträt): Polierter Granit auf Holzpodest, Thron einer Bronze als deren Kolportage und was da vom Künstler als Selbst dargestellt, verhöhnt zu allererst das Material. Die Hand auf Handgeformtem als wäre Teigiges erstarrt. Höhlen irgendwo, Wülste – zu Gesicht nichts daraus handhabbar. Erst Beschreibungen von Gesehenem ordnen zu Form aus, aber auch nur um von einer Vorstellung her von Deformationen zu sprechen. Jonathan Meeses Selbstporträt von seiner nebenstehenden Arbeit „Bildnis des Dr. Fu Manchu“ als Gestaltwerdung des Unfassbaren gleichsam kommentiert, be-steht am eisernen Kreuz an der Gurgel als Kritik von seinem Negativ her, die postmodernem „das oder das oder das“ ein „das jedenfalls nicht“ entgegenstellt.
Im Tasten Handausformungen vervielfacht, einander im Weg und versperrt, ohne dass eine Form daraus würde. Denken hätte zu Nase zu entscheiden oder zu einem Spalt als Mund, den zu finden der Auftrag an die Hand und die versagt. In Fassung zur Ruhe kommen der Form indem Material sich einer Fläche ergibt, die die Hand sich ausspannt – in der Vervielfachung ihrer Gestalt verliert sich die Form. Tasten nachtasten nicht über die Hand geht sie hinaus und kein Bild findet sich ein, das zu überdenken.
„Bildnis des Dr. Fu Manchu“ Tastenaggregate um ein aufgerissenes Maul, das als Platz seinen Ort verliert, weil nichts sich fest um es sammelt. Begriffenes zu Werden geöffnet kein Begriff verschließt es und der Name eine nicht erreichbare Referenz überzieht solche Bewegung in Bronze als Titel, dass ihrem Flusse wenigstens provisorischer Halt.
|
Für Sehende ein optisches Spiel zwischen Material Funktion und Aussehen, der Blinde ertastet aufgeblasene Kautschukkuben und der Witz von Harry Haucks „Von vorne nach hinten“ ist für ihn damit gestrichen bevor er überhaupt erzählt. Was nach Form und Farbe vom Sehenden für Gestein gehalten, entlarvt ein zipfelartiges Ventil an der Seite als Täuschung. Eine Lehmform mit flüssigem Kautschuk ausgegossen und die dann aufgeblasen: Selbstübergabe in Atem an die eigene Verdoppelung in Gestalt des Körpergewichts, denn 70 Liter fasst jeder der drei Kuben und die entsprechen den 70 Kilogramm Köpergewicht des Künstlers. Zeit und ihre Spur als Vergangenes als Kerben Risse und Ritzen auf der Oberfläche gleich mitproduziert, kolportieren weniger den Schöpfungsakt der Genesis als die Anmaßungen von Mensch und Kunst sowie die Fallen der Homonymie. Schöpfung gleich Schöpfung bleibt irdisch, das transzendiert keine menschliche Sprache und wo Produktion mit Wahrnehmung spielt entlarvt Hauck den pathetischen Gestus der Dekonstruktion als kleinen Gag an der Seite. In Form gepackte Ausscheidungen des Atmungsstoffwechsels durch einen Ventilschwanz hinein geblasen, da braucht Mann kein Geschlecht außer sich und schon gar nicht das andere. Ganz als Haut tritt er in Erscheinung und oberflächlich zeigt er seine Wunden. Zu denen steht er in freimütigem Bekenntnis und keine Talkshowbiographie ist von hier ausgestelltem Gummiprotokoll sonderlich unterscheidbar. Vom Größenwahn spricht Hauck, von der Reproduzierbarkeit von Zeit und Geschichte, von männlichen Allmachtsphantasien sowie von Materialkonnotationen zwischen Latex-BH und Porschereifen.
|

Blick in die Ausstellung (Axel Anklam, Angelika Arendt, Anke Mila Menck, Thomas Rentmeister, Harry Hauck, Florian Baudrexel). Foto: Astrid Busch.
|
Berührung, von keinem Bild abgehalten, markiert vor allem Gegenstand Halt als Befehl wie als Zeichen, dass das weich sei etwa. Er drückt und spürt einen festen Körper darunter. Der Hand nach Schicht um Schicht den Kern frei gelegt, herausgeschnitten, enthäutet… Stoffe Gewebe, in der Sprache schon organisch Anorganisches verwickelt, wie auch den Träger mit dem Getragenen den es überzieht, den es abschließt, den es in seinen Gerüchen, in seinen Aussonderungen auffängt und bei sich hält. Intimität wie Ver-Äußerung zugleich. Willentlichkeit und Unwillkürliches zur Schau wie zur Begrenzung ineinander verfangen und so dicht, dass alles Sprechen hier beginnt und zugleich endet. Kleidung und Haut nur als Häutung trennbar, herausgeschält aus abgetragenem Leben. Birgit Diekers Arbeit „Olga“ vernäht Zeitabschnitte zu Schichten übereinander, ihr Tun im aufgerissenen Klaffen zum Grund hin offen. Der blinden Hand Häutungen bei Haut und wo aufgeschnitten sie nur Haut freigelegt, alles darunter verschwunden, nichts verdeckt… Während in Schüles Komposition Form Formendes und Geformtes unter der Hand ineinander gegriffen, kommt die Berührung in Diekers Arbeit zu sich, oder kommt genauer nicht mehr über sich hinaus. Wie Raum im Bild hinter seiner Durchquerbarkeit verschwindet wird Körper unter Berührung zur Vorstellung und als solche hat noch der Blinde sein Bild, bildet darin sich Erreichtes ein, oder Erfasstes um das er dann herumkommt und wieder weg.
Lässig steht sie da und als lebensgroß, was er aus sich, sprich seiner Kopfhöhe geschlossen. An ihre fasst er hin: Maß eines Menschen hier dem seinen unterworfen, wo doch alles unter der Hand seine Wesenszüge verliert und erstarrt, sei es im Schrecken, in der Lust oder in der Neugier. Feststellung in Beschreibung sagt nichts anderes aus, als dass Berührung entstellt. Der blinden Hand ist nur Entstellung wirklich. So fasst er hin ohne glauben zu müssen, was er fühlt sei wahr, hat Wirkliches doch mit Wahrheit nichts gemein und so fasst er hin und glaubt, weil er sonst und noch in Sprache nicht mehr fortkommt. In Diekers Arbeit „Olga“ reflektiert blinde Wahrnehmung sich selbst und fühlt sich dabei - so wie die da steht – noch beobachtet.
|

Birgit Dieker, Olga, 2007, Kleidung, H. 189 cm, Courtesy Galerie Volker Diehl, Berlin. Foto: Markus Schneider.
|
Kleidungsstücke Textil unterschiedlich dicht gewebt, dann auch Gestricktes. Obenauf nachtastbare Rauten, ein Clownstrikot sagen die Sehenden, ein merkbares Gitter, das zusammenhält, meint die Haut. Durchtrennt die Gewebeschichten an der Seite. Jetzt die Hand und hinein und in dies Klaffen auf dessen Grund ein fingerrundes Loch, das sagt, dass das nicht alles ist, dass es aber nicht mehr gibt. Nochmals also Glaube und in Gestalt des Thomas dessen Hand in der Christuswunde den Unglauben austrieb. Glaube als Stiftung von Wirklichkeit aus der Berührung, und was nicht auf Haut, existiert nicht. Anspruch ist es, ganz nahe am Befehl, und auch der Blinde muss weiter, muss raus aus etwas, das er nicht sieht.
Arme angewinkelt, von Bekleidungsschichten abgeschnittene Hände und auf geschlechtslosem Körper, der nichts denn klaffender Umfang, ein herausgeschältes Kopfrund, nur um nachzuweisen, dass da kein Gesicht ist: Blöße allein und die weit über Nacktheit hinaus… Während die Hand auf einheitlichem Material dessen Ausformungen nach einem Rhythmus unterworfen – in hiesiger Ausstellung bei den Arbeiten Meeses etwa – gerät aller Verlauf unter Materialmontagen ins Stolpern und Berührung verliert ihre Fassung. Das Stocken der Hand an Materialschwellen und –schnitten ersucht andere Sinne um Hilfe und so riecht er, reibt Geruch aus dem Stoff, sucht was die Kunstwerkphase von ihrem Davor übrig gelassen. Dass sie all diese Kleidung einmal selbst getragen habe, sagt eine und der abgedroschene Begriff der Differenz findet sich in unterschiedlichen Gerüchen unterschiedlicher Stoffe ganz neu und gerade darin dass kein Wort an sie hinreicht. Sprechen in der Schwebe Spuren sammelnd ohne Wesen aufzugreifen…
Im Gesicht glaubt der Sehende das Gehörte zu sehen, die Echos eigener Worte in den Augen des anderen und der Blick ist es, der ihn daran hindert, sich optisch am andern zu vergreifen. Trotz ihrer Haltung versichert Diekers Skulptur Unbeobachtetheit und wo kein Auge vom Körper abhält, wird - und das weiß der Blinde zu gut - solcher Körper zum Objekt. Der unbeobachtete Beobachter ganz ungehalten und in nichts reflektiert - ein einziger Übergriff. Geste wie Tun aller Bestätigung enthoben, vergisst er sich, trachtet zu Objekt Gemachtes zu durchdringen und zerstört es, weil es sich ihm trotzdem entzieht. Schicht um Schicht aufgeschnitten und untersucht: Diekers Skulptur zeigt das Scheitern solcher Alltagsanatomie, denn Schicht um Schicht tritt nichts weiter hervor. Das Dingliche bei Dieker als scheiternde Objektivierung und die Rückkehr ins Unfassbare.
Auf ironische Weise korrespondiert Diekers Arbeit mit den statuarischen Skulpturen Georg Kolbes im Ateliergarten. Nackt die Brüste dort, das Becken, das Geschlecht in nach vorne geöffneten Händen sich hingebend. Diekers Figur hingegen vergibt nichts. Einfach bei sich spricht sie von einer Macht, die keine Bemächtigung zulässt, wie es die fleischigen Geschlechtsträger im Garten ihr gegenüber tun.
|

Marcus Widmers, Nike, 2004/2007, Polyester, Lack, 195 x 105 x 46 cm und Georg Kolbes, Große Sitzende, 1929. Foto: Adel
|
Das Begehren der Form
In Stufen getrocknete Schritte. Wände gleichmäßig ins Hörbare gezogen, das sie einhegen und halten. Gemauerte Backsteinsäulen, Platten drauf wie Deckel. Ein schmaler Bogen holzeingefasst. Eine Öffnung die zu hören, weil sie abschließt. Der Weg, das Gras, der Hügel dazwischen menschliche Formen oder das was in Hand zu solcher Teile gefühlt. Das Berührte aber scheint sich dem Ertasteten zu entziehen, müde dessen was es oberflächlich umfasst. Als Haut in Flecken und Flechten ergibt sich der Hand eine Bewegung, Gehaltenes pulsierend zwischen davor und danach, so als öffne Kolbes kauernde eine Geste, der Schenkel wie Arme nur folgen.
Kunststoffglatt dagegen Marcus Wittmers’ „Nike“, deren Oberfläche kein Halt der Hand, die sie abrutschen lässt zur Gestalt eines Frauenkörpers in Bewegung. Zielgerichtet der nach hinten gebogen, und am angewinkelten Arm eine Faust nach vorn, dass mit Sicherheit nichts im Weg bleibt. Während Diekers Figur soziale Räume wie Zeit in Bekleidungen angelegt, ist schon in Titel wie Ausstellungsort von Wittmers´ Arbeit auf Geschichte verwiesen, die nicht weit entfernt von Kolbes Atelier eine ihrer grausigen Stätten hat. Im Faschistenbau des Olympiastadions hier gleich um die Ecke steht noch eine andere Nike und die segnete als Siegesgöttin ganz andere Siege, von denen die Massenmörder schon während der `36er Olympiade geträumt.
Polyester schlüpfrig keine Ablenkung der berührenden Hand von der zielgeraden Haltung. Die Kraft aber, die da hineingelegt, scheint aus männlich gedachtem Fraueninneren das auszutreiben, was für Fetischismen tauglich und obendrein – den Namen der Göttin amerikanisch ausgesprochen – auch noch recht gut verkäuflich. Denn das einzige was diese Nike trägt sind Turnschuhe und die fühlen sich weitaus lebendiger und organischer an, denn ihr „göttlicher“ Körper. Lebendig aus ihm heraustretend auch das Geschlecht. Die Haare auf dem Kopf wie zwischen den Schenkeln borstig und ganz plastisch die Warzen auf den Brüsten. Über Merkmale zu Dinglichkeit und mittels derer die Frau so habhaft wie käuflich. Auch die SS ließ nichts anderes von vergasten Frauen übrig: Die Haare als Dämmstoff für die Industrie, die Kleider den arischstämmigen Müttern.
|

Matthäus Thoma, Ohne Titel, 2002, Douglasie, 240 x 250 x 420 cm. Foto: Adel
|
Wo in nicht zu Ende kommendem Beginnen das Ding vor seinem Gebrauch dem Material überlassen, das seine Gestalt dabei als Vorform sich aufgibt, leistet künstlerische Tätigkeit einem Prozess nur Hilfestellung in welchem das Material seine Gestalt zur Form ausdekliniert. Das Dingliche erscheint hier als eine Bewegung, die keinen Abschluss findet, die schlicht unterbrochen um von Neuem und einfach von einem anderen Ort aus sich durchzuspielen, sich zu verwuchern, sich fortzupflanzen. Die Form als Begehren des Dings, das mittels seines Materials vergeblich versucht darin sich selbst zu erfassen… Matthäus Thoma „Ohne Titel“: An- und ineinander verschraubte Holzleisten ähnliches Grundmaß in ihren Verdichtungen aufgehoben. Einzelformen eingepasst in ein Nachoben. Streben bildend wie eine mittlere Säule aus ebensolcher Leistengestalt die sie vervielfacht, verschiebt und in all ihren Formgebilden aus sich heraus sich rahmend tragend stützend… Heraus- und hinaufgeschraubt und zugleich in die Breite gotische Erdung fast über Hohlräume steigend, freigegeben aus verdicktem Rund. Schrauben tastbar die Leisten von ihnen zu Krümmung gebogen. Parallel aufeinander ganz unten ein tragender Sockel und wieder nichts denn diese sich vervielfachende Grundgestalt… Ein Schwarm sich in Form fassender gleicher Teile in ihm sie aufgehoben und wenn herausstakend niemals ungehalten. Integrierend alles in ein Gesamtrund ohne dass die kubische Grundgestalt darunter verschliffen. Unterworfen sie eher, dabei aber potenziert und überwunden in Formmöglichkeiten, die in sich sie einnimmt sie zu sich sammelnd. Dabei aber bleibt Form, diese Vervielfachung an Leistengestalt etwas Äußerliches. Nachgegangen wird ihr, sie regelrecht ausgefüllt und in ihr sucht das Material sich selbst zu verorten. Gefertigtes Material Fertigkeit entfaltend, Kommunikation als Monolog hin zu Imagination und dabei verwitternd, seine Zeit bei sich wie seine Bewohner. Die Hand durch Spinnweben in ein warmes Inneres. Zu Höhlung getürmte Leistenhaufen kurz erstarrt, dort ausfransend, da zerrinnend und vielleicht nur noch einen Moment an Statik, bevor alles in sie einstürzt um sich wieder und einfach anders aus sich herauszuschieben.
Klebrig wie verschwitzt der Hand den Materialbegriff entziehend und dass es PVC sei, was in Blasen da ausplatzt, Reiner Maria Matysiks „Leukobiont“: Feucht abtrocknende Gallerte an Lochrändern zu Nippeln verdickt. Formen nehmend wie gebend und als Gestalt dafür in Brüste gestülpte Schalen neben Lippenschlitzen, geöffnet zur Fortpflanzung oder Verzehr. Ein beinartiger Träger das Hinten stützend, das vielleicht sein Davor und die ganze Entwicklung dieses Gewächses in allen Stadien bei sich. Sich auseinanderfächernde Wölbungen verknöchert im Moment, einander blähend abstoßend einverleibend, in Spalten und ausgestülpten Verwulstungen… Vom Innen eine Wirbelsäule hinaufgetrieben und in lungenflügelartigen Dreiecken sich schließend: Matysiks Figurengebilde, ein Stoffwechsel für sich, in sich ruhender Kreislauf, sich selbst hervorbringender nährender Masse, dies reflexiv ganz plastisch. Geöffnet und geschlossen zugleich, Teile von Pflanzen oder Wirbeltierorganen, ins Gespenstische vergrößerte Viren und Bakterien mit ruhig verharrenden Schlünden, von Seeanemonen. Ins Eigenorganische einverleibt und doch kein Leib mehr. Ein alles ein- und ausatmendes Wesen, das alle Wesenheit aufnimmt um zu behalten, was es bestehen lässt und was aus und in ihm besteht.
Dann wieder Musik. Dezent zunächst. Schritt und Schritt näher Geschirrgeklapper. In Raum verfangener Ausgang. Eine überhörte Frage im Nachhinein am nachdrücklichen Ton erkannt. „Nein“, antwortet er, „wir möchten bezahlen.“
|

Reiner Maria Matysik, Leukobiont, 2005, PVC. Foto: Adel
|
Gerald Pirner - red / 12. Juni 2007
ID 00000003299
Weitere Infos siehe auch: http://www.die-macht-des-dinglichen.de/
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk
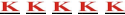
= nicht zu toppen

= schon gut
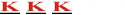
= geht so
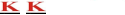
= na ja
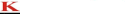
= katastrophal
|